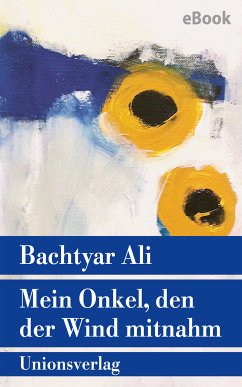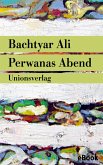Die wundersame Geschichte vom „Fliegenden Kurden“.
Bachtyar Ali ist ein kurdisch-irakischer Schriftsteller, der in Sorani, einer kurdischen Sprache, schreibt. Seine traumhafte poetische Sprachumsetzung macht die Lektüre seiner Bücher zu einem sprachlichen Hochgenuss. Sie sind Solitäre in der
Buchlandschaft. Seine Sprache ist leise, sich nicht in den Vordergrund drängelnd, nicht…mehrDie wundersame Geschichte vom „Fliegenden Kurden“.
Bachtyar Ali ist ein kurdisch-irakischer Schriftsteller, der in Sorani, einer kurdischen Sprache, schreibt. Seine traumhafte poetische Sprachumsetzung macht die Lektüre seiner Bücher zu einem sprachlichen Hochgenuss. Sie sind Solitäre in der Buchlandschaft. Seine Sprache ist leise, sich nicht in den Vordergrund drängelnd, nicht marktschreierisch. Er fabuliert im Stile orientalischer Märchenerzähler in scheherazadischen Bildern.
Der vorliegende Roman ist in Ich-Form geschrieben, von Salar, dessen Onkel Djamschid die tragende Person neben dem Element des Windes ist. Und wir als Lesende fliegen mit als „blinde Passagiere“ wie auf einem Fliegenden Teppich.
Djamschid war vor seiner Verhaftung wegen kommunistischer Umtriebe fast eine barocke Gestalt. Während der Haft, in der er allen Folterfinessen widerstanden hatte, war er zu einem Strich in der Landschaft, zu dem Schatten eines Menschen geworden. Als er wieder einmal zu einem Verhör abgeholt worden war, wurde er im Gefängnishof von einem starken Wind erfasst und sein federleichter Körper entschwebte in himmlische Sphären. Erst nach Stunden landete er auf dem Dach des großväterlichen Hauses mit einem ausgelöschten Gedächtnis.
Und so begann eine unfreiwillige Odyssee durch die Lüfte und ein biographisches Abenteuer. Er schwebte über die Landesgrenzen hinweg: er war eine menschliche Drohne im ersten Golfkrieg zwischen Irak und Iran, ein „Schlachtenbummler" mit einem Spezialanzug, der sich wie ein Chamäleon den Farben des Himmels anpasste. Er beweinte sein eigenes Schicksal und das der Frauen: sie wurden Witwen und sohneslos. In iranischer Gefangenschaft wurde er als verkleideter Imam mit dem Kampfruf „Die Seele des Imam Hussein ist mit Euch“ missbraucht. Bei seiner Rückkehr hatte er Angst vor den Winden und der Weite des Himmels und verkroch sich mit seinen Neffen Salar und Smail in den Höhlen eines verlassenen Dorfes.
Djamschids Abenteuer in der Liebe, bei den Peschmerga, als Gottesprediger, als Flüchtlingshelfer und als Zirkusattraktion, immer verbunden mit einem totalen Gedächtnisverlust inspirierten seinen Neffen Salar dazu, dem Gedächtnis seines Onkels ein Schnippchen zu schlagen und seine Lebensgeschichte auf seine pergamentene Haut tätowieren. Buchstabe für Buchstabe, Satz für Satz, so dass er aussah wie eine mesopotamische Schrifttafel. Djamschid sehnte sich an einen Ort ohne Wiederkehr und ohne verwe-hende Winde. Nach Jahren erhielt Salar ein blaues Kuvert mit einem Dankesbrief für die langjährigen Dienste, die er ihm treu gedient hatte und mit Fotos, die einen rundlichen Mann im Bambushain zeigten.
Und Salar begann Djamschids Geschichte aufzuschreiben. Eine Geschichte vom Sichtreibenlassen und Getriebenwerden und von der alten Mär „´Jeder ist seines Glückes Schmied“. Eine Geschichte mit einem runden Ende.
.
Was Bachtyar Ali hier erzählt, ist ein Potpourri an Einfällen, ist fast eine monomythische Heldenreise und hat auch etwas vom „Ritter von der traurigen Gestalt“, auch wenn Djamschid nicht gegen Windmühlenflügel kämpft, so doch gegen ein vom Winde verwehtes Schicksal. Und natürlich erinnert es nicht mehr ganz junge Deutsche an die „Geschichte vom Fliegenden Robert“ aus dem Struwwelpeter von Heinrich Hoffmann.
Für mich ist das fliegende und wehende Narrativ des Djamschid wie ein magisches Collier, wie ein kurioser Reigen, die die eigene Phantasie anregen und träumen lassen. Was wäre wenn….Und ist das nicht eine der Aufgaben der Literatur? Zum Vordenken, zum Nachdenken, zum Querdenken anzuregen?
Das ist Bachtyar Ali auf meisterliche Weise gelungen und ihm gebührt mein innigster Dank.