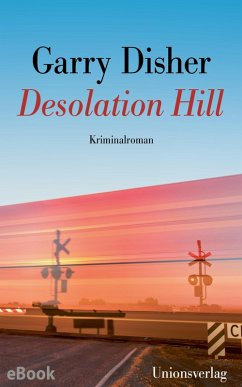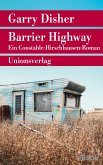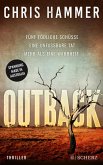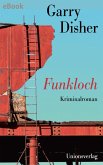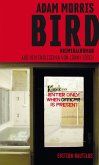3,5 (aufgerundet)
In „Desolation Hill“, dem vierten Band der Hirschhausen Reihe, sitzen wir einmal mehr auf dem Beifahrersitz des klapprigen Hilux und begleiten „Hirsch“ auf den Patrouillenfahrten durch seinen dünnbesiedelten Zuständigkeitsbereich im australischen Weizen- und Wollland. Die Fälle,
um die sich der in Ungnade gefallene Senior Constable kümmern muss, sind üblicherweise auf den…mehr3,5 (aufgerundet)
In „Desolation Hill“, dem vierten Band der Hirschhausen Reihe, sitzen wir einmal mehr auf dem Beifahrersitz des klapprigen Hilux und begleiten „Hirsch“ auf den Patrouillenfahrten durch seinen dünnbesiedelten Zuständigkeitsbereich im australischen Weizen- und Wollland. Die Fälle, um die sich der in Ungnade gefallene Senior Constable kümmern muss, sind üblicherweise auf den ersten Blick unspektakulär. Ein erschossener Schafbock, Online Mobbing, gefakte Sperrmüllsammlungen, das in den Boden gefräste Symbol der Ureinwohner, die schießwütige Frau eines Großgrundbesitzers und freilaufende Hunde. Doch dann ist da noch das verschwundene Backpackerpärchen und die Leiche mit ungeklärter Identität im Koffer. Wie wir es von Disher kennen, werden sich im Lauf der Story Zusammenhänge ergeben, Verbindungen sichtbar werden.
So weit, so gut und so erwartet. Zwei Dinge haben mich diesmal allerdings massiv gestört. Da ist der erhobene Zeigefinger, der immer wieder zwischen den Zeilen zum 1.) Thema Corona aufgetaucht ist. Desolation Hill (= Originaltitel Day’s End) ist 2023 erschienen, also zu einem Zeitpunkt, in dem das Thema Corona in aller Munde war. Und dass die Australier besonders rigide mit Lockdowns sowie Masken- und Impfpflicht waren, drang auch bis zu uns durch. Disher war wohl von den Maßnahmen überzeugt, lässt Hirsch zum Sprachrohr der offiziellen Linie werden und bezeichnet diejenigen, die den offiziellen Verlautbarungen misstrauen, als Covidioten. Zur Handlung tragen diese Bemerkung allerdings überhaupt nichts bei. 2.) Ähnlich ist es mit diesem Adlersymbol. Natürlich gilt es die Kultur der Ureinwohner zu respektieren, in diesem Punkt sind wir uns alle einig, aber muss die Thematik der kulturellen Aneignung hier auch untergebracht werden? Und 3.) war es wirklich notwendig, die Story mit diesem Showdown abzuschließen, der eher an eine amerikanische Actionserie erinnert und so überhaupt nicht zur Stimmung des Buches passt?
Der zweite Punkt ist die Übersetzung, die stark von dem abweicht, was man von Peter Torberg üblicherweise gewohnt ist. Beispiele gefällig? Was ist „ein besiegt wirkendes schmiedeisernes Tor“? Was sind „Schrumpffolienschenkel“? Und wie „installiert“ man sich auf den Rücksitz? Tut mir leid, aber das klingt noch nicht einmal wörtlich übersetzt, sondern wirkt einfach nur unpassend und schludrig.
Es kann nur besser werden, denn auch wenn das Buch mit Sicherheit auf den vorderen Plätzen der Krimibestenliste auftauchen wird, fällt es meiner Meinung nach im Vergleich mit den Vorgängern deutlich ab, wirkt zumindest im letzten Drittel lieblos zusammengeschustert, eher so, als hätte sich der Autor mangels eigenen Ideen an Schlagzeilen entlang gehangelt. Schade.