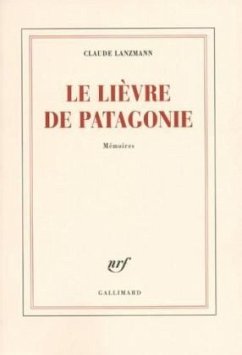"Quand venait l'heure de nous coucher et de nous mettre en pyjama, notre père restait près de nous et nous apprenait à disposer nos vêtements dans l'ordre très exact du rhabillage. Il nous avertissait, nous savions que la cloche de la porte extérieure nous réveillerait en plein sommeil et que nous aurions à fuir, comme si la Gestapo surgissait. 'Votre temps sera chronométré', disait-il, nous ne prîmes pas très longtemps la chose pour un jeu. C'était une cloche au timbre puissant et clair, actionnée par une chaîne. Et soudain, cet inoubliable carillon impérieux de l'aube, les allers-retours du battant de la cloche sur ses parois marquant sans équivoque qu'on ne sonnait pas dans l'attente polie d'une ouverture, mais pour annoncer une brutale effraction. Sursaut du réveil, l'un de nous secouait notre petite soeur lourdement endormie, nous nous vêtions dans le noir, à grande vitesse, avec des gestes de plus en plus mécanisés au fil des progrès de l'entraînement, dévalions les deux étages, sans un bruit et dans l'obscurité totale, ouvrions comme par magie la porte de la cour et foncions vers la lisière du jardin, écartions les branchages, les remettions en place après nous être glissés l'un derrière l'autre dans la protectrice anfractuosité, et attendions souffle perdu, hors d'haleine. Nous l'attendions, nous le guettions, il était lent ou rapide, cela dépendait, il faisait semblant de nous chercher et nous trouvait sans jamais faillir. À travers les branchages, nous apercevions ses bottes de SS et nous entendions sa voix angoissée de père juif : 'Vous avez bougé, vous avez fait du bruit. - Non, Papa, c'est une branche qui a craqué. - Vous avez parlé, je vous ai entendus, ils vous auraient découverts.' Cela continuait jusqu'à ce qu'il nous dise de sortir. Il ne jouait pas. Il jouait les SS et leurs chiens."
Écrits dans une prose magnifique et puissante, les Mémoires de l'auteur de la Shoah disent toute la liberté et l'horreur du XXe siècle, faisant du Lièvre de Patagonie un livre unique qui allie la pensée, la passion, la joie, la jeunesse, l'humour, le tragique.
Écrits dans une prose magnifique et puissante, les Mémoires de l'auteur de la Shoah disent toute la liberté et l'horreur du XXe siècle, faisant du Lièvre de Patagonie un livre unique qui allie la pensée, la passion, la joie, la jeunesse, l'humour, le tragique.

Claude Lanzmanns Memoiren "Le Lièvre de Patagonie" sind ein epochales Meisterwerk. Die derzeitige deutsche Debatte um ein Detail ist nur peinlich
Im November 1952 legte ein Dampfer der israelischen Reederei Zim in Haifa ab und steuerte in einen der schlimmsten Stürme, die das Mittelmeer je gekannt hat. An Bord war ein siebenundzwanzigjähriger Franzose, der als Beruf den des Journalisten angegeben hätte, obwohl er zu diesem Zeitpunkt wusste, dass er die Reportagen, die er für "Le Monde" über Israel zu schreiben hatte, nie abliefern würde: Zu intim waren seine Erfahrungen mit dem jungen Staat, das hatte in der Öffentlichkeit nichts zu suchen. Erst mal hatte er eh andere Sorgen: Das Schiff musste zehn Meter hohe Wasserwände hinauf-, dann wieder hinabfahren, das Deck wurde überspült, der Innenraum voller seekranker Passagiere war die reinste Kloake. Nur zwei Leute blieben oben, der Kapitän, ein Veteran der sowjetischen Handelsmarine, und Claude Lanzmann. Er ertrug den Gestank unter Deck nicht und überzeugte den Kapitän, ihn festzumachen - oben und ganz vorne -, auf dass er stehend und draußen die Horrorfahrt des Dampfers mitvollziehen könne: seltsame, fluchende anzugtragende Galionsfigur mit zugekniffenen Augen und nasser Kippe im Mundwinkel.
Wer sich darauf einlässt, "Le Lièvre de Patagonie", Lanzmanns Memoiren, deren Übersetzung im Herbst bei Rowohlt erscheint, zu lesen, wer diesen Dampfer besteigt, der sollte sich ebenso festmachen, denn bald ist nicht mehr zu unterscheiden, ob man die seltsamen Szenen, die hier geschildert werden, aus der Lektüre oder eigenen Träumen kennt. "Der patagonische Hase" ist kein Buch wie jedes andere. Es beschwört das vergangene Jahrhundert mit unvergleichlich suggestiver Kraft und erfrischt und verfremdet die Bilder und Begriffe, die wir so ordentlich im Kopf davon verwahren.
Da ist diese Szene im Schuhgeschäft in Paris, 1942: Die Familie Lanzmann ist unter der deutschen Besatzung dem Tode geweiht. Sie entwickelt erstaunliche Fähigkeiten, diesem Schicksal zu entkommen und sich zur Wehr zu setzen. Lanzmanns Mutter, die den Vater verlassen hat, gelingt es, sich in Paris zu verstecken, und ihrem Sohn, zu ihr zu stoßen. Doch die Bedrohung macht komplizierte Menschen nicht berechenbarer. Die Mutter befindet, der Junge sehe aus wie ein Bauerntrottel, und schleppt ihn in ein Schuhgeschäft. Dort kann sie sich nicht entscheiden, lässt sich unendlich viele Paare zeigen, dabei wird ihr Stottern immer schlimmer, dem Sohn ist die Szene unendlich peinlich. Er findet plötzlich, seine Mutter sei allzu leicht als Jüdin zu erkennen, und fürchtet, beide könnten verhaftet werden. Er haut ab, lässt seine schwierige Mutter zwischen Pyramiden von Schuhschachteln stehen - und kann es sich bis heute nicht verzeihen. "Ist es statthaft", fragt Lanzmann "wenn die große Geschichte verrücktspielt, noch ein kompliziertes Privatleben zu pflegen?"
In der Bedrohung und Verfolgung ist der Mensch nicht irgendein opakes moralisches Subjekt, sondern gerade dann frei, unberechenbar, verletzlich und unzulänglich. Das ist keine Relativierung des Heldentums, sondern dessen Vorbedingung: Unvergesslich bleiben dem Leser jene Figuren des Buches, die in einem Jahrhundert der Extreme halbwegs Haltung bewahren, unvergesslich bleiben aber auch die Versager.
Lanzmann beschreibt nicht bloß das Jahrhundert, er verkörpert es. Die Geschichte bildet sich auf seinem gedrungenen, geschundenen Leib ab: Er erleidet spektakuläre Krankheiten, Stürze, Autounfälle, bricht sich alle Knochen, wird beschossen, getreten und entkommt dem Tod immer wieder, nur um Haaresbreite. Noch im Deutschland der siebziger und achtziger Jahre wird er von Kriegsverbrechern und Altnazis verprügelt, wenn er sie für seinen Dokumentarfilm "Shoah" aufnehmen will.
Es ist auch ein liebender und geliebter Körper: Da sind die angemessen meisterhaften Seiten über Simone de Beauvoir und Angelika Schrobsdorff, die großen Lieben des Autors, da ist aber auch die Geschichte in Nordkorea, als sich Lanzmann in eine Krankenschwester verliebt - dies allein Stoff für einen epischen Film mit zahlreichen komödiantischen Einlagen.
"Le Lièvre de Patagonie" sprengt, wie "Shoah", die Dimensionen. Jahre um Jahre hat die Fertigstellung des Manuskriptes in Anspruch genommen. Das ist wieder so eine Lektion aus Lanzmanns Leben: Die Arbeit an einem Kunstwerk lässt sich nicht schematisieren, es gibt keine Benchmarks und keine Profitabilitätsberechnungen in so einer Arbeit, in so einem Leben. In einer ängstlichen und zaudernden Gegenwart wirkt das Buch wie eine Welle ins Gesicht.
Das Buch ist auch eine philosophische Unternehmung. Es ist jenes perfekte historiographische, literarische und moralische Kunstwerk, welches die Existentialisten immer gefordert, aber selbst bislang nie hingekriegt haben. Diese 560 Seiten sind eine Reflexion über das Leben selbst. Wäre er nicht dem Hasen begegnet, hätte Lanzmann das Buch "Die Jugend der Welt" nennen wollen, einfach weil sein Zugang zur Welt so immergrün ist. "Die Zeit hat nicht aufgehört, stillzustehen", resümiert Lanzmann, der sich bis heute weigert, ein sogenanntes Alter zu haben. Jeder Tag, jedes Abenteuer ist neu und erstaunlich, das Leben des Menschen sind "Situationen", wie es auch Sartre gesehen hat, an guten Tagen jedenfalls.
Und die Ankunft dieses gewaltigen Buches wird ausgerechnet in Deutschland mit einer eines Loriotsketches würdigen Debatte um Hymnen auf das Teeservice von Emmy Göring angekündigt? Gibt es vielleicht immer so bizarre Vorboten, wenn ein großes Buch kommt?
Wenn man, wie Christian Welzbacher in der "Zeit", von der Frage, ob ein Berliner Rektor Redslob nun entlassen wurde oder ob man ihm den Vertrag nicht verlängert hat, die Gültigkeit des gesamten Buches abhängig macht, kann man keinen Schimmer haben von der Kraft und der Dimension dieses Meisterwerks. Man kann, wenn man das gesamte Buch gelesen hat, das eindeutig in der literarischen Gattung der Memoiren zu Hause ist, nicht ernsthaft nach einer Überarbeitung durch Zeithistoriker verlangen.
Das ist brandgefährlich. Alle Arbeiten Lanzmanns, von seinen Kriminalreportagen bis zu "Shoah", bestechen durch außerordentliche Präzision. Das muss so sein, denn Neonazis und Revisionisten lauern auf den geringsten seiner Fehler. In Zeiten der anonymen Kommentarfunktionen ist diese Sorgfalt noch einmal wichtiger geworden! Denn jetzt schreibt etwa ein gewisser "Tom Paine" auf Süddeutsche.de und mit Berufung auf die "Zeit": "Offensichtlich hat Lanzmann in seiner Autobiographie gelogen, da beißt die Maus keinen Faden ab." Widerlich ist dieser Typ und sein anonymes Geraune angesichts eines Werks, in dem sich der Autor so gänzlich preisgibt.
"Der patagonische Hase" wird diese Parodie einer Debatte einfach abschütteln. Uns bleibt das Fremdschämen.
NILS MINKMAR
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

Eindringlich und voller Abenteuer: Die Lebenserinnerungen des französischen Publizisten und „Shoah“-Dokumentarfilmers Claude Lanzmann
Claude Lanzmann hat stets das Abenteuer gesucht. Kein Berg war ihm zu hoch, keine See zu tief, keine Wüste zu heiß. Der Tod erscheint ihm als etwas Schreckliches, aber er fasziniert ihn auch. Für einen Mann, der vor allem aus Zufall nicht schon als Jugendlicher von den Nazis ermordet wurde, ist das ungewöhnlich. Seine Memoiren, die jetzt in deutscher Übersetzung erscheinen, zeugen von einem élan vital , der beneidenswert ist. Sie sind mit Esprit geschrieben und mit Witz. Was die Darstellung erotischer Verwicklungen angeht, sind sie für französische Verhältnisse zurückhaltend.
Lanzmann wurde 1925 geboren. Der Antisemitismus, den er als Jugendlicher in Frankreich erlebte, konnte mit dem sprichwörtlichen jüdischen Selbsthass, unter dem er damals litt, durchaus konkurrieren. Die Ehe der Eltern war nicht gut. Seine Mutter soll ausgesprochen „jüdisch“ ausgesehen haben. Außerdem war sie dick. Claude Lanzmann genierte sich für seine Mutter, „deren gewaltige Umarmungen und deren Küsse, die stärker waren als der Tod“, er ertragen musste.
1938 – damals lebte die Familie für eine Weile in Paris – sah er auf der Schule entsetzt zu, „wie ein Mitschüler, ein rothaariger Jude namens Lévy“ schwer verprügelt wurde, „sie waren zwanzig gegen einen“. Dann fiel der Blick eines Jungen auf ihn selbst. Der Junge rief: „Du bist ja auch ein kleiner Jude.“ Die Erinnerung daran, wie er auf diese Gemeinheit reagierte, hat Lanzmann viele Jahre lang verfolgt: „Statt mich auf ihn zu stürzen und ihn zu ohrfeigen, widersprach ich und leugnete es.“ Lanzmann antwortete nämlich schlicht: „Aber nein, ich bin kein Jude.“ Es sollte das letzte Mal gewesen sein, dass er sich und seine Herkunft aus Angst verleugnete. Lanzmann ist Zionist. Dass ein Israeli wie der betagte Journalist Uri Avneri, der seine Kindheit in Hannover verbrachte, die Politik der israelischen Regierung seit Jahren scharf kritisiert: dafür hat Lanzmann kein Verständnis.
Als die Deutschen und die Vichy-Regierung begannen, die Juden in Frankreich zu verfolgen, war seine Familie in Gefahr. Die Eltern hatten sich getrennt, der Vater lebte mit den drei Kindern in der Provinzstadt Brioude. Im Garten hatte er eine Höhle als Versteck eingerichtet. Nachts übte er den Ernstfall: Auf einmal gab er im Schlafzimmer Alarm, dann mussten die Kinder sich in Windeseile ankleiden und – der Vater maß die Zeit – im Versteck verschwinden. Lanzmann schreibt: „Wir hielten das nicht sehr lange für bloßes Spiel.“ Nicht ohne Stolz notiert er: „Bei der letzten Zeitmessung lagen zwischen Hochfahren aus dem Bett und dem Sich-Verstecken in der Höhle eine Minute und 29 Sekunden.“
Es war in der Tat kein Spiel. Aber Lanzmann ist ein spielerischer Mann, der sich seiner körperlichen Kraft und Ausdauer immer wieder gern versichert hat. Er war sportlich, er ist einer von der Sorte Männer, die denken, dass bei der Erschaffung der Welt die Berge eigens zu dem Zweck aufgebaut wurden, von ihnen bezwungen zu werden. Er hat selbst eine Spitfire geflogen. Dann hat er in einem israelischen Phantom-Jagdflieger „7 g“ ausgehalten, ohne in Ohnmacht zu fallen: sieben mal sein eigenes Gewicht. Er ist aus zwanzig Meter Meerestiefe gegen alle Ratschläge stracks nach oben getaucht und wunderte sich hernach, dass er aus Nase und Ohren blutete. Er hat zusammen mit Simone de Beauvoir in einem normalen Auto die Sahara durchquert: nein, das dann doch nicht, die Reise musste vorzeitig abgebrochen werden.
Wenn Lanzmann von seinen beachtlichen physischen Leistungen und Abenteuern schreibt, wirkt es jedesmal, wie wenn ein kleiner Junge ins Schwimmbecken springt und dabei ruft: Papa, Mama, schaut mal her! Alles, wo es ums Ganze geht, hat ihn immer fasziniert: „Um nichts in der Welt“, schreibt er, hätte er es als Kind verpassen wollen, wenn Hasen getötet wurden, wenn Hühnern der Hals durchgeschnitten wurde, wenn Enten geköpft wurden. Für seinen Film „Shoah“, den einzigartigen Dokumentarfilm, der neuneinhalb Stunden lang ist, hat Claude Lanzmann mit dem Friseur gesprochen, der im KZ Treblinka die Frauen vor ihrer Ermordung scheren musste. Irgendwann während des Gesprächs konnte Abraham Bomba nicht mehr, er begann zu weinen. Er sprach auf Jiddisch zu einem Freund, der zu den Dreharbeiten hinzugerufen worden war; er bat Lanzmann, er möge aufhören, ihn zu befragen.
Lanzmann beschreibt, wie die die Dreharbeiten abliefen: „Bei der 16-Millimeter-Kamera, die wir verwendeten, braucht man alle elf Minuten ein neues Magazin.“ Als er mit Bomba sprach, ließ er den Film noch vor Ablauf der möglichen elf Minuten wechseln. Hätte er das nicht getan, hätte der Kameramann Abraham Bombas Tränen nicht aufnehmen können. Als der Film nach zwölf Jahren fertig war – die Finanzierung war eine Riesenschwierigkeit –, wurde Lanzmann vorgehalten, er habe Bomba sadistisch gequält. Nein, schreibt Lanzmann, der Wahrheit zuliebe habe er Bombas Tränen filmen müssen. Zum Andenken an die Toten dürfe man sich „angesichts des Schmerzes“ eines Überlebenden nicht „wie auf Zehenspitzen“ davonschleichen.
Claude Lanzmann war auch einer, der in einer Gaskammer hätte sterben können. Er wusste als Jugendlicher schon, dass er verfolgt wurde. Aber er wollte nicht nur Verfolgter sein. Er schloss sich der französischen Jugendorganisation der Kommunisten an und wurde bewaffnetes Mitglied der Résistance. Die Lebenskraft, die er seit jeher besessen hat, befähigte ihn dazu, mehr als dreißig Jahre später im Gespräch mit den Überlebenden der Lager diese Menschen dazu zu bewegen, Zeugnis abzulegen, Zeugnis vom schlimmsten, was sie gesehen hatten. Wie Lanzmann andere Episoden von „Shoah“ drehte, wie er mit versteckter Kamera bei alten Nazis aufkreuzte, wie er seine Identität dabei verleugnete, weil er anders keinen Zugang zu ihnen bekommen hätte: all das ist fesselnder Stoff.
Die Passagen über die Dreharbeiten von „Shoah“ sind der Höhepunkt der Memoiren. Davor aber liegt Lanzmanns Leben. Er ist mitteilsam, ohne indiskret zu werden, was für einen Pariser Intellektuellen ungewöhnlich ist. Umso amüsanter ist sein Bericht. Lanzmann hat mehr als einmal geheiratet und hatte viele Geliebte. Er war lange Mitarbeiter und dann Leiter der Zeitschrift Les Temps Modernes, die Jean-Paul Sartre gegründet hatte. Mit Simone de Beauvoir war er jahrelang liiert: Er sei der einzige ihrer Geliebten gewesen, schreibt er, der mit ihr wie ein Ehemann gelebt habe. Zwei Jahre lang hausten sie in einer winzigen Wohnung. Deren einziges Zimmer – so schreibt der Freund der Präzision – sei 27 Quadratmeter groß gewesen. Die Beauvoir schrieb, und der jüngere Lanzmann saß an seinem kleinen Schreibtisch und tat so, als ob.
Weil Lanzmann diskret ist, erfährt man nicht, was genau ihn an Simone de Beauvoir gefesselt hat. Allerdings macht er deutlich, was ihm auf die Nerven ging: Jeder Satz, den er ihr sagte, jeder Liebesbrief, den er ihr schrieb, wurde sofort an Sartre weitergegeben. Einmal war er mit Sartre und Simone de Beauvoir zusammen in den Ferien, die sich folgendermaßen gestalteten: Einen Tag aß er mit der geliebten Frau, am nächsten Tag war es Sartre. Der jeweils Zurückgelassene musste seine Mahlzeit am Nebentisch allein einnehmen und durfte sich derweil ausmalen, was über ihn erzählt wurde. Diese Konstellation dürfte beide Männer zu intellektuellen Höchstleistungen in der Konversation beflügelt haben.
Zur gleichen Zeit hatte Lanzmanns Schwester Evelyne eine Beziehung mit Jean-Paul Sartre. Sie war Schauspielerin, der Philosoph Gilles Deleuze hatte sie sitzen lassen. Sartre fand die schöne Frau anziehend. Sie war aber für ihn nur eine Nebenfrau und hat das Verhältnis dann beendet. Man kann sich vorstellen, dass ganz Paris sich über diese Menage das Maul zerrissen hat. Das ist viele Jahre her. Lanzmanns Schwester hat sich später umgebracht.
Jetzt, da er alt ist, ist Claude Lanzmann vom Tod umfangen: Der Tod drohte in seiner Jugend, er war das Thema von „Shoah“, er begegnete Lanzmann allenthalben. Der Tod ist eine Größe, die er achtet, mit der er aber auch kokettiert. Als er für „Shoah“ Überlebende interviewte, brachte er diese Menschen dazu, nicht von sich, sondern von den Toten zu reden. Der Titel seiner Memoiren – „Der patagonische Hase“ – ist eine Reverenz an die Überlebenden. Es geht da um einen Hasen, der unter einem Stacheldrahtzaun hindurch ins Freie gelangt. Lanzmann ist in diesem Sinn kein Hase. Ein Angsthase ist er schon gar nicht. Seine Memoiren sind ehrlich, auch das macht sie schön. FRANZISKA AUGSTEIN
CLAUDE LANZMANN: Der patagonische Hase. Erinnerungen. Aus dem Französischen von B. Heber-Schärer, E. W. Skwara und C. Steinitz. Rowohlt Verlag, Reinbek 2010. 688 Seiten, 24,95 Euro.
Er ist ein Mann
voller Kraft. Er wollte nicht
nur ein Verfolgter sein.
Jeder Liebesbrief, den er an
Simone de Beauvoir schrieb, wurde
sofort an Sartre weitergegeben
Claude Lanzmann, Jahrgang 1925, gab die von Jean-Paul Sartre gegründete Zeitschrift Les Temps Modernes heraus. Weltweit bekannt wurde er für den großen Dokumentarfilm „Shoah“ (1985). Foto: Basso Cannarsa/Opale
SZdigital: Alle Rechte vorbehalten - Süddeutsche Zeitung GmbH, München
Jegliche Veröffentlichung exklusiv über www.sz-content.de