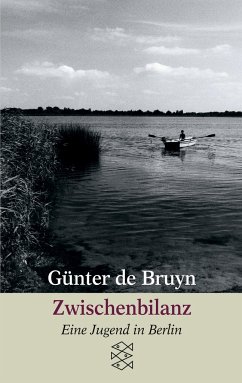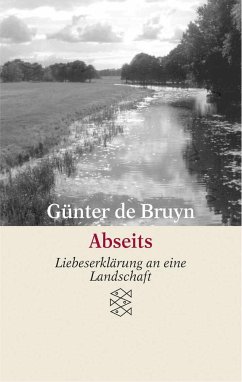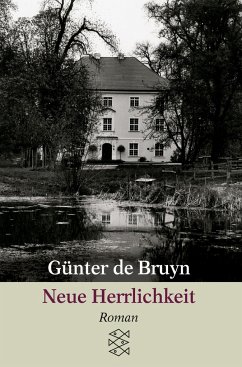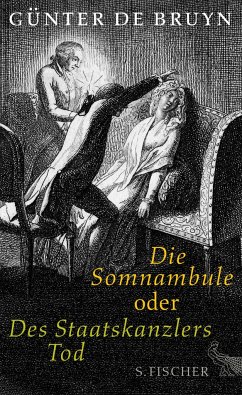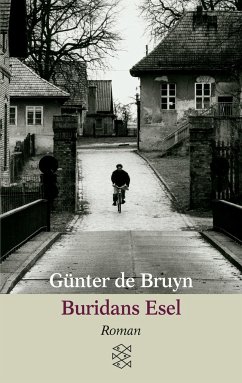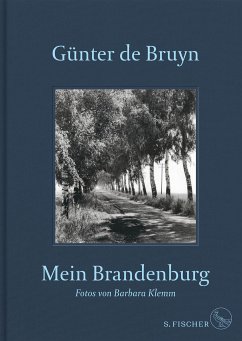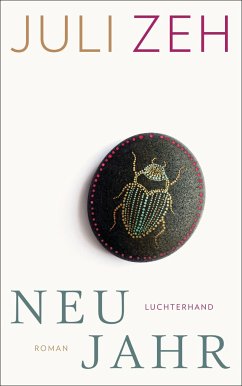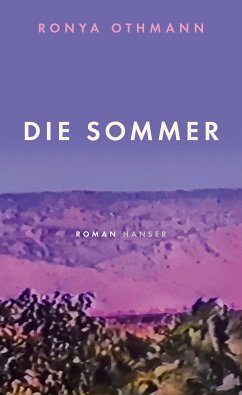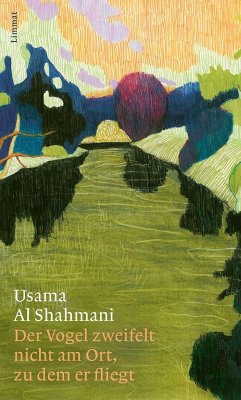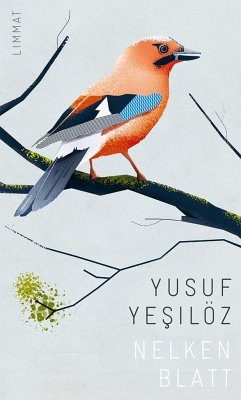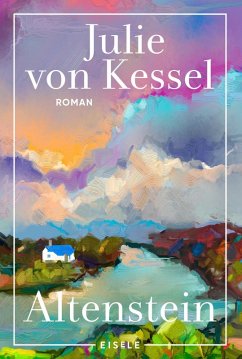Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!





Eine Geschichte aus der deutschen GegenwartWittenhagen in Brandenburg: Hedwig Leydenfrost lebt zusammen mit ihrem Bruder Leonhardt, einem pensionierten Bibliothekar, im Dorf ihrer Kindheit. Die Familie will im kommenden Sommer Hedwigs neunzigsten Geburtstag feiern und das Fest mit einer Spendenaktion für Flüchtlinge verbinden. Es ist das Jahr, in dem die Kanzlerin sagt: »Wir schaffen das.« Die Monate vergehen, es wird Winter und bitterkalt in der märkischen Provinz. Auf Eis und Schnee folgt die Schlehen- und Apfelblüte. Die Jahreszeiten wechseln sich ab, das große Fest für Hedwig Leyde...
Eine Geschichte aus der deutschen Gegenwart
Wittenhagen in Brandenburg: Hedwig Leydenfrost lebt zusammen mit ihrem Bruder Leonhardt, einem pensionierten Bibliothekar, im Dorf ihrer Kindheit. Die Familie will im kommenden Sommer Hedwigs neunzigsten Geburtstag feiern und das Fest mit einer Spendenaktion für Flüchtlinge verbinden. Es ist das Jahr, in dem die Kanzlerin sagt: »Wir schaffen das.« Die Monate vergehen, es wird Winter und bitterkalt in der märkischen Provinz. Auf Eis und Schnee folgt die Schlehen- und Apfelblüte. Die Jahreszeiten wechseln sich ab, das große Fest für Hedwig Leydenfrost rückt immer näher. Der letzte Frühling, der letzte Sommer vielleicht nach einem langen Leben ...
Erstmals seit über dreißig Jahren, nach seinen hochgelobten autobiographischen und kulturgeschichtlichen Büchern über Brandenburg und Preußen, erzählt Günter de Bruyn wieder eine Geschichte aus der deutschen Gegenwart. Es ist eine bewegende Geschichte über das Leiden an der Politik, über den Wert unserer Erinnerung und eine fremd gewordene Zeit.
Wittenhagen in Brandenburg: Hedwig Leydenfrost lebt zusammen mit ihrem Bruder Leonhardt, einem pensionierten Bibliothekar, im Dorf ihrer Kindheit. Die Familie will im kommenden Sommer Hedwigs neunzigsten Geburtstag feiern und das Fest mit einer Spendenaktion für Flüchtlinge verbinden. Es ist das Jahr, in dem die Kanzlerin sagt: »Wir schaffen das.« Die Monate vergehen, es wird Winter und bitterkalt in der märkischen Provinz. Auf Eis und Schnee folgt die Schlehen- und Apfelblüte. Die Jahreszeiten wechseln sich ab, das große Fest für Hedwig Leydenfrost rückt immer näher. Der letzte Frühling, der letzte Sommer vielleicht nach einem langen Leben ...
Erstmals seit über dreißig Jahren, nach seinen hochgelobten autobiographischen und kulturgeschichtlichen Büchern über Brandenburg und Preußen, erzählt Günter de Bruyn wieder eine Geschichte aus der deutschen Gegenwart. Es ist eine bewegende Geschichte über das Leiden an der Politik, über den Wert unserer Erinnerung und eine fremd gewordene Zeit.
Günter de Bruyn wurde am 1. November 1926 in Berlin geboren und lebte seit 1969 im brandenburgischen Görsdorf bei Beeskow als freier Schriftsteller. Er wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, u.a. dem Heinrich-Böll-Preis, dem Thomas-Mann-Preis, dem Nationalpreis der Deutschen Nationalstiftung, dem Eichendorff-Literaturpreis und dem Johann-Heinrich-Merck-Preis. Zu seinen bedeutendsten Werken gehören u.a. die beiden kulturgeschichtlichen Essays 'Als Poesie gut' und 'Die Zeit der schweren Not', die autobiographischen Bände 'Zwischenbilanz' und 'Vierzig Jahre' sowie die Romane 'Buridans Esel' und 'Neue Herrlichkeit'. Zuletzt erschien bei S. Fischer der Titel 'Der neunzigste Geburtstag' (2018). Günter de Bruyn starb am 4. Oktober 2020 in Bad Saarow.Literaturpreise:Heinrich-Mann-Preis (1964)Lion-Feuchtwanger-Preis (1982)Ehrengabe des Kulturkreises des Bundesverbandes der deutschen Industrie (1987)Thomas-Mann-Preis der Stadt Lübeck (1989)Heinrich-Böll-Preis der Stadt Köln (1990)Ehrendoktor der Universität Freiburg (1990)Großer Literaturpreis der Bayerischen Akademie der schönen Künste (1993)Literaturpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung (1996)Brandenburgischer Literaturpreis (1996)Jean-Paul-Preis (1997)Ehrendoktorwürde der Humboldt-Universität, Berlin (1998)Ernst-Robert-Curtius-Preis für Essayistik (2000)Friedrich-Schiedel-Literaturpreis (2000)Nationalpreis der Deutschen Nationalstiftung (2002)Jacob-Grimm-Preis für Deutsche Sprache (2006)Hanns Martin Schleyer-Preis (2007)Hoffmann-von-Fallersleben-Preis (2008)Preis für deutsche und europäische Verständigung der Deutschen Gesellschaft e.V. (2010)Johann-Heinrich-Merck-Preis für literarische Kritik und Essay (2011)
Produktdetails
- Verlag: S. Fischer Verlag GmbH
- Artikelnr. des Verlages: 1023231
- 6. Aufl.
- Seitenzahl: 272
- Erscheinungstermin: 26. September 2018
- Deutsch
- Abmessung: 211mm x 131mm x 27mm
- Gewicht: 398g
- ISBN-13: 9783103973907
- ISBN-10: 310397390X
- Artikelnr.: 52461229
Herstellerkennzeichnung
FISCHER, S.
Hedderichstraße 114
60596 Frankfurt
produktsicherheit@fischerverlage.de
In seinem ersten Roman seit über 30 Jahren erzählt Günter de Bruyn warmherzig und mit stiller Ironie von den Problemen unserer Gegenwart Dietmar Jacobsen Literaturkritik 20181206
«Wir schaffen das»
Als 92jähriger Schriftsteller mit einem beachtlichen Œuvre hat Günter de Bruyn nach 35 Jahren erstmals wieder einen Roman veröffentlicht, dessen symptomatischer Titel «Der neunzigste Geburtstag» die autobiografische Färbung …
Mehr
«Wir schaffen das»
Als 92jähriger Schriftsteller mit einem beachtlichen Œuvre hat Günter de Bruyn nach 35 Jahren erstmals wieder einen Roman veröffentlicht, dessen symptomatischer Titel «Der neunzigste Geburtstag» die autobiografische Färbung offensichtlich werden lässt. Zeitlich im Jetzt angesiedelt und örtlich in Wittenhagen, einem winzigen Dorf in Mecklenburg-Vorpommern mit gerade mal zweihundert Einwohnern, erzählt der Autor darin vordergründig von den Vorbereitungen zu einem hohen Geburtstag, im Wesentlichen aber von den Befindlichkeiten eines hoch betagten Geschwisterpaars im Rückblick auf ihr Leben.
Hedwig und Leonhardt Leydenfrost haben nach dem Mauerfall das ehemalige Gut der Familie als gemeinsamen Alterssitz bezogen, das inzwischen heruntergekommene Herrenhaus gehört ihnen je zur Hälfte, Hedy wohnt im ersten Stock, Leo bewohnt das Erdgeschoss. Bei Hedys 89tem Geburtstag beschließt der Familienrat, zu ihrem Neunzigsten ein großes Fest zu feiern, statt Geschenken sollen dabei aber Spenden für die Einrichtung eines Lagers für alleinstehende Flüchtlingskinder in der alten Reithalle des Gutes eingesammelt werden, Hedy ist Feuer und Flamme für diesen Plan. Sie war als ehemalige grüne Aktivistin in Westdeutschland eine politische Wortführerin der außerparlamentarischen Opposition, später hat sie dann dort Medizin studiert und als Ärztin gearbeitet. Der eher bedächtige, unpolitische Leo ist im Osten geblieben und hat sich als Bibliothekar in Ostberlin hinter seinen Büchern verschanzt, eine Berufswahl, mit der er bewusst allen Querelen von vornherein aus dem Weg ging, denn mit dem DDR-Regime war er keineswegs d’accord. Auch die Geschwister sind sich selten einig, zu verschieden ist ihr Temperament, und so ist ihr Zusammenleben bei aller gegenseitigen Achtung von häufigen Wortgefechten geprägt.
In einem entfernt an Fontane erinnernden, ruhigen Erzählfluss mit einer betulichen Diktion wird vor dem Hintergrund der aktuellen politischen Ereignisse über zwei Charaktere berichtet, deren Intellekt in unterschiedlichen Geisteshaltungen mündet, die nun im hohen Alter immer mehr in ein Staunen übergehen angesichts einer ihnen unverständlicher werdenden Welt, - vor der sie jedoch keinesfalls zu kapitulieren gedenken. In vielen Rückblenden wird ihr Lebensweg verdeutlicht, und damit wird auch ihre gegenwärtige Verfasstheit erklärt. Wunderbar stimmig ist dabei der alte Eigenbrödler Leo gezeichnet, ein der deutschen Sprache verpflichteter Schöngeist mit ausgeprägtem historischen Gespür und herrlich sarkastischer Gegenwartskritik. Insbesondere die Absurdität einer gendergerechten Sprache bringt ihn in Wallung, und ausufernde Telefonitis wird äußerst skeptisch kommentiert: «Dauertelefonierer waren in seinen Augen Kranke, die an erhöhtem Mitteilungsbedürfnis litten». Und so sorgt der alte Nörgler, hinter dem sich in Vielem wohl auch der Autor selbst versteckt, häufig für ein Schmunzeln beim Leser.
Die vielen Fragen, die Günter de Bruyn in seinem Roman anreißt, kreisen allesamt um den Generationenkonflikt, um politische und wirtschaftliche Umbrüche, um das Verdängen des Alten und Bewährten durch das Neue und oftmals Fragwürdige, wie es die beiden greisen Idealisten sehen. Dem «Wir schaffen das» einer 2015 auf politischer Geisterfahrt befindlichen Kanzlerin nacheifernd, scheitert die idealistisch betriebene Gründung einer Flüchtlings-Unterkunft für Kinder kläglich. Die Berliner «Asylantenkinder», in Wirklichkeit allesamt Testosteron gesteuerte junge Männer, weigern sich schlicht und ergreifend, in den Bus nach Meckpomm zu steigen, ins Nirwana aus ihrer Sicht. Letztendlich entsteht eine von alten Seilschaften betriebene Wellness-Oase aus der ehemaligen Reithalle der Familie, eine herbe Niederlage für den dörflichen Gemeinsinn. Mit hintersinniger Ironie entwirft Günter de Bruyn ein Bild unserer Gegenwart, dessen Plausibilität kaum zu leugnen ist und das durchaus wehmütig machen kann, in jedem Fall aber nachdenklich.
Weniger
Antworten 2 von 2 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 2 von 2 finden diese Rezension hilfreich
Der Ost-Motzki
Manchmal frage ich mich, warum ich überhaupt dieses Buch gelesen habe und nicht ein anderes. Mir gefiel wohl die Behandlung aktueller Politik, allerdings aus Ostdeutscher Sicht. Dies muss kein Nachteil sein, aber nach Lektüre des Buches wird doch klar, warum die AFD ein …
Mehr
Der Ost-Motzki
Manchmal frage ich mich, warum ich überhaupt dieses Buch gelesen habe und nicht ein anderes. Mir gefiel wohl die Behandlung aktueller Politik, allerdings aus Ostdeutscher Sicht. Dies muss kein Nachteil sein, aber nach Lektüre des Buches wird doch klar, warum die AFD ein vorwiegend ostdeutsches Problem ist.
Hedwig Leydenfrost feiert am 5.8. 2016 ihren 90. Geburtstag. Ein Jahr vorher beginnen die Planungen, also ob ein Fest gefeiert werden soll oder nicht. Sie selbst ist kinderlos hat aber Fatima, ein bosnisches Flüchtlingskind aufgenommen. Aus ihrem Leben erfahren wir, dass sie in Westdeutschland gelebt, der Friedens- und Umweltbewegung nahe stand und in der zugehörigen Partei war (die Grünen werden nicht genannt). So passt es auch, dass sie mit Aktion neue Heimat Flüchtlingskinder unterstützen will.
Ihr jüngerer Bruder Leo, wir wissen nicht genau wie alt er ist, aber über 80 wird auch er sein, dagegen blieb in der DDR, wollte nicht in die Partei eintreten, lernte seine Frau Maria kennen, die früh starb, hat aber 2 Töchter und einen Sohn, der bei der Stasi arbeitete, trotzdem oder deswegen auch nach der Wende Karriere gemacht hat, aber jeden Kontakt mit den Vater abgebrochen hat.
Während seine Familienbeziehung noch interessant ist, kann ich den vielen Dorfbewohnern, die auch wie bei Hansens „Mittagsstunde“ zeigen, dass sich das Leben auf dem Dorf wandelt, nicht viel abgewinnen. Ich glaube, es ist auch nicht so gedacht, dass alle Personen zu behalten sind.
In einer Szene wird die Zusammenlegung der Friedhöfe behandelt, was mir sehr gut gefallen hat. Weniger gefällt mir die seitenlange Ablehnung einer Gender gerechten Sprache. Die Pfarrerin muss gleich 3 Gemeinde versorgen und wird von Leo ebenfalls kritisiert. Dass sie sich letztlich mit Fatima auf eine lesbische Beziehung einlässt, darf man wohl so lesen.
Die Behandlung der „Willkommenskultur“ bringt substantiell nichts Neues. Einzig dass das Dorf von Flüchtlingskindern, - und damit auch von fremdenfeindlichen Anschlägen verschont bleibt, wie ich beim Lesen schon befürchtet und Streit unter den Dorfbewohnern vermutete, all das kommt nicht, weil gar keine Flüchtlinge ins Dorf wollen. Das ist eine interessante und nicht vorhersehbare Wendung.
Mir ist das Buch zu bieder erzählt. In Menasses „die Hauptstadt“ wird satirisch Auschwitz als Hauptstadt vorgeschlagen. Produktive, neue politische Ideen fehlen hier, nur dem Motzen wird Raum gegeben. Auch der Verlauf der Geburtstagsfeier wird im Grunde vorher schon verraten, von mir aber nicht. Man kann dieses Buch lesen, muss es aber nicht. 3 Sterne.
Weniger
Antworten 2 von 5 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 2 von 5 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für