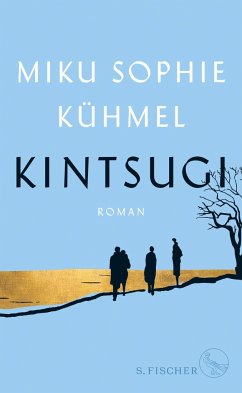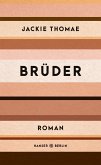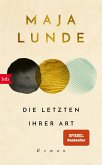Ausgezeichnet mit dem Literaturpreis der Jürgen Ponto-Stiftung und dem aspekte-Literaturpreis für das beste deutschsprachige Prosa-Debüt 2019
Kintsugi ist das japanische Kunsthandwerk, zerbrochenes Porzellan mit Gold zu kitten. Diese Tradition lehrt, dass Schönheit nicht in der Perfektion zu finden ist, sondern im guten Umgang mit den Brüchen und Versehrtheiten.
Es ist Wochenende. Wir sind in einem Haus an einem spätwinterlichen See, das Licht ist hart, die Luft ist schneidend kalt, der gefrorene Boden knirscht unter unseren Füßen. Gerade sind Reik und Max angekommen, sie feiern ihre Liebe, die nun zwanzig ist. Eingeladen sind nur ihr ältester Freund Tonio und seine Tochter Pega, so alt wie die Beziehung von Max und Reik. Sie planen ein ruhiges Wochenende. Doch ruhig bleibt nur der See.
»Kintsugi« ist ein flimmernder Roman über die Liebe in all ihren Facetten. Über den Trost, den wir im Unvollkommenen finden. Und darüber, dass es weitergeht. Wie immer geht es weiter.
Kintsugi ist das japanische Kunsthandwerk, zerbrochenes Porzellan mit Gold zu kitten. Diese Tradition lehrt, dass Schönheit nicht in der Perfektion zu finden ist, sondern im guten Umgang mit den Brüchen und Versehrtheiten.
Es ist Wochenende. Wir sind in einem Haus an einem spätwinterlichen See, das Licht ist hart, die Luft ist schneidend kalt, der gefrorene Boden knirscht unter unseren Füßen. Gerade sind Reik und Max angekommen, sie feiern ihre Liebe, die nun zwanzig ist. Eingeladen sind nur ihr ältester Freund Tonio und seine Tochter Pega, so alt wie die Beziehung von Max und Reik. Sie planen ein ruhiges Wochenende. Doch ruhig bleibt nur der See.
»Kintsugi« ist ein flimmernder Roman über die Liebe in all ihren Facetten. Über den Trost, den wir im Unvollkommenen finden. Und darüber, dass es weitergeht. Wie immer geht es weiter.

Vom Reparieren der Liebe in unterschiedlichsten Formen: Miku Sophie Kühmels für den Deutschen Buchpreis nominierter Roman "Kintsugi"
Die Scherbe zählt schon immer zu den semiotisch interessantesten Phänomenen des menschlichen Alltags. Selbst dort, wo sie vereinzelt auftritt, bedeutet sie uns, dass es noch mindestens ein anderes von ihr geben müsse. Scherben sind ein Versprechen auf Zweiheit, auf das Komplementäre, sind - um vielleicht allzu didaktisch zu werden - das Symbol aller Symbolik. Wenn Max, Juniorprofessor für Archäologie an einer Berliner Universität und einer der Protagonisten in Miku Sophie Kühmels Debütroman "Kintsugi", seinen Studierenden in einer etwas archaisch anmutenden Vorlesungsszene eine zwei Zentimeter breite Tonscherbe als den einzigen Lohn ihrer harten Arbeit anpreist, dann verbirgt sich dahinter folglich mehr als das teutonische Pathos philosophischer Fakultäten. Wer der Scherbe dient, der glaubt daran, dass es Entsprechungen in dieser Welt gibt, ein Ganzes, von dem er oder sie selbst nur ein Teil ist. So erzählt man Liebe.
Kühmels Roman, sowohl für den Deutschen Buchpreis nominiert als auch der wohl heißeste Anwärter für den Aspekte-Literaturpreis, lebt vom Spiel mit den Scherben. Heimlich, ohne es zu ahnen, sind seine vier Figuren verbunden durch eine japanische Teetasse, die immer wieder von neuem zu Bruch geht und immer wieder von neuem - aber immer durch jemand anderen - zusammengeklebt wird. Die Liebenden einen die Risse, die sie voreinander verheimlichen, die sich aber durch ihr aller Leben ziehen, in feinen Verästelungen noch die Zimmerdecke des Wochenendhauses verzieren, unter der sie sich begegnen. "Sie", das sind Max und sein Lebensgefährte Reik - ein gut gehandelter Künstler -, Reiks erste Liebe Tonio sowie Tonios Tochter Pega. Jede dieser Figuren darf einmal vom Leben in der Scherbenwelt erzählen, und es versteht sich von selbst, dass es dabei stets um Vertrauen und Misstrauen gehen wird, um die stillen, kaum wahrnehmbaren Übergänge von Freundschaft und Leidenschaft, um Eifersucht - und Lust.
Kühmels Wahlverwandte lieben und leiden freilich meist im Stillen. Wohl erspüren sie, dass die Dinge im Schwange sind, dass sich alte Empfindungen nicht ohne weiteres nach neuen Realitäten richten, dass aus Vätern wieder Liebhaber werden könnten und aus einer gemeinsamen Ziehtochter wiederum die Geliebte eines der Väter. Aber eben: Diese Menschen verharren auf der Schwelle, sie sprechen von den Möglichkeiten zwischen ihnen, aber sie leben sie nicht. Stattdessen richtet sich die Aufmerksamkeit auf all das, was ohnehin nie ganz glatt war: Die Vita, die abwesenden Väter, die Mütter - entweder in Sucht oder Selbstverwirklichung aufgegangen -, die Deformationen, aus denen heraus man in Beziehungen stolpert oder die man in die Beziehungen mit hinübernimmt.
"Kintsugi" nimmt sich viel, sehr viel Zeit für diese bisweilen redundanten Erzählungen. Originalität ist hier freilich nicht das Gesuchte, geht es doch um Strukturen: Wie sich in der Teetasse noch vor ihrem Zerbrechen "ein Geflecht der kleinen Versehrtheiten" findet, "das sich mit jedem Aufguss vertieft", so speisen sich auch die Verhältnisse zwischen den Menschen aus ihren Verwundungen, mit denen sie nach und nach verwachsen. Wer keine Liebe kennt, der entwickelt dann - wie Reik - eine "Sucht danach, geliebt zu werden", die zwangsläufig größer wird als die Liebe, die er zu geben hat. Mit den erwartbaren promiskuitiven Folgen.
Die Gesetze, die dieser Roman etabliert, sind zweifelsohne psychologistischer Herkunft. Das ist nicht zwangsläufig von Vorteil, denn ebendieser Psychologismus verantwortet nicht nur eine Reihe bisweilen etwas bemühte Topflappensentenzen à la "Hilflosigkeit verdoppelt sich, wenn man sie nicht teilen kann" oder "Ihr gönnt euch einfach selbst nicht glücklich zu sein", sondern auch eine seltsam klischierte und in ihrer Unterkomplexität mit den Charakteren kaum zu vereinbarende Vater-Tochter-Beziehung. (Diese gipfelt im gebrüllten Verdikt "Du hast keinen Sex", das sich wiederum auf die Feststellung "Du bist meine Tochter!" gründet - da braucht es nun wirklich keinen Familientherapeuten mehr.) Zu bedauern ist dies nicht zuletzt, weil es Kühmel durchaus vermag, ihre vier Erzählstimmen über längere Strecken stimmig zu konturieren, ein eigenes Vokabular, einen spezifischen Redestil und im Falle von Pega sogar deutlich erkennbare Schwächen im Bezug auf grammatikalisch korrekte Satzanschlüsse zu verleihen.
Warum aber wird gerade einem solchen Text, der sich weniger darüber definiert, was geschieht - nach zwanzig Jahren trennt sich das Paar Max und Reik feierlich -, als vielmehr darüber, wie er das Ungeschehene inszeniert, eine dermaßen große Aufmerksamkeit zuteil? Vordergründig zielen die Kommentare auf den Aspekt der Diversität, auf die Selbstverständlichkeit, mit der hier Homo-, Bi- und Heterosexualität generationsübergreifend wie nebeneinander auf engstem Raum gelebt und beschrieben werden. Freilich täte man dem Roman schweres Unrecht, würde man ihn simplistisch auf die Thesenhaftigkeit seiner Figurenkonstellation, das "Aufwachsen mit drei Außenseitern" reduzieren wollen. Tatsächlich materialisiert sich in ihm noch etwas ganz anderes, nämlich die Furcht vor den "sauberen Brüchen", der "schriftlichen Division", die Pega von ihren Vätern gelernt hat. Die Kunst des klaren Schnitts wächst bei Kühmel zu einem biographischen, wo nicht gesellschaftlichen Problem heran. Man könnte aus den hier versammelten Lebensläufen problemlos auch die Geschichte der urbanen, also mittlerweile wieder dörflich-familial organisierten Mittelschicht erzählen, die sich zwischen den Kapiteln immer wieder zu kammerspielartigen Einlagen am gemeinsamen Küchentisch versammelt und ihr Befinden aushandelt. Dass diese Gemeinschaft geschichtlich ist, dass sie einen Anfang hat und ein Ende haben könnte (von dem die Prenzlauer-Berg-Romane Anke Stellings künden), dass die kreative Ausgestaltung ihrer Individualitäten womöglich zwischen unheilbaren sozialen Brüchen eingelagert sein könnte - das sind die Urängste, die zum Frühstück und Abendessen in diesem Milieu mit am Tisch sitzen.
Im kintsugi, womit man im Japanischen "das Kunsthandwerk, zerbrochenes Porzellan mit Gold zu reparieren", bezeichnet, stellt Kühmels Liebesexperiment der aufkeimenden Katastrophik dieses Lebensgefühls nun eine Selbstvergewisserung entgegen. Wo Adorno einst erkannt hatte, dass der "Ausdruck des Geschichtlichen an Dingen . . . nichts anderes als der vergangener Qual" ist, so glänzen hier am Ende "die Splitter, die Brüche" der Teeschale, "das Gold wie Adern aus Licht", bleibt immer noch der Schein "schlichter Eleganz", der Balance, von denen sich der Scherbensucher Max "mehr Halt" in seinem Leben verspricht. Dem Arrangement mit der Lüge der Geborgenheit, der vermeintlichen Unmöglichkeit echter Schnitte und scharfer Trennungen stiftet dieser Roman ein veritables Dingsymbol, an das man natürlich allzu gerne glaubt. Bei näherer Betrachtung aber - von Tasse wie Text - bleibt dann doch zu konstatieren: So schön es auch leuchten mag - das Ganze ist das Kaputte.
PHILIPP THEISOHN
Miku Sophie Kühmel: "Kintsugi". Roman.
Verlag S. Fischer, Frankfurt am Main 2019. 304 S., geb., 21,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
In ihrem Debütroman erweist sich Miku Sophie Kühmel als großes erzählerisches Talent. Gérard Otremba Rolling Stone 20200130