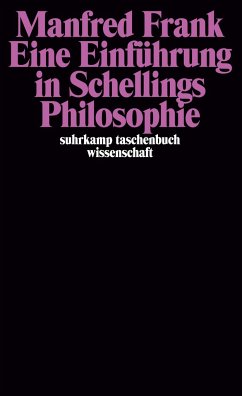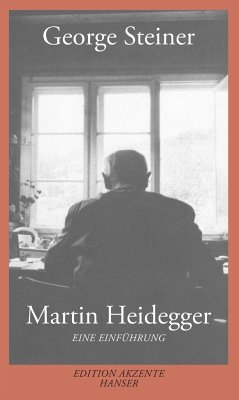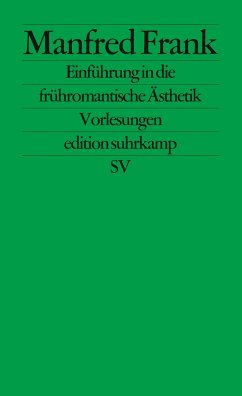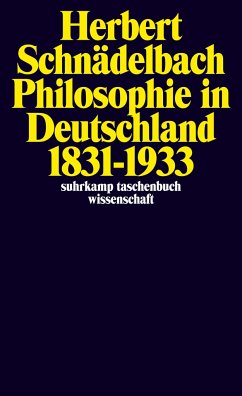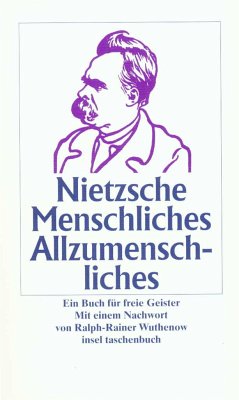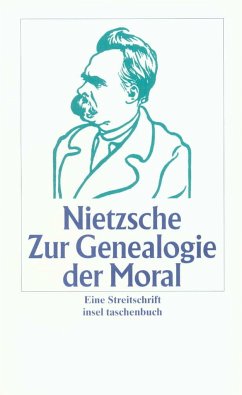' Unendliche Annäherung'
Die Anfänge der philosophischen Frühromantik
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
35,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Durch 'Sehnsucht nach dem Unendlichen' übersetzte Friedrich Schlegel das altgriechische "philosophia", etwas frei, aber sprechend: Das Unendliche ist Ziel nur unseres Sehnens, erreicht und besessen wird es nie. Ja, genau genommen darf es nur als eine Idee im kantischen Sinne gelten, deren reale Verfolgung, wie Novalis sagt,'in die Räume des Unsinns führen' würde. So tritt der Gedanke der unendlichen Annäherung an die Stelle eines evidenzgesicherten Prinzips, von dem die Philosophie entweder ihren Ausgang glaubte nehmen zu können (wie das Reinhold und wenigstens eine Weile auch Fichte ann...
Durch 'Sehnsucht nach dem Unendlichen' übersetzte Friedrich Schlegel das altgriechische "philosophia", etwas frei, aber sprechend: Das Unendliche ist Ziel nur unseres Sehnens, erreicht und besessen wird es nie. Ja, genau genommen darf es nur als eine Idee im kantischen Sinne gelten, deren reale Verfolgung, wie Novalis sagt,'in die Räume des Unsinns führen' würde. So tritt der Gedanke der unendlichen Annäherung an die Stelle eines evidenzgesicherten Prinzips, von dem die Philosophie entweder ihren Ausgang glaubte nehmen zu können (wie das Reinhold und wenigstens eine Weile auch Fichte annahmen) oder den sie doch als den Zielpunkt des ganzen Unternehmens getrost vorwegnehmen durfte (wie das Hegel unterstellte). Auf die Weise bildet die philosophierende Frühromantik - vor allem in Gestalt ihrer Hauptvertreter Novalis und Friedrich Schlegel (ähnlich aber auch bei Hölderlin und seinen Freunden) - ein merkwürdiges Hybrid zwischen orthodoxem Kantianismus, dessen Ideen-Lehre stark ausgelegt wird, und spekulativem Idealismus, dessen grundsatzphilosophische Züge skeptisch überwunden werden, noch bevor sie in Schellings und Hegels Systementwürfen zum freien Flug ansetzen. Diese Anlage hat dafür gesorgt, daß von den großen Projekten dieser Zeit - den wenigen, während deren Gedanken in deutscher Sprache europäischen Einfluß erlangten - eigentlich nur die der Frührornantik von einer skeptischen, aber auch perfektibilistisch eingestellten Moderne haben übernommen werden können. Während um Schelling und Hegel eine antiquarische Philologie sich bemüht, die aus der Asche kein Feuer mehr blasen kann, scheinen die Gedanken der Frühromantik brandaktuell geblieben. Freilich sind sie - umgekehrt proportional zu ihrem Ruhm - allererst zu entdecken. Neuere Forschungen haben zeigen können, wie wichtig für ihr Aufkommen zumal der Verfallsprozeß der Reinholdschen Grundsatzphilosophie gewesen ist. Von ihm hatten Novalis - als Reinhold-Schüler direkt oder durch seinen ehemaligen Hauslehrer Carl Christian Erhard Schmid oder seine Freunde Johann Benjamin Erhard, Franz Paul von Herbert, Friedrich Carl Forberg oder Friedrich Immanuel Niethamrner - und Friedrich Schlegel indirekt Kunde durch den antigrundsatz-philosophischen Jenaer Gesprächskontext, in den er im Winter 1796/97 geriet. Ihn rekonstruiert Franks Vorlesungsreihe ausführlich (bis hin zum Jahre 1797), zeigt, welchen Einfluß er aufs frühromantische Denken hatte, aber auch, wie originell ihn Novalis und Friedrich Schlegel zu einer eigenen Philosophie umgestalteten, die durchaus als eine skeptische Alternative zum Fichteschen Absolutismus auf unsere Sympathie hoffen darf.