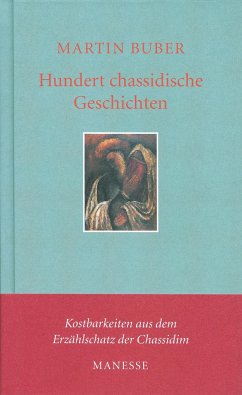100 Geschichten
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 2-4 Wochen
23,99 €
inkl. MwSt.
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
12 °P sammeln!
Zum Buchmesseschwerpunkt "Katalonien" legt die FVA unter dem Titel Hundert Geschichten erstmals alle Erzählungen des bekannten katalanischen Schriftstellers Quim Monzó in einem Band vor. Es beginnt mit seinen frühen Geschichten Uff, sagte er: Hominiden, die Katalonien entdecken, Bankräuber die im Vollrausch eine Fleischbank überfallen, Literophagen, die Spaß daran finden, Buchstaben zu verschlingen. In den folgenden Kapiteln finden wir bunte Geschichten über Beziehungsprobleme, über Irrungen und Wirrungen moderner Beziehungskisten, über die falsche Eitelkeit der Menschen, das unaufhal...
Zum Buchmesseschwerpunkt "Katalonien" legt die FVA unter dem Titel Hundert Geschichten erstmals alle Erzählungen des bekannten katalanischen Schriftstellers Quim Monzó in einem Band vor. Es beginnt mit seinen frühen Geschichten Uff, sagte er: Hominiden, die Katalonien entdecken, Bankräuber die im Vollrausch eine Fleischbank überfallen, Literophagen, die Spaß daran finden, Buchstaben zu verschlingen. In den folgenden Kapiteln finden wir bunte Geschichten über Beziehungsprobleme, über Irrungen und Wirrungen moderner Beziehungskisten, über die falsche Eitelkeit der Menschen, das unaufhaltsame Vergehen der Zeit, über fatale Mißverständnisse mit unvorhersehbaren Folgen. Geschichten über frischverliebte und erfahrenere Ehepaare, Singles, Liebe und Liebesschmerz, Glück und Eifersucht, Sex und erotische Spielerei. Humorvoll, meisterhaft, makaber, schnörkellos und präzise bringt es Quim Monzó auf seine unverwechselbare Weise auf den Punkt, geben seine "Romane in Pillenform" ein ironisch-komisches Abbild des Lebensgefühls unserer westeuropäischen Gesellschaft.
Der Leser muß mit Überraschungen rechnen: Hundert wunderbare Geschichten, die zu dem Besten gehören, was derzeit in diesem Genre geschieht. Und über allen schwebt der mehr oder minder eingestandene Wunsch nach einem großen Zusammenhang, einem Sinn dieses zerfahrenen Lebens. Denn, das scheint Monzó sagen zu wollen: Menschen treiben unbelehrbar und orientierungslos durch die Zeit und glauben an eine rote Linie, die es nicht mehr gibt, sie sind Robinsone einer nichtkommunikativen Ära.
Der Leser muß mit Überraschungen rechnen: Hundert wunderbare Geschichten, die zu dem Besten gehören, was derzeit in diesem Genre geschieht. Und über allen schwebt der mehr oder minder eingestandene Wunsch nach einem großen Zusammenhang, einem Sinn dieses zerfahrenen Lebens. Denn, das scheint Monzó sagen zu wollen: Menschen treiben unbelehrbar und orientierungslos durch die Zeit und glauben an eine rote Linie, die es nicht mehr gibt, sie sind Robinsone einer nichtkommunikativen Ära.
Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.