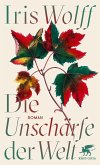»Ich habe mehr Privilegien, als je eine Person in meiner Familie hatte. Und trotzdem bin ich am Arsch. Ich werde von mehr Leuten gehasst, als meine Großmutter es sich vorstellen kann. Am Tag der Bundestagswahl versuche ich ihr mit dieser Behauptung 20 Minuten lang auszureden, eine rechte Partei zu wählen.«
Eine junge Frau besucht ein Theaterstück über die Wende und ist die einzige schwarze Zuschauerin im Publikum. Mit ihrem Freund sitzt sie an einem Badesee in Brandenburg und sieht vier Neonazis kommen. In New York erlebt sie den Wahlsieg Trumps in einem fremden Hotelzimmer. Wütend und leidenschaftlich schaut sie auf unsere sich rasant verändernde Zeit und erzählt dabei auch die Geschichte ihrer Familie: von ihrer Mutter, die Punkerin in der DDR war und nie die Freiheit hatte, von der sie geträumt hat. Von ihrer Großmutter, deren linientreues Leben ihr Wohlstand und Sicherheit brachte. Und von ihrem Zwillingsbruder, der mit siebzehn ums Leben kam. Herzergreifend, vielstimmig und mit Humor schreibt Olivia Wenzel über Herkunft und Verlust, über Lebensfreude und Einsamkeit und über die Rollen, die von der Gesellschaft einem zugewiesen werden.
Eine junge Frau besucht ein Theaterstück über die Wende und ist die einzige schwarze Zuschauerin im Publikum. Mit ihrem Freund sitzt sie an einem Badesee in Brandenburg und sieht vier Neonazis kommen. In New York erlebt sie den Wahlsieg Trumps in einem fremden Hotelzimmer. Wütend und leidenschaftlich schaut sie auf unsere sich rasant verändernde Zeit und erzählt dabei auch die Geschichte ihrer Familie: von ihrer Mutter, die Punkerin in der DDR war und nie die Freiheit hatte, von der sie geträumt hat. Von ihrer Großmutter, deren linientreues Leben ihr Wohlstand und Sicherheit brachte. Und von ihrem Zwillingsbruder, der mit siebzehn ums Leben kam. Herzergreifend, vielstimmig und mit Humor schreibt Olivia Wenzel über Herkunft und Verlust, über Lebensfreude und Einsamkeit und über die Rollen, die von der Gesellschaft einem zugewiesen werden.

Geboren in der DDR mit einem Vater aus Angola: Olivia Wenzels Debütroman "1000 Serpentinen Angst" setzt aufs Prinzip der Autofiktion.
Der Psychologe seufzt. Eigentlich, sagt er, richte sich sein Angebot an Leute, die von der Vergangenheit belastet sind. Die junge Frau, die ihm gerade ihr Herz ausgeschüttet hat, mit einiger Entschlossenheit und wachsender Verzweiflung, habe alles richtig gemacht, ihre Fragen wären im Grunde nicht therapeutisch zu klären. "Sie sind in unserem Land eben eine Minderheit."
Drei Versuche unternimmt die Ich-Erzählerin in Olivia Wenzels Debütroman "1000 Serpentinen Angst", um auf Drängen eines Freundes endlich therapeutische Hilfe zu finden. Ihrer Geschichte von Ausgrenzung, von all ihren Begegnungen mit Rat- und Ahnungslosen fügt das ein paar Anekdoten hinzu, an ihrer Notlage ändert sich erst einmal nichts: "Angst vor dem Einschlafen, obsessive Gedanken vor dem Einschlafen, Herzrasen, Schlaflosigkeit, Grübeln, Angst vorm Grübeln, Kreislaufprobleme, Angst vor der Angst, immer weniger Schlaf, schließlich Angst vor dem Einschlafen, immer mehr Angst."
Es hatte nicht erst der Unbekannte auf der Straße das Messer zwischen die Rippen bekommen müssen, mit ihr als Einziger, die sich in all der Aufregung um ihn kümmerte: Die Erzählerin bringt tatsächlich einiges mit aus der Vergangenheit. Als Tochter einer Mutter, die immer nur wegwollte, schon als Punk in der DDR, deren Ausreisegenehmigung annulliert wurde, kurz bevor sie eigentlich gehen durfte, dann "Zerbröselung der Psyche im Stasi-Knast". Als Enkelin einer Großmutter, die einst linientreue DDR-Bürgerin war, jetzt bereit ist, "eine rechte Partei zu wählen", ebenso zugewandt wie ignorant. Als Frau, deren Zwillingsbruder sich mit neunzehn vor einen Zug geworfen hat. Und als Tochter eines Mannes, dem ihre Mutter gleich nach der Geburt der Tochter, ebenfalls mit neunzehn, eigentlich hatte hinterherziehen wollen. Er hatte die DDR verlassen müssen, zurückgehen müssen nach Angola. Jetzt schickt er Geld und schreibt E-Mails, zweimal im Jahr.
Als die Erzählerin einmal dort war, in Angola, haben die Leute "Kokosnuss" zu ihr gesagt: außen braun, innen weiß. Vielleicht könnte sie sich leichter irgendwo zugehörig fühlen, wenn ihr das nicht unentwegt abgesprochen würde. Dabei ist es eine durchaus selbstbewusste Stimme, mit der Olivia Wenzel, selbst 1985 als Person of Colour in Weimar geboren, ihre Ich-Erzählerin sprechen lässt - reflektiert, bissig, klar. Autofiktion nennt die Autorin, die bislang Theaterstücke veröffentlicht hat, ihr literarisches Verfahren. Ihrer Erzählerin ist sie einiges zu geben bereit: Empfindlichkeit und Empfänglichkeit, eine Wahrnehmungsweise, einen Erfahrungsschatz mit Bedeutung weit über dieses Buch hinaus.
Über weite Teile wird die Erzählerin befragt. Fast verhört im ersten Teil, unerbittlich, penetrant, in Großbuchstaben, mit Fragen, die aus der Einreisekontrolle bei einem Flug nach New York stammen könnten, von dem sie gerade erzählt, dann wieder mit Kommentaren, die von einem Wissen um die Erzählerin künden, das große Vertrautheit voraussetzt: "Jetzt machst du wieder das Gesicht. Lass das bitte, das ist dein weißes Privilegien-Gesicht."
Olivia Wenzels Dialoge sind präzise und spitz, geschärft an Arbeiten der Autorin für die Bühne und auf der Bühne. Sie stehen förmlich im Raum. Wie genau die Sprache in "1000 Serpentinen Angst" collagiert wird, zeigt mitunter der Wechsel in einen Tonfall, mit dem im universitären Umfeld Zugehörigkeitsfragen erörtert werden: "Die Tatsache, dass Afroamerikaner an den Nachwehen der Sklaverei leiden, mittels deren sie zu maximal Anderen degradiert wurden, löst sich vielleicht nie auf", schreibt Olivia Wenzel einmal, jetzt ganz im Essayistischen.
Eine Phantasie durchzieht das Buch: im Snack-Automaten auf einem Bahnsteig Unterschlupf zu suchen, in ihm zu leben. Mal ist das Herz der Erzählerin ein solcher Automat, mal hat ihn jemand zerquetscht "wie eine überdimensionale Bierdose", und sie ist, zerbeult und nackt, auf den Gleisen gelandet. Wenn sie damals dort, an den Gleisen, geblieben wäre, bei ihrem Bruder, statt ihn auf das Gepäck aufpassen zu lassen, während sie noch schnell in der Bahnhofshalle etwas zu essen kauft?
Wie soll sie ihn verstehen? Wie ihre Mutter, ihre Großmutter, wie sich selbst, ihr Begehren mal nach Männern, mal nach Frauen, wie ihre Schwangerschaft, wie das mit Kim, die ihr in der Nacht nach der Messerstecherei gesagt hatte, sie werde immer für sie da sein und sie auch immer lieben, aber sie sei chancenlos gegen die Vergangenheit der Erzählerin? Es gibt auch Zartheit in diesem Buch, Sanftheit, die Sehnsucht nach Sanftheit.
Im letzten der drei Teile des Romans stellt sie mitunter selbst die Fragen: mit welchem Gruß sie sich von ihrer Mutter verabschiedet hat, als sie von ihr einmal zu einer der seltenen Begegnungen in einen Bungalow im Wald gelotst worden ist? Ob hinter deren Härte jemals eine glückliche Person gesteckt habe? "Woran denke ich", fragt sie einmal, "was unterschlage ich?" Therapeutisch sind solche Fragen wirklich nicht zu klären. Olivia Wenzel stellt sie, und sie stellt sie ihrer Erzählerin: literarisch souverän. Sie unterschlägt nichts, das ist der bleibende Eindruck dieses eindrucksvollen, schonungslosen, zärtlichen Romans.
FRIDTJOF KÜCHEMANN
Olivia Wenzel: "1000 Serpentinen Angst". Roman.
Verlag S. Fischer, Frankfurt am Main 2020. 352 S., geb., 21,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Für mich [...] eins der krassesten Leseerlebnisse des Jahres. [...] ganz abgesehen von der Thematik ist es in der literarischen Bauart eines der besten Bücher 2020. Deniz Ohde Deutschlandfunk Kultur 20201213