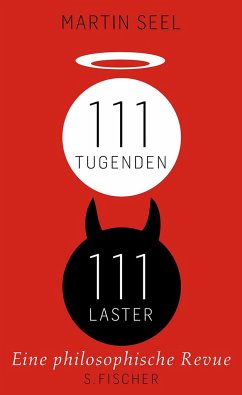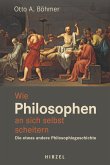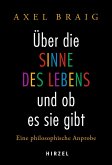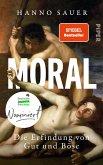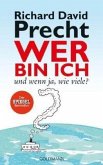»Tugenden sind Laster, die ihr Schlimmstes nicht ausleben; Laster sind Tugenden, die ihr Bestes versäumen.«
Tugenden und Laster sind sich näher, als man glaubt. Wie tanzende Paare drehen sie sich umeinander, stoßen sich ab, um sich wieder eng zu umschlingen. In ihren Bewegungen sind sie oft nicht voneinander zu unterscheiden und bringen die eigene Lebensführung ins Wanken. Wie leiten und verleiten sie uns im gegenwärtigen Handeln?
Martin Seel lässt in seiner philosophischen Revue 111 Tugenden und Laster in kurzen Skizzen auftreten und zielt auf ein genaues Verständnis ihrer internen Affären. Er versalzt den großen Vereinfachern in Moraltheorie und Lebensberatung die Suppe, indem er unterhaltsam und kunstvoll die Verästelungen menschlicher Sitten und Unsitten freilegt. Sein Ziel: Der Mensch möge sein endliches Dasein mit einem wachen Gespür für sein Bestes verbringen.
Tugenden und Laster sind sich näher, als man glaubt. Wie tanzende Paare drehen sie sich umeinander, stoßen sich ab, um sich wieder eng zu umschlingen. In ihren Bewegungen sind sie oft nicht voneinander zu unterscheiden und bringen die eigene Lebensführung ins Wanken. Wie leiten und verleiten sie uns im gegenwärtigen Handeln?
Martin Seel lässt in seiner philosophischen Revue 111 Tugenden und Laster in kurzen Skizzen auftreten und zielt auf ein genaues Verständnis ihrer internen Affären. Er versalzt den großen Vereinfachern in Moraltheorie und Lebensberatung die Suppe, indem er unterhaltsam und kunstvoll die Verästelungen menschlicher Sitten und Unsitten freilegt. Sein Ziel: Der Mensch möge sein endliches Dasein mit einem wachen Gespür für sein Bestes verbringen.

Der Tugend die Treue halten, ohne sich den Avancen des Lasters gegenüber taub zu stellen: Martin Seel führt Aristoteliker und Kantianer im guten Leben zusammen.
Woran erkennt man einen gebildeten Menschen? Die Antwort des Frankfurter Philosophen Martin Seel ist ebenso schlicht wie überzeugend. Bildung äußerst sich danach vor allem in der Fähigkeit zur Selbstdistanzierung. "Ihr zentrales Medium ist die Dialogbereitschaft. Hierzu gehört nicht allein das Vermögen, anderen zuzuhören und sich von ihnen etwas sagen zu lassen, sondern vor allem die Gabe, zusammen mit anderen die wechselseitigen Auffassungen zu variieren und zu transformieren."
Niemals von Zweifeln an der Richtigkeit der eigenen Position beschlichen zu werden ist das traurige Vorrecht der Hagenströms und ihrer heutigen universitären Nachfolger, der Drittmittelkönige. Wer jenes "emotionale wie intellektuelle Einfühlungsvermögen" besitzt, "das früher einmal auf den Namen der Herzensbildung hörte", ist dagegen in einem beständigen Unglaubensgespräch mit sich selbst begriffen. Nicht dass es ihm an Überzeugungen fehlte. Der Gebildete ist zu klug, um in die Relativismusfalle zu tappen. "An gar nichts gebunden zu sein und trotzdem im eigenen Leben einen Sinn zu finden, das geht nicht."
Aber er ist sich, wenn auch mitunter schweren Herzens, darüber im Klaren, "dass anders Denkende und Empfindende für ihre Sicht der Dinge etwas Ernstzunehmendes, wenn auch Abzulehnendes vorzubringen haben, das die Grundlagen des menschlichen Zusammenlebens nicht einfachhin und geradewegs verletzt".
Die Pflicht zur Toleranz entspringt für ihn deshalb einem Patt von Gründen und Gegengründen. "In Situationen oder bei Konflikten, in denen eine Urteilsenthaltung nicht möglich ist, erkennen wir, dass unsere Wertüberzeugungen, für die wir weiterhin einstehen, nicht so stark sind, dass wir verlangen dürften, die anderen müssten ihre Position räumen. Wir haben keinen Trumpf in der Hand."
Ebenso wie die Toleranz zeichnen sich auch zahlreiche andere Tugenden dadurch aus, dass es den mit ihnen gesegneten Menschen im Großen und Ganzen gelingt, die heikle Balance zwischen den beiden Lastern des Zuviel und des Zuwenig zu halten. "Schamhaftigkeit oder Pünktlichkeit können ebenso wie Mut oder Mäßigung von einer einerseits übertriebenen und andererseits untertriebenen Ausbildung der entsprechenden Haltungen abgegrenzt werden."
Ein Paradebeispiel für diese Form der Ambivalenz ist auch die Neugier: "Übermaß und Mangel zerstören gleichermaßen ihre soziale wie kognitive Kraft." Die Berechtigung dieses auf Aristoteles zurückgehenden Tugendverständnisses wird zwar nicht einsehen, wer sich nach dem Vorbild neunmalkluger kritischer Rationalisten damit begnügt, ihr Inhaltsleere zu attestieren. Wer hingegen wie Seel die Mühe einer subtilen Phänomenologie menschlicher Tugenden und Laster auf sich nimmt, endet fast unweigerlich als Aristoteliker. Seel jedenfalls bezeichnet sein "Kaleidoskop menschlicher Möglichkeiten" als eine "Regietheaterinszenierung der Nikomachischen Ethik".
Allerdings verschärft und radikalisiert Seel den aristotelischen Gedanken in mehrfacher Hinsicht. Zum einen bekennt er sich zu der Auffassung einer inneren Ambivalenz der Tugenden selbst. Zum anderen interpretiert er auch die Laster als ambivalente Kräfte der praktischen Orientierung des Menschen. "Tugenden sind Laster, die ihr Schlimmstes nicht ausleben; Laster sind Tugenden, die ihr Bestes versäumen." Wie Seel zeigt, dürfen deshalb für die Balance eines guten und gerechten Lebens die latenten Energien der meisten Laster nicht verachtet werden. Wer niemals in Wut gerät, wird es schwerlich zu einem gerechten Zorn bringen. Im Grunde ist es Liebe, wenn man sich mit aller Zürnkraft, zu der man fähig ist, gegen die schäbige Behandlung einer Person empört. Umgekehrt macht sich das Laster seinerseits oft die Antriebe der Tugenden zunutze. Ein Mensch, dem jeder Gerechtigkeitssinn abgeht, ist auch vor dem Laster des Neides gefeit.
Die lebensweltliche Ambivalenz der menschlichen Tugenden und der meisten Laster ändert, wie Seel hervorhebt, allerdings nichts an der Möglichkeit und Berechtigung ihrer begrifflichen Unterscheidung. "Tugenden respektieren und fördern, Laster hingegen verletzen und behindern die Selbstachtung und Selbstbestimmung der Menschen. Tugenden sind gut, Laster hingegen schlecht für ein gutes menschliches Leben und Zusammenleben." Auch darin, dass er die Moral als "eine Institution der sozialen Gewährleistung der Erreichbarkeit eines guten Lebens" begreift, ist Seel Aristoteliker.
Nachdrücklich widerspricht er jedoch der gängigen Auffassung, die zwischen teleologischen - an einem inneren Ziel der menschlichen Lebensführung orientierten - und deontologischen - von kategorischen Pflichten der Menschen ausgehenden - Ethikkonzeptionen einen unüberwindlichen Gegensatz sieht. Wenn Kant von einem "allgemeinen Gesetz" spreche, mit dem das menschliche Handeln im Einklang zu stehen habe, könne damit nur gemeint sein, dass alle Menschen diesem Gesetz zustimmen müssten, wenn sie nur bei Sinnen wären. Doch dafür müssten sie einen starken Grund haben, der nicht wieder bloß in der Allgemeinheit des Gesetzes, sondern "nur in der eudaimonia, also der Grundverfassung eines gelingenden menschlichen Lebens, liegen kann, der die antike Analyse der Tugenden durchweg gewidmet ist". Deshalb sei ein Begriff des guten Lebens in denjenigen des moralisch richtigen Handelns von vornherein eingebaut. "Das Prinzip der Sittlichkeit und das Telos eines gelingenden Daseins verweisen aufeinander."
Diese moraltheoretische Schlusspointe Seels ist so wohldurchdacht, elegant und unprätentiös wie das gesamte Buch. Form und Inhalt stimmen in ihm in einer selten gelungenen Weise überein. Der Aristoteliker Seel hält nämlich auch in seiner Darstellung die Mitte zwischen einer zünftigen Philosophie, die für ihre denkerische Raffinesse häufig den Preis der Technizität und der Lebensferne zahlt, und einer Lebensberatungsliteratur, die ihre Offenheit für die Verwicklungen und Fährnisse des alltäglichen Lebens mit theoretischer Harmlosigkeit zu erkaufen pflegt.
Seels kunstvolle Darstellung einer Lebensführung, "die der Tugend die Treue hält, ohne sich gegenüber den Avancen des Lasters taub zu stellen", zeigt, was praktische Philosophie sein könnte, aber nur noch ganz selten ist: eine Einladung zur Selbst- und Welterkundung, die den, der sich auf sie einlässt, nicht nur klüger, sondern weiser entlässt.
MICHAEL PAWLIK
Martin Seel: "111 Tugenden, 111 Laster". Eine philosophische Revue.
S. Fischer Verlag, Frankfurt a. M. 2011. 288 S., geb., 18,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Klüger und weiser ist Rezensent Michael Pawlik nach der Lektüre von Martin Seels Versuch, Tugend und Laster miteinander ins Gleichgewicht zu bringen. Seels Buch bezeichnet Pawlik als selten geglückte Balance zwischen Alltagsratgeber und fachgerechter Philosophie, die er zudem gut durchdacht und so elegant wie unprätentiös geschrieben findet. Wie der Autor, für Pawlik unschwer als Aristoteliker erkennbar, dessen Phänomenologie beider Begriffe radikaler fasst, indem er die Ambivalenz in den Tugenden selbst verortet, ohne dabei ihre Unterscheidung zu eliminieren, das zeugt für den Rezensenten von philosophischer Meisterschaft.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
Eine elegante Anstiftung zu einem nicht so ängstlichen Leben. NZZ am Sonntag 20120701