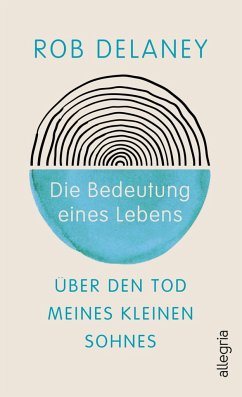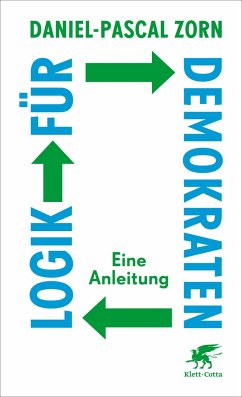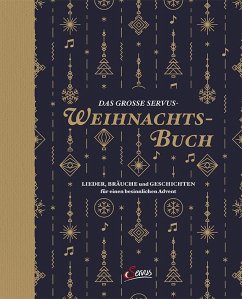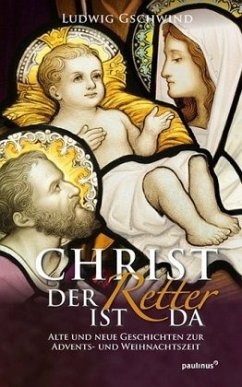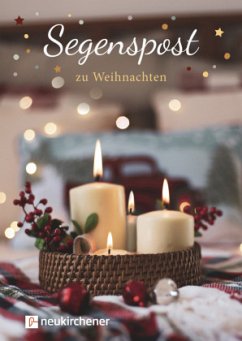12000 Jahre Weihnachten
Ursprünge eines Fests
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 1-2 Wochen
28,00 €
inkl. MwSt.

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Dieses Weihnachtsbuch will Sie vom Glauben abbringen. Oder vielleicht von dem, was man landläufig unter Glauben versteht. Es ist Zeit, sich zurückzubesinnen auf die Ursprünge eines Fests, das weit in vorchristliche Zeit zurückreicht und heute oft bis zur kitschigen Unkenntlichkeit entstellt wird. Weihnachten kann immer noch überraschen - vorausgesetzt, man will sich verzaubern lassen von Mythen, Legenden und den uralten historischen Wurzeln, aus denen unsere winterliche Fest- und Feierzeit zwischen Allerheiligen und Fastnacht erwachsen ist.Was sahen die Menschen des Neolithikums beim feie...
Dieses Weihnachtsbuch will Sie vom Glauben abbringen. Oder vielleicht von dem, was man landläufig unter Glauben versteht. Es ist Zeit, sich zurückzubesinnen auf die Ursprünge eines Fests, das weit in vorchristliche Zeit zurückreicht und heute oft bis zur kitschigen Unkenntlichkeit entstellt wird. Weihnachten kann immer noch überraschen - vorausgesetzt, man will sich verzaubern lassen von Mythen, Legenden und den uralten historischen Wurzeln, aus denen unsere winterliche Fest- und Feierzeit zwischen Allerheiligen und Fastnacht erwachsen ist.Was sahen die Menschen des Neolithikums beim feierlichen Blick in den Himmel? Was verbindet Christus mit dem griechischen Dionysos und dem ägyptischen Horus? Wie wurde der Paradiesbaum zu unserem leuchtenden Christbaum? Was haben römische Sarturnalien mit den Perchten gemein und wann entstanden aus Bienenfleiß die ersten Lebkuchen zur Adventszeit? Gerald Huber führt uns wortgewandt und mit viel Wissen zurück in die Entstehungszeit unserer heutigen Traditionen und gleichzeitig tief hinein in den lichtdunklen Zauber der Weihnacht.