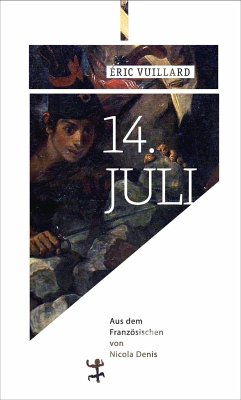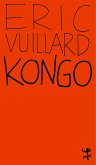Der Sommer 1789 ist herrlich warm und so schön, dass man die Hungersnot im vorangegangenen bitterkalten Winter leicht vergessen kann, zumindest in den Palästen. Im Volk aber wächst die Unzufriedenheit über die Willkür und Dekadenz der herrschenden Klassen, bis die drückende Hitze schließlich kaum mehr auszuhalten ist. Eines Nachts versammeln sich erste Gruppen in der Dunkelheit. Waffenarsenale werden gestürmt, Theaterrequisiten geplündert. Aus falschen Speeren werden echte Schlagstöcke. Die Kirchenglocken in Paris schlagen Alarm, doch zu spät: Am Morgen des 14. Juli hat sich die Menge bereits vor den Toren der Bastille versammelt - sie wird Europa für immer verändern. Éric Vuillard schildert die Geburtsstunde der französischen Revolution als bildreiches Panorama voller Miniaturen, die uns daran erinnern, dass Freiheit auch Gleichheit aller Menschen vor der Geschichte bedeutet.
»Eine Liebeserklärung an die menschliche Vorstellungskraft in einem überwältigenden Text. Ein Buch mit emotionaler Kraft, das zugleich auch das Elend unserer Zivilisation spiegelt.« - Le Monde des Livres
»Eine Liebeserklärung an die menschliche Vorstellungskraft in einem überwältigenden Text. Ein Buch mit emotionaler Kraft, das zugleich auch das Elend unserer Zivilisation spiegelt.« - Le Monde des Livres
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Mit diesem schmalen Büchlein geht Eric Vuillards Konzept, geschichtliche Ereignisse literarisch erzählend darzustellen, endlich mal auf, freut sich Rezensentin Claudia Mäder, die von Büchern Vuillards auch schon ganz schön genervt war. Es geht um den Tag 1789, an dem wütende Pariser die Bastille stürmten. Es gibt in den Archiven Listen, die die Namen der Eroberer und der Toten festhalten, wer sie waren, weiß man allerdings nicht mehr. Und hier setzt Vuillard an, so Mäder, er gibt diesen Menschen, dem Schumacher und dem Wasserträger, den Pierres und Richards, eine Stimme, ein Leben, indem er ihre Geschichte imaginiert. Das funktioniert für die Rezensentin prächtig, weil Vuillard dabei immer zwischen der Menge und dem Einzelnen hin und her schneidet und so die Fragilität des revolutionären Subjekts, das jederzeit in der Masse untergehen zu droht, unterstreicht. Dennoch kann Mäder das Buch nur halb empfehlen, den Vuillards Schwarzweißmalerei bei den Sozialschichten - hier die schurkischen Reichen, dort die engelhaften Armen, empfindet sie als "brachial-populistisch".
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Kampfgeschrei im Ohr, Gestank von Schweiß und Kot in der Nase: Éric Vuillard schildert in seinem Roman "14. Juli" drastisch die Revolution - mit fragwürdiger Moral für die Gegenwart.
Es ist Frühling in Paris. Die Löhne sind gesunken, die Steuern gestiegen, und in den Vororten weicht die Angst vor zunehmender Armut einer Wut auf die ausweglos erscheinenden Verhältnisse nach der Finanzkrise. Längst haben sich lautstarke Gruppen in der Hauptstadt versammelt, protestieren gegen soziale Ungerechtigkeit und die Dekadenz der Eliten, zerstören und plündern im Namen des Volkes. Die Rebellion plant den Umsturz, geht aufs Ganze und wird Europa für immer verändern, denn wir befinden uns im Jahr 1789. Irgendwann brüllen die Ersten "Es lebe der Dritte Stand!" und gehen damit für immer in die Geschichte ein.
"So begann am 28. April 1789 die Revolution", heißt es lapidar im neuen, schmalen Büchlein des französischen Schriftstellers und Filmemachers Éric Vuillard, dem spätestens seit seinem Erfolg mit "Die Tagesordnung" auch in Deutschland große Aufmerksamkeit zuteilwird. Diesem vor zwei Jahren mit dem Prix Goncourt ausgezeichneten Buch über die Vorbereitungen zur Machtergreifung Hitlers ging in Frankreich mit "14. Juli" bereits eines über die Machtergreifung des französischen Volkes voraus, das nun mit etwas Verspätung auch auf Deutsch erscheint und wirken muss, als wäre es das Buch der Stunde. Doch sein Autor, mit dem Finger zugleich am Puls der Zeit und in der Wunde, hat damit etwas vorgelegt, das über die Aktualität tagespolitscher Ereignisse weit hinausweist und kein bloßer Beitrag zur Debatte um die "Gelbwesten" avant la lettre ist.
Dieser 14. Juli, der als französischer Nationalfeiertag noch heute der Erstürmung der Bastille gedenkt, dem wirkmächtigen Beginn der Französischen Revolution, zeigt "eine Stadt, die ein Volk ist", in Aufruhr. Während in den Gefängnissen "Schuldhäftlinge" einsitzen, die sich ihr Brot nicht mehr leisten können, leben Königs auf Pump und verprassen den Staatshaushalt. Die angehäuften Spiel- und anderen Schulden wachsen sich zum Staatsbankrott aus, einem "Rennen Richtung Abgrund", das sich die kleinen Leute nicht mehr bieten lassen und notfalls mit "der Gewalt der Bajonette" zu beenden gedenken.
Zwar tauchen am Rande neben dem Marquis de Mirabeau oder Camille Desmoulins auch Danton und Napoleon auf, doch geht es Vuillard ausdrücklich um die Lebensumstände der Armen, um die von der Geschichtsschreibung Übersehenen oder Marginalisierten. Das Genre der prominent besetzten Heldengeschichte wird hier für den Feinwaschgang auf links gedreht und danach neu gesampelt. Wo nach Walter Benjamin Geschichte immer die Geschichte der Sieger ist, rückt Vuillard in seiner Aneinanderreihung von historischen Episoden und Anekdoten die anonym Gebliebenen in den Fokus. Diese Miniaturen, Vuillards Markenzeichen, erzählen nur ausschnittsweise und unternehmen gar nicht erst den Versuch, das große Ganze abzubilden, sondern werfen Schlaglichter, liefern Momentaufnahmen und erzielen ihre Unmittelbarkeit durch häufige Szenenwechsel. Erst die Konzentration aufs Detail, auf die Kleidung und Körper der Figuren, lässt diese lebendig werden, legt ihnen im Wind wehende Schals um oder gerippte Strümpfe an, lässt ihre Hälse "Blut pissen" und die geschundenen Leiber von Fliegen und Krähen zerfressen.
Dieses punktuelle, rhapsodische Erzählen, das mal wie ein dokumentarisch erfassendes Kameraauge in der Halbtotalen an der Szenerie vorbeifährt und mal in der Großaufnahme ganz nah dran ist - man merkt diesem wie allen Texten Vuillards den Filmemacher an -, zieht sofort in seinen Bann. Wir sehen sämtliche Details, den Dreck in den Straßen, die zerlumpten Armen, haben das Dröhnen der Glocken und des Kampfgeschreis im Ohr, den Gestank von Schweiß und Kot in der Nase. Was die Historiographie über die Jahrhunderte kondensiert hat, wird in diesem bunten Geschichtskonfetti wieder erfahrbar als erlebte und durchlittene Erfahrung von Individuen.
Doch Vuillard ist ein Sohn der Postmoderne, lehnt allwissende Erzählinstanzen ab und glaubt mit Jean-François Lyotard nicht mehr an die "großen Erzählungen" der Moderne, die uns absolute Erklärungen der Geschichte liefern wollen, sondern verfolgt eine selbstreflexive Geschichtspoetologie, die an der Vorstellung von objektiver Historiographie rüttelt. Daher hält die Erzählinstanz das Geschehen ständig an, betritt kommentierend die Szene und macht den Vorhang wieder zu. Vuillard thematisiert in einem stetigen Reflexionsprozess das Erzählen als Illusionsmaschine, macht damit den Konstruktionscharakter jedes Narrativs transparent und hebt so mit Anklängen an Hayden White die "Fiktion des Faktischen" hervor.
Das historische Präsens nimmt uns, das kennen wir aus unseren Geschichtsbüchern, nicht nur mit an die Schauplätze epochaler Ereignisse, sondern eröffnet bei Vuillard einen Raum für das Nachdenken darüber, wie wir eigentlich erzählen, was wir als auswählenswert und für tradierungswürdig befinden. Und wenn wir ernst nehmen, wie Vuillard in der "Tagesordnung" ebenso wie in seinen früheren Büchern "Kongo" und "Traurigkeit der Erde" über die Auswirkungen der Geschichte auf unsere Gegenwart oder Parallelen zu ihr aufmerksam macht, kann man schon verwundert darüber sein, dass "14. Juli" in ungebrochen revolutionärer Rhetorik - und à la Édouard Louis' Forderung nach dem "Zerschmettern" der Bourgeoisie - auf den letzten beiden Seiten dem Aufstand das Wort redet: "Man müsste, wenn die Ordnung uns erbittert, die Türen unserer lächerlichen Elysée-Paläste eintreten, man müsste die Schubladen öffnen, die Scheiben mit Steinen einschmeißen und die Papiere aus dem Fenster werfen. Dekrete, Gesetze, Protokolle, einfach alles! Das wäre schön und lustig und erhebend."
BASTIAN REINERT
Éric Vuillard: "14. Juli". Roman.
Aus dem Französischen von Nicola Denis. Verlag Matthes & Seitz, Berlin 2019. 136 S.,
geb., 18,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Éric Vuillard bleibt ein rastloser Flaneur in den Kulissen der Geschichte. Martin Oehlen Frankfurter Rundschau 20190425