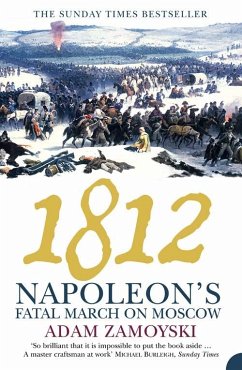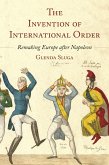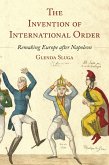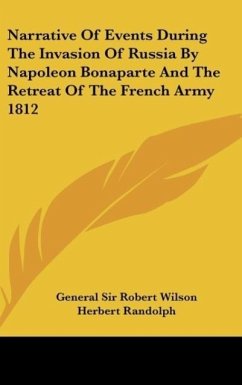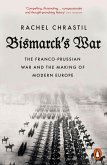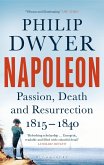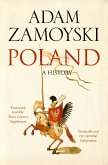Ein schlechter Reiter und lausiger Kutscher: Adam Zamoyski nimmt sich Napoleon vor und gerät ins Raunen. Auch des Kaisers Intimleben wird nicht ausgespart.
Von Andreas Kilb
Die Schlüsselszene dieses Buches spielt in Italien. Die französische Revolutionsarmee unter ihrem General Napoleon Bonaparte hat ein österreichisches Korps in Mantua eingeschlossen. Zwei Entsatzheere nähern sich Anfang November von Norden und Osten. Bonaparte will dem östlichen Angriffskeil in die Flanke fallen, während ein Teil seiner Armee die übrigen Österreicher nördlich von Verona aufhält. Der Flankenstoß führt über den Alpone, einen Nebenfluss der Etsch. Die entscheidende Brücke liegt bei dem Dorf Arcole.
Die Franzosen versuchen sie am 15. November im Sturm zu nehmen, aber die Verteidiger sind gut verschanzt. Als die erste Attacke scheitert, steigt der General vom Pferd und ergreift eine Fahne. Der Trupp, den er anführt, wird von einer gut gezielten Salve empfangen, die seinen Adjutanten tötet. Seine überlebenden Begleiter stoßen Bonaparte in einen Entwässerungsgraben. Triefnass, aber unverletzt wird er aus dem Wasser gezogen. Die Brücke bleibt in österreichischer Hand. So weit die Fakten.
In Bonapartes Bulletin an das fünfköpfige Direktorium in Paris, das nach dem Sturz Robespierres die Revolutionsgeschäfte führt, klingt alles ganz anders. Hier verschmilzt die Schlappe bei Arcole mit den Gefechten der folgenden Tage, die die Österreicher schließlich doch zum Rückzug zwingen, zu einem einzigen, durch Bonapartes Fahnenmarsch ausgelösten Triumph. Noch im selben Monat beginnt Antoine-Jean Gros, der die französische Armee begleitet, mit seinem Ölbild "Bonaparte an der Brücke von Arcole".
Es zeigt den General in Galauniform mit gezücktem Schwert und wehendem Haar. Das Gemälde, durch zahlreiche Drucke verbreitet, wird zur Ikone der siegreichen Revolution. Im Jahr darauf richtet das Direktorium für Bonaparte, der auf eigene Faust mit dem Kaiser in Wien Frieden geschlossen hat, eine Staatsfeier aus. Zwei Jahre später wird es von ihm gestürzt.
Bonapartes Schlachtberichte und die Bilder, die sie begleiteten, schufen "ein unterschwelliges Gefühl des Übernatürlichen, des Wunderbaren, eines Abenteuers, das von Männern bestritten wurde, die so übermenschlich wirkten wie die Helden der ,Ilias'", schreibt Adam Zamoyski in seiner Napoleon-Biographie. Sie gaben einem Land, das seine Führungsschicht geköpft oder vertrieben hatte, und einem Kontinent, der sich nach Reformen sehnte, einen neuen Heldentypus, dessen Faszination nie ganz erloschen ist und mit dem sich jeder Biograph ein weiteres Mal auseinandersetzen muss.
Der Brite Zamoyski, der vor sechs Jahren bereits die Mythen, die sich um Napoleons Russland-Feldzug ranken, in einer vielbeachteten Studie dekonstruiert hat, schien dafür der richtige Mann zu sein, und die ersten Kapitel des Buches, in denen er die Kindheit und Jugend seines Helden und dessen wachsende Fähigkeit zur Selbststilisierung vor dem Hintergrund der politischen Umwälzungen seiner Zeit beleuchtet, bestätigen diese Erwartung. Leider bleibt es nicht dabei. Das liegt nicht daran, dass Zamoyski, wie viele Biographen vor ihm, seinem Gegenstand auf den Leim gegangen wäre. Aber er ist der Versuchung erlegen, die ein Projekt dieser Größe unvermeidlich mit sich bringt. Je weiter Zamoyskis Studie vorankommt, desto störender macht sich sein Ehrgeiz bemerkbar, das endgültige, abschließende Buch zum Thema zu schreiben. Die Furcht, etwas Wichtiges auszulassen, zieht seine Darstellung oft ins Pedantische, etwa bei den Details von Napoleons Eheleben mit Joséphine de Beauharnais oder der Holland-Reise mit seiner zweiten Frau Marie-Louise von Österreich.
Umso oberflächlicher wird die Militär- und Sozialgeschichte des Revolutionszeitalters abgehandelt. Napoleons Ruhm als Feldherr war kein reiner Propagandaeffekt. Die schulbuchmäßig geführten Armeen des Absolutismus hatten seinen Kolonnenangriffen auf ihr Zentrum nichts entgegenzusetzen. Die Massen, die dabei zum Einsatz kamen, waren selbst ein Produkt der Revolution, und sie trugen die nationale Idee, der sie auf dem Schlachtfeld Form gaben, in die von ihnen besetzten Länder. Zamoyski kennt zwar jedes Gefecht beim Namen, aber der Gedanke, dass Napoleons Taktik eine Form des Politischen war, ist ihm fremd, weshalb er auch die Pointe verpasst, dass ihre Übernahme durch die Koalitionsheere seinen politischen Untergang bedeutete.
Überhaupt leidet dieses Buch nicht gerade an einem Übermaß an analytischer Kraft. Weil Zamoyski keine klare Haltung zu seinem Gegenstand hat, erzählt er einfach alles Mögliche, und am besten ist er im Anekdotischen. Napoleon ist ein schlechter Reiter und lausiger Kutscher, als er einen Sechsspänner lenkt, fährt er ihn gegen einen Poller; vor der Überquerung des Njemen scheut sein Pferd vor einem Hasen, was als schlechtes Omen gilt; beim Kongress in Erfurt schurigelt er die gekrönten Häupter ("Schweigen Sie, König von Bayern!"); seine Gattin besitzt 498 Blusen und 785 Paar Schuhe; in Burgos lässt er sich "eine junge Jungfrau zuführen", wird aber von ihrem starken Parfüm abgeschreckt. Hier tut die unbeholfene Übersetzung ein Übriges, um Zamoyskis Prosa an den nächsten Poller zu fahren; aber auch an besser übersetzten Stellen ist kein Gedanke in Sicht.
"Napoleon. Ein Leben" ist eher ein Katalog als eine Biographie, mit Zamoyski als übereifrigem und zugleich überfordertem Kurator. Dabei wäre eine medienkritische Betrachtung von Napoleons Kaisertum in Zeiten der Twitter-Demokratie und der türkisch-russischen Bildschirmdiktatur mehr als willkommen gewesen. Friedrich der Große hatte als Erster begriffen, dass absolute Herrschaft im Zeitalter der europäischen Aufklärung eine Frage der Selbstinszenierung war. Aber während der Preußenkönig seine Kriegsberichte und Pamphlete vor allem für andere gekrönte Häupter und lange nach den Ereignissen verfasste, lenkte Napoleons Propaganda die Öffentlichkeit gleichsam in Echtzeit. Die Bulletins der Grande Armée, von ihm selbst verfasst oder mindestens redigiert, erschienen im "Moniteur", bevor irgend ein Gerücht über den tatsächlichen Ausgang der Schlachten die Runde machen konnte; die Lüge war der Wahrheit um eine Nasenlänge voraus. Um diese Imagepolitik zu perfektionieren, brauchte Napoleon den Apparat des Kaiserreichs, und um sie durchzusetzen, musste er ihren Geltungsbereich immer weiter ausdehnen. Er war also nicht im Widerspruch mit sich selbst, als er sich die Krone aufsetzte, wie Zamoyski meint, sondern erst richtig bei sich angelangt.
Seinen Tiefpunkt erreicht Zamoyskis Buch bei den Kommentaren zu Napoleons Intimleben. Kein Biograph kann heute gänzlich auf Schlafzimmerblicke verzichten, aber eine Bemerkung wie jene, die Vorliebe des jungen Bonaparte für erfahrene Frauen sei typisch "für die sexuell Unversierten", streift die Grenze zum Peinlichen. Über Napoleons Geliebte Maria Walewska raunt Zamoyski, es sei "unwahrscheinlich, dass sie seiner sexuellen Leistungsfähigkeit gegenüber kritisch gewesen" sei. Man fragt sich, wo bei solchen Patzern das sonst so leistungsfähige Lektorat des Beck Verlags geblieben ist. Wahrscheinlich bei den Unversierten.
Adam Zamoyski: "Napoleon". Ein Leben.
Aus dem Englischen von Ruth Keen und Erhard Stölting.
Verlag C. H. Beck, München 2018. 863 S., Abb., Karten, geb., 29,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
'So brilliant that it is impossible to put the book aside ... A master craftsman at work.' Michael Burleigh, Sunday Times
'Zamoyski's book is a brilliant piece of narrative history, full of sparkling set-pieces, a wholly fascinating account of what must be reckoned one of the greatest military disasters of all time.' Sunday Telegraph
'No review can do justice to the scholarly integrity and human sensitivity of this book, or to the horror is describes ... "1812" is one of the greatest stories ever told.' Christopher Woodward, Spectator
'An utterly admirable book. It combines clarity of thought and prose with a strong narrative drive.' Daily Telegraph
'A gripping tale.' Economist
'The best non-fiction version to be written so far ... Zamoyski is brilliant at explaining what it must have been like to be a foot soldier.' Mail on Sunday
'Zamoyski's book is a brilliant piece of narrative history, full of sparkling set-pieces, a wholly fascinating account of what must be reckoned one of the greatest military disasters of all time.' Sunday Telegraph
'No review can do justice to the scholarly integrity and human sensitivity of this book, or to the horror is describes ... "1812" is one of the greatest stories ever told.' Christopher Woodward, Spectator
'An utterly admirable book. It combines clarity of thought and prose with a strong narrative drive.' Daily Telegraph
'A gripping tale.' Economist
'The best non-fiction version to be written so far ... Zamoyski is brilliant at explaining what it must have been like to be a foot soldier.' Mail on Sunday