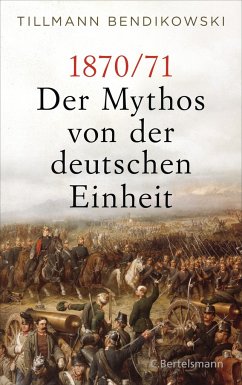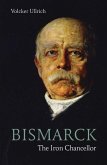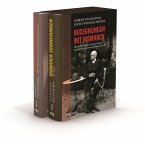Die deutsche Einheit - nur ein Mythos?
Der Mythos von der deutschen Einheit prägt bis heute, so Tillmann Bendikowski, die Sicht der Deutschen auf sich selbst und ihre Geschichte. Zentrales Gründungsdatum dieses Mythos ist der Krieg gegen Frankreich und die anschließende Reichsgründung im Jahr 1870/71. Anhand der eingehenden Schilderung von neun symbolträchtigen Tagen werden entscheidende Abschnitte auf dem Weg zur deutschen Einigung unter Preußens Führung vergegenwärtigt: von der Flucht des Welfenkönigs aus Hannover ins österreichische Exil im Juni 1866 bis - nach der Proklamation des deutschen Kaiserreichs im Spiegelsaal von Versailles - zur Siegesparade fünf Jahre später.
Das Buch erhält einen 16-seitigen Farbbildteil, der die für die Thesen des Buches wesentlichen Ereignisse der Zeit darstellt.
Ausstattung: 16-seitiger farbiger Bildteil
Der Mythos von der deutschen Einheit prägt bis heute, so Tillmann Bendikowski, die Sicht der Deutschen auf sich selbst und ihre Geschichte. Zentrales Gründungsdatum dieses Mythos ist der Krieg gegen Frankreich und die anschließende Reichsgründung im Jahr 1870/71. Anhand der eingehenden Schilderung von neun symbolträchtigen Tagen werden entscheidende Abschnitte auf dem Weg zur deutschen Einigung unter Preußens Führung vergegenwärtigt: von der Flucht des Welfenkönigs aus Hannover ins österreichische Exil im Juni 1866 bis - nach der Proklamation des deutschen Kaiserreichs im Spiegelsaal von Versailles - zur Siegesparade fünf Jahre später.
Das Buch erhält einen 16-seitigen Farbbildteil, der die für die Thesen des Buches wesentlichen Ereignisse der Zeit darstellt.
Ausstattung: 16-seitiger farbiger Bildteil

Liegen die Gründe für das, was Deutsche an Gegenwart und Staat so stört, vielleicht viel weiter zurück, als man denkt? Zum Beispiel genau 150 Jahre, als Deutschland seine erste Wiedervereinigung feierte?
Kann es sein, dass die vielen Neu- und Gesinnungspreußen, die Stadtschlosswiederaufbauer und Potsdamverschönerer, die Verehrer Friedrichs des Zweiten und Ottos von Bismarck das womöglich wichtigste Jubiläum der Saison übersehen haben? Dass nämlich, vor genau 150 Jahren, mit der sogenannten Emser Depesche, all das begann, was schließlich Preußens größter Triumph wurde: der Sieg über Frankreich. Die Gründung eines Deutschen Reichs unter preußischer Vorherrschaft. Und die Krönung des preußischen Königs zum Deutschen Kaiser?
Kann es außerdem sein, dass der Rest der Deutschen, die sich in diesem Sommer langsam einstimmen auf den dreißigsten Jahrestag der Wiedervereinigung im Herbst, lieber nicht daran erinnert werden möchte, dass das, was vor 150 Jahren geschah, auch schon als deutsche Wiedervereinigung gefeiert wurde - von denen jedenfalls, die es betrieben: Nicht nur die Teilung und Zersplitterung des 19. Jahrhunderts seien durch die Reichsgründung endlich überwunden worden, sondern recht eigentlich die deutschen Verhältnisse in der gesamten frühen Neuzeit, als das Heilige Römische Reich zwar einen Kaiser und einen Reichstag hatte, aber doch zu groß, zu unübersichtlich, zu multiethnisch war und zu undeutsch, als dass daraus ein deutscher Nationalstaat hätte werden können. Das Reich - so ging jedenfalls die preußische Interpretation -, das von Preußen wiedervereinigt wurde, war zuletzt unter den Kaisern des hohen Mittelalters so einig und so stark gewesen.
Das Reich, dessen Gründungsjubiläum anscheinend kaum jemand feiern will, hat mit uns Heutigen schon deshalb zu tun, weil es der Staat ist, in dem die Deutschen auch heute leben. Die Regierungsformen haben sich geändert, die inneren Grenzen haben sich verschoben, die östlichen Provinzen gehören nicht mehr dazu. Die Bundesrepublik Deutschland ist trotzdem der Nachfolgestaat dieses Reiches - und dessen Gründungsjubiläum könnte eigentlich Anlass genug sein, die deutsche Geschichte danach zu befragen, ob nicht vieles, was die Deutschen der Gegenwart an sich selbst und ihrem Staat so stört, manches Ressentiment und Vorurteil, das Empfinden geistiger Enge und kulturellen Unbehagens, schon in der Gründungsgeschichte seine Ursache hat.
Das tun aber die wenigsten - und man ist versucht, das profunde Desinteresse, die selbstgewisse Gleichgültigkeit der meisten Deutschen einem Phänomen zuzuschreiben, das Karl Heinz Bohrer vor knapp zwanzig Jahren, in einem damals vieldiskutierten Vortrag, "Erinnerungslosigkeit" nannte: Die Deutschen, so klagte Bohrer damals, hätten mit der Erinnerung an ihre unfassbare Jüngstvergangenheit, an den Krieg und die Verbrechen der Nazis, so viel zu tun, dass die Kräfte ihres Geschichtsbewusstseins danach nur noch für die Vorgeschichte reichten, für die Weimarer Republik, den Ersten Weltkrieg, gerade noch das Kaiserreich. Und die Amoral des sogenannten Dritten Reichs fordere die Moral der Deutschen so sehr heraus, dass auch der Blick auf alles andere, auf Fern- und Fernstvergangenheit, ein moralischer, letztlich unhistorischer sei. Kein "Fernverhältnis", kein Eros, keine "Faszination am fremden Eigenen". Heute, mit Abstand, sieht man womöglich klarer als damals, dass Bohrers Protest gegen deutsche Geschichtslosigkeit im Kern ein Protest gegen die deutsche Geschichte war, eine Geschichte, die, aufgrund der geographischen, religiösen und machtpolitischen Zerfranstheit und Unübersichtlichkeit, nicht den epischen Erfahrungs- und Erzählungsraum bilden kann, den Bohrer bei den Franzosen so schätzt.
Und das ist das Problem mit dem Sommer von vor 150 Jahren: Man kann die Ereignisse nacherzählen, aber es wird immer eine komplizierte, verwickelte und äußerst spannungsarme Erzählung bleiben. Und noch schlimmer: Man kann die handelnden Personen identifizieren. Aber je genauer man hinsieht, desto unverständlicher und aus heutiger Sicht unzugänglicher wird ihr Handeln. Bei der Emser Depesche ging es, einerseits, um die spanische Thronfolge. Und andererseits um Wilhelm, König von Preußen, der in Bad Ems die Sommerfrische genoss. Die Spanier hatten sich als neuen König einen Hohenzollernprinzen gewünscht, die europäischen Mächte hatten ihr Nichteinverständnis deutlich gemacht, der Prinz hatte seine Kandidatur zurückgezogen. Aber Frankreich forderte jetzt eine Garantie, dass nie wieder ein Hohenzoller für den spanischen Thron kandidieren werde, was Wilhelm verweigerte. Beim Spaziergang in Bad Ems begegneten sich der König und der französische Botschafter und sprachen noch einmal über den Konflikt, ohne sich einig zu werden. Und in der Emser Depesche, die Otto von Bismarck redigierte und am 13. Juli 1870 an die Presse weitergab, las sich das so, als wäre der Franzose frech und zudringlich geworden. Und der König hätte ihn barsch zurückgewiesen. So waren beide Seiten beleidigt. Sechs Tage später erklärte Frankreich den Krieg.
Dass Fragen des Stils und der Umgangsformen einen Krieg auslösen können, ist uns, als Zeitgenossen zum Beispiel von Donald Trump oder Recep Tayyip Erdogans, zu fremd, zu fern, als dass wir in den handelnden Personen bereitwillig unsere Vorläufer und Wegbereiter erkennen wollten, die Menschen, auf deren Taten unser Handeln aufbaut.
Und zugleich sind Preußens Pomp und Pickelhaubigkeit, die da, wo sie Architektur geworden sind, ja hineinragen in die Gegenwart, unseren Geschmacksnerven nahe genug, dass wir sie als peinlich, falsch, ästhetisch indiskutabel empfinden. Zu nah, als dass sich jene Vergangenheit als Projektionsfläche eignete für "libidinös aufgeladene Geschichten", für den organisierten Traum, wir könnten wie Touristen zurückreisen in die Vergangenheit und sie gewissermaßen konsumieren (wie das, vor eineinhalb Jahren, der Historiker Valentin Groebner im Interview mit dieser Zeitung beschrieben hat).
Und genau damit, mit den geläufigen Vorbehalten gegen Preußen, mit den kulturellen, ästhetischen und politischen Ressentiments, arbeitet Tillmann Bendikowski, Journalist und Historiker, in seinem neuen Buch "1870/71", das er im Untertitel den "Mythos von der deutschen Einheit" nennt. Wieso Mythos, möchte man als Erstes fragen: Ist es nicht gesichertes historisches Wissen, exakt datiert und belegt, dass diese Einheit, nach langen Verhandlungen und Vorbereitungen, schließlich am 1. Januar 1871 geschaffen wurde?
Mit Einheit, antwortet das Buch, ist etwas anderes gemeint, jene geistige, kulturelle und politische Einheit, die Versöhntheit der Deutschen mit sich selbst, miteinander und mit ihrem Staat, welche gern auch als "innere Einheit" bezeichnet und bei jedem Wiedervereinigungsjubiläum eingefordert wird: als eigentliches Ziel jenes historischen Prozesses, der mit dem Fall der Mauer vor 31 Jahren begann. Und erst abgeschlossen sein wird, wenn niemand mehr unversöhnt mit den deutschen Verhältnissen ist.
Bendikowskis Buch ist ein populäres Sachbuch, eine Art von Reportage von den Schauplätzen des Geschehens, mit Hilfe der bekannten Quellen und Zitate so anschaulich wie möglich erzählt - was, angesichts der Indifferenz des Publikums, vermutlich kein Mangel ist. Es fängt an - und setzt den Ton - mit den Folgen des Deutschen Kriegs im Sommer 1866, jenes Kriegs, den der Deutsche Bund (wie sich der lose Zusammenschluss deutscher Staaten nach dem Wiener Kongress nannte) gegen Preußen führte. Und den Preußen triumphal gewann. So wurde Österreich aus Deutschland herausgedrängt; wovon das Buch aber weit ausführlicher erzählt, ist der brutale, barbarische und absolut illegitime Akt, in dem Preußen die meisten Territorien nördlich des Mains annektierte, darunter das Königreich Hannover (das bis vor kurzem noch eine Personalunion mit dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und Irland gebildet hatte), das Kurfürstentum Hessen und die Freie Stadt Frankfurt, Sitz des Bundestags und in der gesamten frühen Neuzeit der Ort, an dem die Kaiser gewählt und gekrönt worden waren.
Die Annexion hatte zur Folge nicht nur den Umstand, dass Preußen fortan auch auf preußischem Territorium verhasst war und auf die Loyalität der neuen Untertanen nicht zählen durfte. Auch als es für die selbständig gebliebenen Staaten Süddeutschlands im Sommer 1870 darum ging, ob man das erzwungene Bündnis mit Preußen erfüllen und gegen Frankreich in den Krieg ziehen solle, stand den Herrschern das Schicksal Hannovers vor Augen. Die Bayern spielten mit dem Gedanken, mit dem katholischen Frankreich gegen Preußen zu ziehen. Sie hätten sich auf jeden Fall gern herausgehalten. Und sie nahmen am Krieg letztlich nur deshalb teil, weil sie fürchteten, im Fall eines preußischen Siegs zur preußischen Provinz zu werden.
Was blieb, waren Herablassung, Verachtung, oft der blanke Hass - starke Gefühle, gegen welche die heutigen innerdeutschen Ressentiments beinahe harmlos wirken. Östlich der Elbe herrsche noch das Mittelalter; mit dem Militarismus wolle man nichts zu schaffen haben; und das Pathos, mit dem jetzt die Reichsgründung begangen werde, sei kalt, leer, ohne Substanz, letztlich undeutsch und unzivilisiert.
Man muss, wenn man das Ganze ein wenig plastischer betrachten will, im Gegenlicht einer Antithese gewissermaßen, schon Christopher Clarks "Preußen" zur Hand nehmen, das Buch des australischen Historikers, der, unter anderem, sehr schön schildert, wie menschlich und modern dieses Preußen zeitweilig war, ein Land, in dem die Aufklärung früher als anderswo ankam, ein Staat ohne eigentliches Staatsvolk, weshalb Einwanderer, ob sie aus den Niederlanden oder aus Frankreich kamen, immer willkommen waren. Man musste kein Deutscher sein, um Preuße zu werden.
Womöglich ist das aber gar kein Widerspruch. Womöglich klang das nationale Pathos, als das Reich dann gegründet war, auch deshalb so falsch, so hohl, so aggressiv, weil es den Preußen an Übung im Deutschsein mangelte. Der britische Autor James Hawes hat neulich, in seiner "Kürzesten Geschichte Deutschlands", die ziemlich steile These formuliert, dass die Bewohner des Südens und des Westens aus ihrem Deutschsein eigentlich nie ein Drama gemacht hätten. Es seien die im Osten gewesen, die, die sich ihrer Zugehörigkeit nicht ganz sicher gewesen seien, die dann den aggressiven Nationalismus praktizierten. Bei der Kaiserkrönung in Versailles rief der Hofprediger Bernhard Rogge seinen Gott mit diesen Sätzen an: "Du hast zu Trägern dieser Krone Herrscher berufen, die bald in der eisernen Zucht ernster Strenge und stillen Fleißes, bald im kühnen Adlerfluge hohen Strebens, bald in zäher Ausdauer und ausharrender Geduld in den Bedrängnissen und Kämpfen schwerer Zeiten ihrem Volk vorausgegangen sind." Das ist nicht bloß altmodisch dahergeredet, das klang schon damals, in nichtpreußischen Ohren jedenfalls, wie das reine Blech.
Das Reich, das vor 150 Jahren gegründet wurde, bestand zu zwei Dritteln aus preußischen Provinzen. Der Rest waren Süddeutsche, die mit Preußens Herrschaft haderten und sich trösteten mit dem Gefühl, zumindest zivilisatorisch überlegen zu sein. Im Februar 1947, mit dem Alliierten Kontrollratsgesetz Nummer 46, hörte der Staat Preußen auf, "in Wirklichkeit" zu bestehen. Als Zombie, untot und unerlöst, geistert er seither durch die deutsche Kultur und die deutschen Debatten - wie man das zuletzt beim Streit um die Besitz- und Definitionsansprüche der Hohenzollern beobachten konnte. Aber selbst den leidenschaftlichsten Preußenschwärmern zwischen Berlin und Potsdam ist alles Borussische eher Dekoration als Substanz, ein Problem der Ästhetik, nicht der Politik
Wenn es aber etwas zu feiern gibt, in diesem und im nächsten Jahr, dann ist es wohl der Umstand, dass dieses staatliche Gebilde, das sich "Reich" verständlicherweise nicht mehr nennen will, sich als erstaunlich stabil erwiesen hat - ganz ohne dass es die Preußen brauchte, die es zusammenhielten.
CLAUDIUS SEIDL
Tillmann Bendikowski: "1870/71 - Der Mythos von der deutschen Einheit". C. Bertelsmann, 400 Seiten, 25 Euro
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Sehr verdienstvoll findet Rezensent Gustav Seibt, wie Tillman Bendikowski in seiner Geschichte der Reichsgründung 1871 vor allem den Stimmen der Gegner Raum gewährt. Denn es waren nicht nur die reaktionären Welfen, die "mit der Liquidierung des Königshaus Hannover ausgeschaltet wurden" und die gegen eine deutsche Einigung unter preußischer Führung opponierten, sondern auch die fortschrittlichen Bayern. Und wie Seibt unter Berufung auf Bendikowski betont, wirkte hier nicht nur katholisches Antipreußentum, sondern ein Antimilitarismus und das historisch fundierte Misstrauen gegenüber einem Erbkaisertum, das sich schon auf den Kampf deutscher Fürsten gegen Barbarossas Sohn Heinrich VI. berufen konnte. Toll in Szene gesetzt findet der Rezensent, wie Bismarcks den Bayernkönig Ludwig II. kaufte - "mit der bei ihm üblichen Politik der Weinkrämpfe und massiven Bestechung".
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»Bendikowskis Buch ist ein populäres Sachbuch, eine Art von Reportage von den Schauplätzen des Geschehens, so anschaulich wie möglich erzählt.« Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung