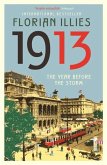Die Geschichte eines ungeheuren Jahres - der internationale Bestseller jetzt als Taschenbuch!
»Ich konnte nicht mehr aufhören zu lesen - Illies' Geschichten sind einfach großartig.«
Ferdinand von Schirach
Florian Illies entfaltet virtuos ein historisches Panorama. 1913: Es ist das eine Jahr, in dem unsere Gegenwart begann. In Literatur, Kunst und Musik werden die Extreme ausgereizt, als gäbe es kein Morgen. Zwischen Paris und Moskau, zwischen London, Berlin und Venedig begegnen wir zahllosen Künstlern, deren Schaffen unsere Welt auf Dauer prägte. Man kokst, trinkt, ätzt, hasst, schreibt, malt, zieht sich gegenseitig an und stößt sich ab, liebt und verflucht sich.
Es ist ein Jahr, in dem alles möglich scheint. Und doch wohnt dem gleißenden Anfang das Ahnen des Verfalles inne. Literatur, Kunst und Musik wussten schon 1913, dass die Menschheit ihre Unschuld verloren hatte. Florian Illies lässt dieses eine Jahr, einen Moment höchster Blüte und zugleich ein Hochamt des Unterganges, in einem grandiosen Panorama lebendig werden.
»Ich konnte nicht mehr aufhören zu lesen - Illies' Geschichten sind einfach großartig.«
Ferdinand von Schirach
Florian Illies entfaltet virtuos ein historisches Panorama. 1913: Es ist das eine Jahr, in dem unsere Gegenwart begann. In Literatur, Kunst und Musik werden die Extreme ausgereizt, als gäbe es kein Morgen. Zwischen Paris und Moskau, zwischen London, Berlin und Venedig begegnen wir zahllosen Künstlern, deren Schaffen unsere Welt auf Dauer prägte. Man kokst, trinkt, ätzt, hasst, schreibt, malt, zieht sich gegenseitig an und stößt sich ab, liebt und verflucht sich.
Es ist ein Jahr, in dem alles möglich scheint. Und doch wohnt dem gleißenden Anfang das Ahnen des Verfalles inne. Literatur, Kunst und Musik wussten schon 1913, dass die Menschheit ihre Unschuld verloren hatte. Florian Illies lässt dieses eine Jahr, einen Moment höchster Blüte und zugleich ein Hochamt des Unterganges, in einem grandiosen Panorama lebendig werden.
Florian Illies hat ein Jahrhundertbuch geschrieben. Alexander Kluge Welt am Sonntag 20130106

Florian Illies hat eine Sammlung von all dem veranstaltet, was 1913 so gesagt und gedacht wurde. "Das war doch das Jahr vor 1914!", wird man sagen, aber die Geschichte fuhr natürlich nicht nach einem Fahrplan auf den Ersten Weltkrieg zu.
Von Thomas Weber
Nehmen wir einmal an, dass ein wilhelminisches Dornröschen am heutigen Tage wachgeküsst wird, nachdem es sich am Silvestertag 1913 mit seiner Spindel in den Finger stach. Ihm fällt alsbald Florian Illies' Buch mitsamt dazugehöriger Pressemappe in die Hände. Es freut sich bei der Lektüre des collagenartigen Panoramas des Jahres 1913, mit welch leichten Füßen ein Nachgeborener seine Zeit eingefangen hat. Wenn Illies erzählt, wie Hitler und Stalin in Wiener Parks den Hut füreinander gezückt haben könnten, während Trotzki nur Häuserblöcke entfernt im Café Schach spielte, Tito als Testfahrer mit seinem Mercedes durch die Hauptstadt des Habsburgerreiches waghalsig raste, Erzherzog Franz Ferdinand mit seiner Modelleisenbahn auf dem Fußboden und Gustav Klimt bei seinen Models lag, während preußische Junker nackt um Potsdamer Seen liefen, meint man, die Gerüche und Geräusche des Jahres 1913 riechen und hören zu können.
Doch bei der Lektüre der Pressemappe wird unser wilheminisches Dornröschen stutzig. Es liest, dass Illies damit schließe, Arthur Schnitzler habe am Tage ihres Spindelmissgeschicks Ricarda Huchs "Der große Krieg in Deutschland" gelesen, und dies sei als Vorahnung der bevorstehenden Apokalypse zu werten. Etwas habe in der Luft gelegen. Den Menschen sei 1913 mulmig gewesen. Das Buch sei ein ganz wunderbares Porträt einer zusammenbrechenden Welt am Abgrund, einen weiteren Erkenntniswert habe es freilich nicht. Unser wilhelminisches Dornröschen versteht nun, weder von welcher Apokalypse hier die Rede sein soll, noch was Ricarda Huchs Geschichte des Dreißigjährigen Krieges damit zu tun haben soll.
Natürlich ist unser wilhelminisches Dornröschen sich des Kulturpessimismus mancher seiner Zeitgenossen bewusst, der mit dem Fortschrittsglauben seiner Zeit zuweilen konkurrierte und manchmal damit einherging. Todessehnsucht, Untergang und Verderben lauerten hinter beinahe jeder Ecke: Emil Nolde begegnet im Pazifik "einer Kultur im Augenblick ihres Untergangs". Wiener Künstler geben sich der Lust an Selbstvernichtung hin, Sigmund Freud ist so deprimiert wie nie zuvor, C. G. Jung kommen im Traum apokalyptische Visionen, Franz Kafka hat Gewaltphantasien, und der Augsburger Pennäler Bertolt Brecht sinniert über den Heldentod. Ludwig Meidner malt brennende Städte und Landschaften, aufgebrochen durch Bomben und Krieg. Oswald Spengler sieht sowieso überall den Untergang des Abendlands, und Thomas Mann offenbart in dem Jahr, in dem "Tod in Venedig" erscheint, dass sein "ganzes Interesse immer dem Verfallen" gegolten habe.
Unserem Dornröschen ist aber immer noch nicht klar, am Rande welches Abgrunds es denn nun gelebt haben soll. Auch nachdem es sich etwas in der Welt des November 2012 orientiert hat, wird es nicht schlauer. Es ist etwas verwundert, dass so wenig jüdisches Leben sichtbar ist und dass Deutschland im Gegensatz zu den meisten west- und nordeuropäischen Staaten keine Monarchie mehr ist. Davon abgesehen, ist die Welt aber ziemlich genau so, wie sie der Vorstellungswelt ihrer Zeit entspricht: Die technischen Neuerungen sind in etwa so, wie es "Der Tunnel" ein Bestseller von 1913, vorhergesagt hatten. Im deutschen Parlament gibt es nur noch sozialdemokratische Parteien; die rechtliche Gleichheit der Geschlechter ist weitgehend hergestellt; Deutschland ist der mächtigste Staat des Kontinents, ohne ihn zu dominieren, während die eigentliche weltpolitische Macht nun bei außereuropäischen Großmächten liegt.
Erst als unser wilhelminisches Dornröschen durch die Geschichtsabteilung einer Buchhandlung stöbert, geht ihm auf, dass es den Horror des kurzen zwanzigsten Jahrhunderts mit seinen Kriegen und dem schrecklichen Weltkrieg dreier Ideologien verschlafen hat. Natürlich war es nicht so, als ob künftige Kriege jenseits der Vorstellungskraft der Menschen 1913 gelegen hätten. Beispielsweise erinnert uns Florian Illies daran, dass Rudolf Steiner an seine Mutter schrieb: "Und der Krieg droht fortwährend zu kommen." Aber die Kriegserwartungen des frühen zwanzigsten Jahrhunderts nahmen selten die Form apokalyptischer, Zeitenwende bringender Kriege an.
Vor allem aber waren es am wenigsten diejenigen Personengruppen, die nach Kriegsausbruch 1914 am bereitwilligsten mit Waffengewalt ihre Staaten verteidigen würden (wie zum Beispiel Studenten an Elitekaderschmieden), die 1913 überhaupt eine Kriegserwartung hatten. So bogen sich die britischen Mitstudenten des späteren Historikers Lewis Namier vor Lachen, als er ihnen gegenüber nach seiner Rückkehr nach Oxford von einer Reise in seine osteuropäische Heimat erklärte: "Ein europäischer Krieg steht uns demnächst bevor." Auch die Finanz-, Staatsanleihen- und Aktienmärkte, an denen wir Unruhe bei einer öffentlich wahrgenommenen und ernst zu nehmenden Kriegsgefahr am ehesten erwarten würden, verhielten sich 1913 weitgehend ruhig.
Gerade in Deutschland schien eine Kriegsgefahr im Jahr 1913 aus zwei Gründen gebannt: Zum einen war im Vorjahr das Flottenwettrüsten mit Großbritannien ad acta gelegt worden. Zum anderen erschien 1913 die Broschüre "Weltpolitik und kein Krieg", die die politische Richtung des deutschen Reichskanzlers Theobald von Bethmann Hollweg auf den Punkt brachte. Bethmann Hollweg und seine Vertrauten bastelten eifrig daran, dass auch die nächste Generation von Führungskräften gleichsam kosmopolitisch und national denken würden, indem sie zum Beispiel ihre Söhne zum Studium nach Oxford schickten. Noch zwei Wochen vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs erwarteten die Studenten des Heidelberg College, welches am Neckar künftigen britischen Verwaltungsbeamten und Offizieren den letzten Schliff gab, dass sie alsbald ihre deutschen Zeitgenossen nicht etwa im Schützengraben, sondern bei der nächsten Ruderregatta bekämpfen müssten, wo sie hofften, sich gegen " ,our friend, the enemy' " durchzusetzen.
Die kosmopolitischen Nationalisten, die wir in Berlin und London, in Oxford und Heidelberg und anderswo fanden, frönten einem Gartenpartymilitarismus, der nicht gegen einen konkreten Gegner gerichtet war, und sie akzeptierten Kriege, solange sie begrenzt waren, als Mittel der Politik. Sie standen in einer Tradition von Entscheidungsträgern, die in dem Jahrhundert seit dem Wiener Kongress versucht hatten, militärische Macht immer nur begrenzt einzusetzen: und so der Welt die längste relative Friedensperiode seit Menschengedenken eingebracht hatten. Natürlich hatte es in der Dekade vor 1913 politische Krisen auf der internationalen Bühne noch und nöcher gegeben. Aber das Erstaunliche an diesen Krisen war nicht, dass es sie gab, sondern dass fast alle friedlich beigelegt wurden.
Der Erfolg von Ricarda Huchs "Der große Krieg in Deutschland" war daher kein Vorzeichen der nahenden Apokalypse. Im Gegenteil war er ein Ausdruck des unbedingten Verlangens, totalen Krieg zu verhindern. Begrenzte Kriege wurden daher von vielen akzeptiert, nicht weil sie einen entgrenzten und totalen Krieg nach Muster des Ersten Weltkrieges wollten, sondern weil sie ihn fürchteten.
Für viele Deutsche ging die Aversion gegen Krieg sogar weiter. General Friedrich von Bernhardi hatte 1912 sein Buch "Deutschland und der nächste Krieg" herausgebracht, nicht etwa weil seine sozialdarwinistischen Ideen über die reinigende Kraft des Krieges so populär gewesen wären, sondern weil Bernhardi wusste, dass er die Mehrheit der Deutschen erst von diesen Ideen überzeugen müsste. So ereiferte er sich darüber, dass die deutsche Öffentlichkeit viel zu pazifistisch sei. Sein Buch änderte wenig daran, denn die wenigsten Deutschen wollten es kaufen.
Bei Florian Illies tauchen die politischen Mentalitäten von Entscheidungsträgern oder von der Mehrheitsbevölkerung nur am Rande auf, aber sie werden bei ihm nie eindimensional vom Fluchtpunkt des Kriegsausbruchs 1914 aus dargestellt. Natürlich ist sein Buch voll an Hinweisen, dass sich die Menschen 1913 in einer Zeit des Umbruchs sahen. Illies lässt aber offen, wohin sich die Zeit entwickelt. Er lässt keinen Zweifel daran, dass auch im Dezember 1913 die Welt nicht beinahe unweigerlich auf den Abgrund zusteuert: "Alles ist offen: die Zukunft und die Lippen der schönen Frauen."
Der Autorin der angeblichen Vorahnung der Epoche der Weltkriege, Ricarda Huch, war jedenfalls nicht mulmig gewesen, als sie "Der große Krieg in Deutschland" schrieb. Sie wurde 1914 vom Krieg völlig überrascht. "Als der Weltkrieg ausbrach", erklärte Huch, "war das für mich ein ganz willkürliches Geschehen, einem Gewitter im Winter ähnlich." Im Gegensatz zu Kafka, Jung oder Freud, aber ähnlich der meisten ihrer Zeitgenossen, war Huch zu normalen zwischenmenschlichen Beziehungen fähig und war auch nicht in den Fängen von starken Depressionen und Albträumen. Dies macht Huchs Leben sicherlich weniger dramatisch und lesenswert, dafür aber letztlich aussagekräftiger für das Zeitgefühl des Jahres 1913. Im Umkehrschluss heißt dies, dass wir die Untergangsphantasien von so manchem Künstler nicht vorschnell als Vorahnung, sondern eher als Metaphern des tatsächlichen späteren Untergangs sehen sollten.
Letztlich helfen uns aber Wettermetaphern - die ein passives menschliches Verhalten voraussetzen - so wenig, wie es die Träume C. G. Jungs tun, um zu verstehen, wieso der Kriegsausbuch 1914 aus der Sicht des Vorjahres eine mögliche, aber eher unwahrscheinliche Zukunft war. Da hilft schon eher der Untergang der "Titanic" des Jahrs 1912 als Metapher. Denn hier traten menschliches Verhalten und unvorhersehbares Chaos aufeinander und brachten hervor, was äußerst unwahrscheinlich gewesen war, aber dennoch durch das Aufeinandertreffen von Handlungen und Entscheidungen vieler Menschen und durch Zufall möglich wurde. Der Kriegsausbruch 1914 war eine mögliche, aber unwahrscheinliche Zukunft, da die internationalen Beziehungen seit geraumer Zeit schwankungsanfälliger und volatiler geworden waren. Wenn überhaupt, entspricht das Europa des Jahres 2012 viel eher als das Europa der Jahre zwischen 1914 und 1989 den Zukunftserwartungen des Jahres 1913.
Florian Illies: "1913". Der Sommer des Jahrhunderts.
S. Fischer Verlag, Frankfurt a. M. 2012. 320 S., geb., 19,99 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension
Ganz beeindruckt, aber auch ein wenig überwältigt ist Rezensent Hans von Trotha von der geballten Materialmenge, die Florian Illies in seinem Buch über das Vorkriegsjahr 1913 gesammelt, in Anekdoten arrangiert und mit ironischen Kommentaren versehen hat. Man darf dieses Werk nicht als historische Analyse nehmen, sondern muss es bei aller objektiven Faktendichte als höchst subjektive und feuilletonistische Zusammenstellung lesen, die nicht zuletzt auch auf die funkelnde Pointe zugeschnitten ist, meint der Rezensent. Mitunter hagelt es gar zu viele Pointen, um von Trotha zu Sinnen kommen zu lassen. Und er hat hier und da den Eindruck, dass auf "kurzfristige Gefälligkeit" hingearbeitet worden ist. Aber dennoch lässt er sich recht gern vom Glanz des "Arrangements" blenden, wie deutlich wird.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH