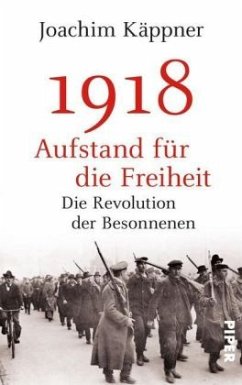Die Revolution der Arbeiter und Soldaten von 1918 war eine historische Chance - dafür, ein demokratisches Deutschland zu schaffen, das stärker gewesen wäre als die Weimarer Republik. In wenigen Tagen erreichen sie, was der Sozialdemokratie in Jahrzehnten nicht gelungen war: die überlebte, autoritäre Ordnung des Kaiserreichs zu stürzen. Es ist die Tragödie der Revolution, dass ihre eigenen Führer sie fürchteten - zu Unrecht. Denn das Ziel der meisten Revolutionäre war nicht, wie es in der Rückschau oft erschien, ein kommunistisches Regime wie in Russland zu errichten. Das Aufbegehren in Deutschland hatte vor allem die Absicht, die alten Eliten der Kaiserzeit zu entmachten, besonders das Militär und die Kriegstreiber von 1914. Für einige wenige Wochen hat die Revolutionsregierung, geführt von der SPD, die Gelegenheit dazu - und nutzt sie nur halbherzig. So bleiben die Todfeinde der deutschen Demokratie mächtig, mit fatalen Folgen für die junge Republik. Joachim Käppner wertet Quellen und neueste Forschungsergebnisse aus und zeichnet ein gerechteres Bild der Arbeiter und Matrosen, die eine Welt aus den Angeln hoben.

Die deutsche Revolution wird hundert Jahre alt. Neues hat die Forschung zwar nicht aufzubieten. Aber die gut informierten Darstellungen zweier Journalisten schlagen sich gut und zeigen Spielräume möglicher Interpretationen.
Angesichts ihres fünfzigsten Jubiläums nahm Joachim C. Fest die Novemberrevolution zum Anlass, um im "Spiegel" die These zu untermauern, wie wenig die Deutschen mit Revolutionen anfangen könnten. Weder "geköpfte Könige noch erschlagene Gauleiter", schon gar "keine Straßenschlachten, keinen Bastillesturm oder siegreich durchgestandenen Verfassungskonflikt" seien Teil des "deutschen Gedächtnisses". Stattdessen bewahre es "eher geniert" Erinnerungen an vereinzelte "halbherzige Erhebungen und einen selbstquälerisch wankelmütigen Widerstand" - "alles in Jammer und Bitternis endend".
Zu dieser Stimmungslage passte 1968 auch eine Artikelserie in der Zeitschrift "Stern" von Sebastian Haffner, die im Folgejahr unter dem Titel "Die verratene Revolution" als Buch erscheinen sollte. Mochte der Publizist die Aufbruchstimmung der Sozialdemokratie in jenem Jahr, als Willy Brandt "mehr Demokratie wagen" wollte, noch so begrüßen, das Agieren Friedrich Eberts und der tonangebenden Mehrheitssozialdemokratie während der Revolution von 1918/19 verdammte er umso heftiger.
Für Wolfgang Niess gehört die Verratsthese, wie sie Haffner in seiner über Jahrzehnte hinweg am besten verkauften Darstellung zu jener Umbruchszeit formulierte, in das Reich der Legenden. Schon der Untertitel seiner Schrift deutet in eine andere Richtung, ist dort doch von dem "wahren Beginn unserer Demokratie" die Rede. Optimismus in der Geschichtsdeutung versprüht auch, zumindest auf den ersten Blick, Joachim Käppners Würdigung des langen Herbstes 1918 als "Aufstand für die Freiheit". Jubiläumstypisches Pathos - Käppner will der Revolution einen Platz in dem "leider wenig besuchten Pantheon" deutscher Freiheitsbewegungen sichern, Niess sich mit "Dankbarkeit, Stolz und Hochachtung" an sie erinnern - kann die kritische Grundhaltung der beiden Autoren nur kurzzeitig überblenden.
Wie Haffner sind sie historisch ausgezeichnet geschulte Journalisten. Sie verstehen es zu schreiben und meiden einen schwerfälligen Wissenschaftsjargon. Niess verzichtet ganz auf einen Anmerkungsapparat, Käppner hält ihn schmal. Beide stützen sich vorrangig auf gedruckte Quellen und Forschungsliteratur, die überwiegend einen vor Jahrzehnten festgefahrenen Debattenstand dokumentiert. Insoweit sind die zwei Darstellungen sorgfältig gearbeitet und befinden sich auf der Höhe der Zeit. Es fragt sich allerdings, ob es für wirklich neue Synthesen über die deutsche Revolution von 1918/19 zu früh ist. Gewiss, das Zentenarium verlangt gerade jetzt nach ihnen, aber Erkenntnisfortschritte zu dieser Umbruchsphase sind rar gesät, nur "zarte Neuansätze" erkennbar, wie Käppner zu Recht einleitend schreibt. Aus ihrem Dornröschenschlaf ist die Revolutionsforschung erst vor kurzem erwacht. Substantielle Studien beispielsweise zur Kultur-, Intellektuellen-, Medien-, Alltags- oder Regionalgeschichte lassen noch auf sich warten.
Vor diesem Hintergrund ist den beiden Autoren kaum vorzuhalten, dass sie sich vorrangig, ergänzt um Rück-, Aus- und Seitenblicke, auf die politischen Vorgänge in Berlin zwischen dem November 1918 und Januar 1919 konzentrieren. Die Revolution entsprang, so Niess, einer "defensiven Grundhaltung" und zielte auf die Beendigung des bereits verlorenen Krieges. Meuternde Matrosen verweigerten einen letzten selbstmörderischen Flottengang. Von der Küste aus erfasste der Aufstand in rasantem Tempo Soldaten wie Arbeiter und verbreitete sich im ganzen Land. Bei Niess ist von einer "elementaren Wucht", bei Käppner von einem "unwiderstehlichen Sog" die Rede. Das sind Sprachbilder für eine weiterhin erklärungsbedürftige Massendynamik im frühen November 1918, die nur wenige Todesopfer forderte. Die "Revolution der Besonnenen" verlief anfangs fast unblutig, Kaiser und Fürsten verabschiedeten sich in aller Stille von ihren Herrschaftsposten.
Am 9. November rief Philipp Scheidemann die Republik aus, am Folgetag schuf die Revolution eigene Regierungsorgane, mit dem Rat der Volksbeauftragten an der Spitze. Dieses Gremium aus Unabhängigen und Mehrheitssozialdemokraten, für Käppner anfangs einer funktionierenden Vernunftehe gleichend, vollzog schon am 12. November eine Reihe von Freiheitsrechten stärkenden, aber auch sozialen Reformen. Am 15. November schrieb das Stinnes-Legien-Abkommen den Gedanken der Sozialpartnerschaft fest und schuf so für Niess frühzeitig eine Grundlage für die spätere Soziale Marktwirtschaft. Auf dem Reichsrätekongress im Dezember triumphierte die MSPD mit der Entscheidung für eine Wahl zur Verfassunggebenden Nationalversammlung am 19. Januar 1919. Die Weimarer Reichsverfassung, wesentlich vom liberalen Staatsrechtslehrer Hugo Preuß erarbeitet, trat bereits Mitte August 1919 in Kraft.
All das ist bekannt und wird in kundiger Weise ein weiteres Mal von Käppner und Niess geschildert. Und doch schreiben sie gerade keine Erfolgsgeschichte einer geradlinigen Begründung der parlamentarischen Demokratie in Deutschland. Diese Sicht gerät sogar in den Hintergrund, die kritische Würdigung des Geschehens überwiegt. Wie das, wo doch so viel in so kurzer Zeit erreicht worden ist?
Hauptadressat ihrer Kritik ist die Führung der Mehrheitssozialdemokraten, so wenig sie mit Tadel für eine radikale Linke sparen. Während die einen jedoch machtvoll agieren konnten, seien die anderen klein und unbedeutend gewesen. In keinem Verhältnis dazu stand die Bolschewismus-Hysterie jener Tage. Die Ausrufung einer sozialistischen Republik durch Karl Liebknecht wenige Stunden nach Scheidemann vom einstigen Herrschaftssitz der Hohenzollern aus nennt Käppner bestenfalls ein "Schlossgespenst". Der Großteil der "Revolutionsbewegung" (ein Begriff, der näher zu begründen wäre) ließ sich schließlich in keiner Weise für bolschewistische Ideen begeistern, hielt dagegen ein großes "Demokratisierungspotential" bereit, das die federführende Sozialdemokratie nicht zu nutzen verstand.
Damit greifen beide Autoren Überlegungen auf, wie sie die Debatte rund um Handlungsmöglichkeiten und verpasste Chancen der Novemberrevolution ab Ende der siebziger Jahre prägte. Was die Räte in den ersten Monaten nach dem Ersten Weltkrieg mehrheitlich ablehnten, die Übernahme eines sowjetischen Modells, steht außer Frage. Was sie dagegen befürworteten, worin das Verlangen nach "Demokratisierung" genau bestand, ob und wie Ideen der Räte mit einem parlamentarischen Regierungssystem hätten in Einklang gebracht werden können, das liegt auch bei Käppner und Niess weiter im Halbschatten.
Gleichwohl gelingt es ihnen, ein differenziertes Bild der verschiedenen linken Gruppierungen zu zeichnen. Binäre Schemen - Anhänger einer kommunistischen Diktatur hier, einer liberal-sozialen Demokratie dort - entsprachen nicht dem bunten Potpourri an Ideen und Bestrebungen, ob in den beiden sozialdemokratischen Parteien oder bei den Revolutionären Obleuten. Andere politische Lager finden dagegen weniger Interesse. So entsteht eine Schieflage, die spätestens angesichts des Erfolgs der "Weimarer Koalition" erkennbar wird. Auch wenn sie bereits 1920 wieder zerbrach, hatte sie anfänglich doch große Resonanz im gemäßigt linken und bürgerlich-liberalen Spektrum der Bevölkerung, die eben nicht ausschließlich aus der Arbeiterbewegung bestand.
Mehr Schattierungen weist das Tableau der Akteure wieder auf, sobald die verschiedenen bewaffneten Kräfte während der Revolution in den Blick geraten, von den Freikorps bis zur sagenumwobenen "Volksmarinedivision", in der Käppner eine "Schutztruppe der Revolution und der Einheitsregierung" ausmacht. Dies habe die MSPD verkannt, wie sie überhaupt von einer "Furcht vor den eigenen Anhängern" gekennzeichnet gewesen sei.
Die militärische Machtfrage bildet den Dreh- und Angelpunkt seiner Darstellung. Gleich an mehreren Stellen führt Käppner als die "alles entscheidende Gretchenfrage" an: "Wie hältst du's mit dem Militär?" Aus "Mangel an Weitsicht und Selbstbewusstsein" sei die entscheidende Gelegenheit ausgelassen worden, dem "deutschen Militarismus den Garaus zu machen" und eine republikanische Armee zu schaffen. Dies habe spätestens ab der Jahreswende 1918/19 blutige Gewalt und "weißen Terror" begünstigt, mit der Ermordung Luxemburgs und Liebknechts als Fanal, und sei der eigentliche "Sündenfall" gewesen. Vieles spricht dafür, in der ausgebliebenen Militärreform, von Niess ebenfalls beklagt, ein zentrales Manko zu erkennen. Antworten auf die Fragen, ob sie ohne weiteres möglich gewesen wäre und welche Auswirkungen sie gehabt hätte, verbleiben indes überwiegend im Reich des Kontrafaktischen. Der oft zum Beleg angeführte Parallelfall Österreichs zeigt schließlich, wie wenig es der dort eingeführten "Volkswehr" gelang, zu einem Heer oberhalb der Parteien aufzusteigen und die Bildung paramilitärischer "Heimwehren" einzudämmen.
Käppner und Niess gehen unterschiedlich hart mit der Mehrheitssozialdemokratie ins Gericht. Niess fällt ein milderes Urteil, nennt Ebert, dem Käppner immerhin einen "Willen aus Edelstahl" zuschreibt und schwierige Startbedingungen zugutehält, einen überzeugten Republikaner. Er stellt der Denkfigur der verpassten Chancen jene der ausgebliebenen Katastrophe gegenüber: "Es hätte manches besser laufen können - es hätte aber auch viel schlimmer kommen können." Für Käppner hingegen ist der "Aufstand für Frieden und Freiheit ausgerechnet an der SPD gescheitert", die im Kaiserreich "unter großen Opfern für ebendiese Werte" gekämpft habe. Auch ohne Übernahme des Verratsvorwurfs, mit größerem Verständnis und weniger Polemik, steckt gerade in Käppners Schrift mehr Haffner, als ihr Autor wohl zugeben mag.
Für die unzweideutige Erzählung von einer demokratischen Grundlegung taugt die Revolution von 1918/19 angesichts dieser beiden kritischen Bestandsaufnahmen nur bedingt. In der Haut des Bundespräsidenten und anderer Festtagsredner möchte man im Herbst 2018 nicht stecken. Es wird aber schon nicht alles in Jammer und Bitternis enden. Ein gehöriges Maß an erinnerungspolitischem Frohmut dürfen wir erwarten, auch eine hoffentlich wachgerüttelte Revolutionsforschung, die nicht gleich im ersten Jahr nach dem runden Geburtstag wieder entschlummern möge. Schließlich hat sie noch viele neue Wege zu erkunden.
ALEXANDER GALLUS
Joachim Käppner: "1918". Aufstand für die Freiheit. Die Revolution der Besonnenen.
Piper Verlag, München 2017.
524 S., geb., 28,- [Euro].
Wolfgang Niess: "Die Revolution von 1918/19". Der wahre Beginn unserer Demokratie.
Europa Verlag, München 2017.
463 S., geb., 24,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
"Ein kenntnisreiches, gut lesbares Buch, das die Leistungen der revolutionären Soldaten und Arbeiter betont.", ZEIT Geschichte, 06.11.2018
Hätte besser laufen können
Die deutsche Revolution wird hundert Jahre alt. Neues hat die Forschung zwar nicht aufzubieten. Aber die gut informierten Darstellungen zweier Journalisten schlagen sich gut und zeigen Spielräume möglicher Interpretationen.
Angesichts ihres fünfzigsten Jubiläums nahm Joachim C. Fest die Novemberrevolution zum Anlass, um im "Spiegel" die These zu untermauern, wie wenig die Deutschen mit Revolutionen anfangen könnten. Weder "geköpfte Könige noch erschlagene Gauleiter", schon gar "keine Straßenschlachten, keinen Bastillesturm oder siegreich durchgestandenen Verfassungskonflikt" seien Teil des "deutschen Gedächtnisses". Stattdessen bewahre es "eher geniert" Erinnerungen an vereinzelte "halbherzige Erhebungen und einen selbstquälerisch wankelmütigen Widerstand" - "alles in Jammer und Bitternis endend".
Zu dieser Stimmungslage passte 1968 auch eine Artikelserie in der Zeitschrift "Stern" von Sebastian Haffner, die im Folgejahr unter dem Titel "Die verratene Revolution" als Buch erscheinen sollte. Mochte der Publizist die Aufbruchstimmung der Sozialdemokratie in jenem Jahr, als Willy Brandt "mehr Demokratie wagen" wollte, noch so begrüßen, das Agieren Friedrich Eberts und der tonangebenden Mehrheitssozialdemokratie während der Revolution von 1918/19 verdammte er umso heftiger.
Für Wolfgang Niess gehört die Verratsthese, wie sie Haffner in seiner über Jahrzehnte hinweg am besten verkauften Darstellung zu jener Umbruchszeit formulierte, in das Reich der Legenden. Schon der Untertitel seiner Schrift deutet in eine andere Richtung, ist dort doch von dem "wahren Beginn unserer Demokratie" die Rede. Optimismus in der Geschichtsdeutung versprüht auch, zumindest auf den ersten Blick, Joachim Käppners Würdigung des langen Herbstes 1918 als "Aufstand für die Freiheit". Jubiläumstypisches Pathos - Käppner will der Revolution einen Platz in dem "leider wenig besuchten Pantheon" deutscher Freiheitsbewegungen sichern, Niess sich mit "Dankbarkeit, Stolz und Hochachtung" an sie erinnern - kann die kritische Grundhaltung der beiden Autoren nur kurzzeitig überblenden.
Wie Haffner sind sie historisch ausgezeichnet geschulte Journalisten. Sie verstehen es zu schreiben und meiden einen schwerfälligen Wissenschaftsjargon. Niess verzichtet ganz auf einen Anmerkungsapparat, Käppner hält ihn schmal. Beide stützen sich vorrangig auf gedruckte Quellen und Forschungsliteratur, die überwiegend einen vor Jahrzehnten festgefahrenen Debattenstand dokumentiert. Insoweit sind die zwei Darstellungen sorgfältig gearbeitet und befinden sich auf der Höhe der Zeit. Es fragt sich allerdings, ob es für wirklich neue Synthesen über die deutsche Revolution von 1918/19 zu früh ist. Gewiss, das Zentenarium verlangt gerade jetzt nach ihnen, aber Erkenntnisfortschritte zu dieser Umbruchsphase sind rar gesät, nur "zarte Neuansätze" erkennbar, wie Käppner zu Recht einleitend schreibt. Aus ihrem Dornröschenschlaf ist die Revolutionsforschung erst vor kurzem erwacht. Substantielle Studien beispielsweise zur Kultur-, Intellektuellen-, Medien-, Alltags- oder Regionalgeschichte lassen noch auf sich warten.
Vor diesem Hintergrund ist den beiden Autoren kaum vorzuhalten, dass sie sich vorrangig, ergänzt um Rück-, Aus- und Seitenblicke, auf die politischen Vorgänge in Berlin zwischen dem November 1918 und Januar 1919 konzentrieren. Die Revolution entsprang, so Niess, einer "defensiven Grundhaltung" und zielte auf die Beendigung des bereits verlorenen Krieges. Meuternde Matrosen verweigerten einen letzten selbstmörderischen Flottengang. Von der Küste aus erfasste der Aufstand in rasantem Tempo Soldaten wie Arbeiter und verbreitete sich im ganzen Land. Bei Niess ist von einer "elementaren Wucht", bei Käppner von einem "unwiderstehlichen Sog" die Rede. Das sind Sprachbilder für eine weiterhin erklärungsbedürftige Massendynamik im frühen November 1918, die nur wenige Todesopfer forderte. Die "Revolution der Besonnenen" verlief anfangs fast unblutig, Kaiser und Fürsten verabschiedeten sich in aller Stille von ihren Herrschaftsposten.
Am 9. November rief Philipp Scheidemann die Republik aus, am Folgetag schuf die Revolution eigene Regierungsorgane, mit dem Rat der Volksbeauftragten an der Spitze. Dieses Gremium aus Unabhängigen und Mehrheitssozialdemokraten, für Käppner anfangs einer funktionierenden Vernunftehe gleichend, vollzog schon am 12. November eine Reihe von Freiheitsrechten stärkenden, aber auch sozialen Reformen. Am 15. November schrieb das Stinnes-Legien-Abkommen den Gedanken der Sozialpartnerschaft fest und schuf so für Niess frühzeitig eine Grundlage für die spätere Soziale Marktwirtschaft. Auf dem Reichsrätekongress im Dezember triumphierte die MSPD mit der Entscheidung für eine Wahl zur Verfassunggebenden Nationalversammlung am 19. Januar 1919. Die Weimarer Reichsverfassung, wesentlich vom liberalen Staatsrechtslehrer Hugo Preuß erarbeitet, trat bereits Mitte August 1919 in Kraft.
All das ist bekannt und wird in kundiger Weise ein weiteres Mal von Käppner und Niess geschildert. Und doch schreiben sie gerade keine Erfolgsgeschichte einer geradlinigen Begründung der parlamentarischen Demokratie in Deutschland. Diese Sicht gerät sogar in den Hintergrund, die kritische Würdigung des Geschehens überwiegt. Wie das, wo doch so viel in so kurzer Zeit erreicht worden ist?
Hauptadressat ihrer Kritik ist die Führung der Mehrheitssozialdemokraten, so wenig sie mit Tadel für eine radikale Linke sparen. Während die einen jedoch machtvoll agieren konnten, seien die anderen klein und unbedeutend gewesen. In keinem Verhältnis dazu stand die Bolschewismus-Hysterie jener Tage. Die Ausrufung einer sozialistischen Republik durch Karl Liebknecht wenige Stunden nach Scheidemann vom einstigen Herrschaftssitz der Hohenzollern aus nennt Käppner bestenfalls ein "Schlossgespenst". Der Großteil der "Revolutionsbewegung" (ein Begriff, der näher zu begründen wäre) ließ sich schließlich in keiner Weise für bolschewistische Ideen begeistern, hielt dagegen ein großes "Demokratisierungspotential" bereit, das die federführende Sozialdemokratie nicht zu nutzen verstand.
Damit greifen beide Autoren Überlegungen auf, wie sie die Debatte rund um Handlungsmöglichkeiten und verpasste Chancen der Novemberrevolution ab Ende der siebziger Jahre prägte. Was die Räte in den ersten Monaten nach dem Ersten Weltkrieg mehrheitlich ablehnten, die Übernahme eines sowjetischen Modells, steht außer Frage. Was sie dagegen befürworteten, worin das Verlangen nach "Demokratisierung" genau bestand, ob und wie Ideen der Räte mit einem parlamentarischen Regierungssystem hätten in Einklang gebracht werden können, das liegt auch bei Käppner und Niess weiter im Halbschatten.
Gleichwohl gelingt es ihnen, ein differenziertes Bild der verschiedenen linken Gruppierungen zu zeichnen. Binäre Schemen - Anhänger einer kommunistischen Diktatur hier, einer liberal-sozialen Demokratie dort - entsprachen nicht dem bunten Potpourri an Ideen und Bestrebungen, ob in den beiden sozialdemokratischen Parteien oder bei den Revolutionären Obleuten. Andere politische Lager finden dagegen weniger Interesse. So entsteht eine Schieflage, die spätestens angesichts des Erfolgs der "Weimarer Koalition" erkennbar wird. Auch wenn sie bereits 1920 wieder zerbrach, hatte sie anfänglich doch große Resonanz im gemäßigt linken und bürgerlich-liberalen Spektrum der Bevölkerung, die eben nicht ausschließlich aus der Arbeiterbewegung bestand.
Mehr Schattierungen weist das Tableau der Akteure wieder auf, sobald die verschiedenen bewaffneten Kräfte während der Revolution in den Blick geraten, von den Freikorps bis zur sagenumwobenen "Volksmarinedivision", in der Käppner eine "Schutztruppe der Revolution und der Einheitsregierung" ausmacht. Dies habe die MSPD verkannt, wie sie überhaupt von einer "Furcht vor den eigenen Anhängern" gekennzeichnet gewesen sei.
Die militärische Machtfrage bildet den Dreh- und Angelpunkt seiner Darstellung. Gleich an mehreren Stellen führt Käppner als die "alles entscheidende Gretchenfrage" an: "Wie hältst du's mit dem Militär?" Aus "Mangel an Weitsicht und Selbstbewusstsein" sei die entscheidende Gelegenheit ausgelassen worden, dem "deutschen Militarismus den Garaus zu machen" und eine republikanische Armee zu schaffen. Dies habe spätestens ab der Jahreswende 1918/19 blutige Gewalt und "weißen Terror" begünstigt, mit der Ermordung Luxemburgs und Liebknechts als Fanal, und sei der eigentliche "Sündenfall" gewesen. Vieles spricht dafür, in der ausgebliebenen Militärreform, von Niess ebenfalls beklagt, ein zentrales Manko zu erkennen. Antworten auf die Fragen, ob sie ohne weiteres möglich gewesen wäre und welche Auswirkungen sie gehabt hätte, verbleiben indes überwiegend im Reich des Kontrafaktischen. Der oft zum Beleg angeführte Parallelfall Österreichs zeigt schließlich, wie wenig es der dort eingeführten "Volkswehr" gelang, zu einem Heer oberhalb der Parteien aufzusteigen und die Bildung paramilitärischer "Heimwehren" einzudämmen.
Käppner und Niess gehen unterschiedlich hart mit der Mehrheitssozialdemokratie ins Gericht. Niess fällt ein milderes Urteil, nennt Ebert, dem Käppner immerhin einen "Willen aus Edelstahl" zuschreibt und schwierige Startbedingungen zugutehält, einen überzeugten Republikaner. Er stellt der Denkfigur der verpassten Chancen jene der ausgebliebenen Katastrophe gegenüber: "Es hätte manches besser laufen können - es hätte aber auch viel schlimmer kommen können." Für Käppner hingegen ist der "Aufstand für Frieden und Freiheit ausgerechnet an der SPD gescheitert", die im Kaiserreich "unter großen Opfern für ebendiese Werte" gekämpft habe. Auch ohne Übernahme des Verratsvorwurfs, mit größerem Verständnis und weniger Polemik, steckt gerade in Käppners Schrift mehr Haffner, als ihr Autor wohl zugeben mag.
Für die unzweideutige Erzählung von einer demokratischen Grundlegung taugt die Revolution von 1918/19 angesichts dieser beiden kritischen Bestandsaufnahmen nur bedingt. In der Haut des Bundespräsidenten und anderer Festtagsredner möchte man im Herbst 2018 nicht stecken. Es wird aber schon nicht alles in Jammer und Bitternis enden. Ein gehöriges Maß an erinnerungspolitischem Frohmut dürfen wir erwarten, auch eine hoffentlich wachgerüttelte Revolutionsforschung, die nicht gleich im ersten Jahr nach dem runden Geburtstag wieder entschlummern möge. Schließlich hat sie noch viele neue Wege zu erkunden.
ALEXANDER GALLUS
Joachim Käppner: "1918". Aufstand für die Freiheit. Die Revolution der Besonnenen.
Piper Verlag, München 2017.
524 S., geb., 28,- [Euro].
Wolfgang Niess: "Die Revolution von 1918/19". Der wahre Beginn unserer Demokratie.
Europa Verlag, München 2017.
463 S., geb., 24,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Die deutsche Revolution wird hundert Jahre alt. Neues hat die Forschung zwar nicht aufzubieten. Aber die gut informierten Darstellungen zweier Journalisten schlagen sich gut und zeigen Spielräume möglicher Interpretationen.
Angesichts ihres fünfzigsten Jubiläums nahm Joachim C. Fest die Novemberrevolution zum Anlass, um im "Spiegel" die These zu untermauern, wie wenig die Deutschen mit Revolutionen anfangen könnten. Weder "geköpfte Könige noch erschlagene Gauleiter", schon gar "keine Straßenschlachten, keinen Bastillesturm oder siegreich durchgestandenen Verfassungskonflikt" seien Teil des "deutschen Gedächtnisses". Stattdessen bewahre es "eher geniert" Erinnerungen an vereinzelte "halbherzige Erhebungen und einen selbstquälerisch wankelmütigen Widerstand" - "alles in Jammer und Bitternis endend".
Zu dieser Stimmungslage passte 1968 auch eine Artikelserie in der Zeitschrift "Stern" von Sebastian Haffner, die im Folgejahr unter dem Titel "Die verratene Revolution" als Buch erscheinen sollte. Mochte der Publizist die Aufbruchstimmung der Sozialdemokratie in jenem Jahr, als Willy Brandt "mehr Demokratie wagen" wollte, noch so begrüßen, das Agieren Friedrich Eberts und der tonangebenden Mehrheitssozialdemokratie während der Revolution von 1918/19 verdammte er umso heftiger.
Für Wolfgang Niess gehört die Verratsthese, wie sie Haffner in seiner über Jahrzehnte hinweg am besten verkauften Darstellung zu jener Umbruchszeit formulierte, in das Reich der Legenden. Schon der Untertitel seiner Schrift deutet in eine andere Richtung, ist dort doch von dem "wahren Beginn unserer Demokratie" die Rede. Optimismus in der Geschichtsdeutung versprüht auch, zumindest auf den ersten Blick, Joachim Käppners Würdigung des langen Herbstes 1918 als "Aufstand für die Freiheit". Jubiläumstypisches Pathos - Käppner will der Revolution einen Platz in dem "leider wenig besuchten Pantheon" deutscher Freiheitsbewegungen sichern, Niess sich mit "Dankbarkeit, Stolz und Hochachtung" an sie erinnern - kann die kritische Grundhaltung der beiden Autoren nur kurzzeitig überblenden.
Wie Haffner sind sie historisch ausgezeichnet geschulte Journalisten. Sie verstehen es zu schreiben und meiden einen schwerfälligen Wissenschaftsjargon. Niess verzichtet ganz auf einen Anmerkungsapparat, Käppner hält ihn schmal. Beide stützen sich vorrangig auf gedruckte Quellen und Forschungsliteratur, die überwiegend einen vor Jahrzehnten festgefahrenen Debattenstand dokumentiert. Insoweit sind die zwei Darstellungen sorgfältig gearbeitet und befinden sich auf der Höhe der Zeit. Es fragt sich allerdings, ob es für wirklich neue Synthesen über die deutsche Revolution von 1918/19 zu früh ist. Gewiss, das Zentenarium verlangt gerade jetzt nach ihnen, aber Erkenntnisfortschritte zu dieser Umbruchsphase sind rar gesät, nur "zarte Neuansätze" erkennbar, wie Käppner zu Recht einleitend schreibt. Aus ihrem Dornröschenschlaf ist die Revolutionsforschung erst vor kurzem erwacht. Substantielle Studien beispielsweise zur Kultur-, Intellektuellen-, Medien-, Alltags- oder Regionalgeschichte lassen noch auf sich warten.
Vor diesem Hintergrund ist den beiden Autoren kaum vorzuhalten, dass sie sich vorrangig, ergänzt um Rück-, Aus- und Seitenblicke, auf die politischen Vorgänge in Berlin zwischen dem November 1918 und Januar 1919 konzentrieren. Die Revolution entsprang, so Niess, einer "defensiven Grundhaltung" und zielte auf die Beendigung des bereits verlorenen Krieges. Meuternde Matrosen verweigerten einen letzten selbstmörderischen Flottengang. Von der Küste aus erfasste der Aufstand in rasantem Tempo Soldaten wie Arbeiter und verbreitete sich im ganzen Land. Bei Niess ist von einer "elementaren Wucht", bei Käppner von einem "unwiderstehlichen Sog" die Rede. Das sind Sprachbilder für eine weiterhin erklärungsbedürftige Massendynamik im frühen November 1918, die nur wenige Todesopfer forderte. Die "Revolution der Besonnenen" verlief anfangs fast unblutig, Kaiser und Fürsten verabschiedeten sich in aller Stille von ihren Herrschaftsposten.
Am 9. November rief Philipp Scheidemann die Republik aus, am Folgetag schuf die Revolution eigene Regierungsorgane, mit dem Rat der Volksbeauftragten an der Spitze. Dieses Gremium aus Unabhängigen und Mehrheitssozialdemokraten, für Käppner anfangs einer funktionierenden Vernunftehe gleichend, vollzog schon am 12. November eine Reihe von Freiheitsrechten stärkenden, aber auch sozialen Reformen. Am 15. November schrieb das Stinnes-Legien-Abkommen den Gedanken der Sozialpartnerschaft fest und schuf so für Niess frühzeitig eine Grundlage für die spätere Soziale Marktwirtschaft. Auf dem Reichsrätekongress im Dezember triumphierte die MSPD mit der Entscheidung für eine Wahl zur Verfassunggebenden Nationalversammlung am 19. Januar 1919. Die Weimarer Reichsverfassung, wesentlich vom liberalen Staatsrechtslehrer Hugo Preuß erarbeitet, trat bereits Mitte August 1919 in Kraft.
All das ist bekannt und wird in kundiger Weise ein weiteres Mal von Käppner und Niess geschildert. Und doch schreiben sie gerade keine Erfolgsgeschichte einer geradlinigen Begründung der parlamentarischen Demokratie in Deutschland. Diese Sicht gerät sogar in den Hintergrund, die kritische Würdigung des Geschehens überwiegt. Wie das, wo doch so viel in so kurzer Zeit erreicht worden ist?
Hauptadressat ihrer Kritik ist die Führung der Mehrheitssozialdemokraten, so wenig sie mit Tadel für eine radikale Linke sparen. Während die einen jedoch machtvoll agieren konnten, seien die anderen klein und unbedeutend gewesen. In keinem Verhältnis dazu stand die Bolschewismus-Hysterie jener Tage. Die Ausrufung einer sozialistischen Republik durch Karl Liebknecht wenige Stunden nach Scheidemann vom einstigen Herrschaftssitz der Hohenzollern aus nennt Käppner bestenfalls ein "Schlossgespenst". Der Großteil der "Revolutionsbewegung" (ein Begriff, der näher zu begründen wäre) ließ sich schließlich in keiner Weise für bolschewistische Ideen begeistern, hielt dagegen ein großes "Demokratisierungspotential" bereit, das die federführende Sozialdemokratie nicht zu nutzen verstand.
Damit greifen beide Autoren Überlegungen auf, wie sie die Debatte rund um Handlungsmöglichkeiten und verpasste Chancen der Novemberrevolution ab Ende der siebziger Jahre prägte. Was die Räte in den ersten Monaten nach dem Ersten Weltkrieg mehrheitlich ablehnten, die Übernahme eines sowjetischen Modells, steht außer Frage. Was sie dagegen befürworteten, worin das Verlangen nach "Demokratisierung" genau bestand, ob und wie Ideen der Räte mit einem parlamentarischen Regierungssystem hätten in Einklang gebracht werden können, das liegt auch bei Käppner und Niess weiter im Halbschatten.
Gleichwohl gelingt es ihnen, ein differenziertes Bild der verschiedenen linken Gruppierungen zu zeichnen. Binäre Schemen - Anhänger einer kommunistischen Diktatur hier, einer liberal-sozialen Demokratie dort - entsprachen nicht dem bunten Potpourri an Ideen und Bestrebungen, ob in den beiden sozialdemokratischen Parteien oder bei den Revolutionären Obleuten. Andere politische Lager finden dagegen weniger Interesse. So entsteht eine Schieflage, die spätestens angesichts des Erfolgs der "Weimarer Koalition" erkennbar wird. Auch wenn sie bereits 1920 wieder zerbrach, hatte sie anfänglich doch große Resonanz im gemäßigt linken und bürgerlich-liberalen Spektrum der Bevölkerung, die eben nicht ausschließlich aus der Arbeiterbewegung bestand.
Mehr Schattierungen weist das Tableau der Akteure wieder auf, sobald die verschiedenen bewaffneten Kräfte während der Revolution in den Blick geraten, von den Freikorps bis zur sagenumwobenen "Volksmarinedivision", in der Käppner eine "Schutztruppe der Revolution und der Einheitsregierung" ausmacht. Dies habe die MSPD verkannt, wie sie überhaupt von einer "Furcht vor den eigenen Anhängern" gekennzeichnet gewesen sei.
Die militärische Machtfrage bildet den Dreh- und Angelpunkt seiner Darstellung. Gleich an mehreren Stellen führt Käppner als die "alles entscheidende Gretchenfrage" an: "Wie hältst du's mit dem Militär?" Aus "Mangel an Weitsicht und Selbstbewusstsein" sei die entscheidende Gelegenheit ausgelassen worden, dem "deutschen Militarismus den Garaus zu machen" und eine republikanische Armee zu schaffen. Dies habe spätestens ab der Jahreswende 1918/19 blutige Gewalt und "weißen Terror" begünstigt, mit der Ermordung Luxemburgs und Liebknechts als Fanal, und sei der eigentliche "Sündenfall" gewesen. Vieles spricht dafür, in der ausgebliebenen Militärreform, von Niess ebenfalls beklagt, ein zentrales Manko zu erkennen. Antworten auf die Fragen, ob sie ohne weiteres möglich gewesen wäre und welche Auswirkungen sie gehabt hätte, verbleiben indes überwiegend im Reich des Kontrafaktischen. Der oft zum Beleg angeführte Parallelfall Österreichs zeigt schließlich, wie wenig es der dort eingeführten "Volkswehr" gelang, zu einem Heer oberhalb der Parteien aufzusteigen und die Bildung paramilitärischer "Heimwehren" einzudämmen.
Käppner und Niess gehen unterschiedlich hart mit der Mehrheitssozialdemokratie ins Gericht. Niess fällt ein milderes Urteil, nennt Ebert, dem Käppner immerhin einen "Willen aus Edelstahl" zuschreibt und schwierige Startbedingungen zugutehält, einen überzeugten Republikaner. Er stellt der Denkfigur der verpassten Chancen jene der ausgebliebenen Katastrophe gegenüber: "Es hätte manches besser laufen können - es hätte aber auch viel schlimmer kommen können." Für Käppner hingegen ist der "Aufstand für Frieden und Freiheit ausgerechnet an der SPD gescheitert", die im Kaiserreich "unter großen Opfern für ebendiese Werte" gekämpft habe. Auch ohne Übernahme des Verratsvorwurfs, mit größerem Verständnis und weniger Polemik, steckt gerade in Käppners Schrift mehr Haffner, als ihr Autor wohl zugeben mag.
Für die unzweideutige Erzählung von einer demokratischen Grundlegung taugt die Revolution von 1918/19 angesichts dieser beiden kritischen Bestandsaufnahmen nur bedingt. In der Haut des Bundespräsidenten und anderer Festtagsredner möchte man im Herbst 2018 nicht stecken. Es wird aber schon nicht alles in Jammer und Bitternis enden. Ein gehöriges Maß an erinnerungspolitischem Frohmut dürfen wir erwarten, auch eine hoffentlich wachgerüttelte Revolutionsforschung, die nicht gleich im ersten Jahr nach dem runden Geburtstag wieder entschlummern möge. Schließlich hat sie noch viele neue Wege zu erkunden.
ALEXANDER GALLUS
Joachim Käppner: "1918". Aufstand für die Freiheit. Die Revolution der Besonnenen.
Piper Verlag, München 2017.
524 S., geb., 28,- [Euro].
Wolfgang Niess: "Die Revolution von 1918/19". Der wahre Beginn unserer Demokratie.
Europa Verlag, München 2017.
463 S., geb., 24,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main