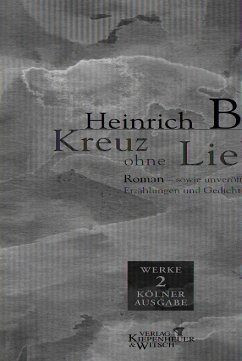Kreuz ohne Liebe ist Bölls erster großer literarischer Text nach dem Krieg und steht unmittelbar unter dem Eindruck der Ereignisse. Erzählt wird die Geschichte der Brüder Hans und Christoph Bachem in den Jahren zwischen 1932 und 1946. Beide gehen unterschiedliche Wege, die sich an der Ostfront kreuzen. Während Hans sich begeistert der nationalsozialistischen Bewegung verschreibt und in die SS eintritt, widersetzt sich Christoph aus christlichem Geiste Militarismus und Unmenschlichkeit. Doch bleibt auch ihm der Kriegseinsatz nicht erspart. Böll zeigt den militärischen Drill in der Kaserne, die Schrecken des Kampfeinsatzes und die Versuche, sich dagegen zu behaupten, mit einer Präzision, die sich eigener Anschauung verdankt. Dabei gelingt ihm ein spannungsgeladener Roman, der in der Wiederbegegnung der beiden miteinander zerstrittenen Brüder an der Ostfront gipfelt.
Weitere Inhalte:Mitleid · Der Flüchtling · Rendezvous in Trümmern · Wiedersehen mit B. · Der Zwischenfall · Gefangen in Paris · Der Schulschwänzer · Kreuz ohne Liebe · Kommentar.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Der Autor als Fußsoldat: Heinrich Böll in der Kölner Ausgabe
Man muß sich Heinrich Böll als Zwilling Ernst Jüngers vorstellen. Das Gedankenexperiment spielt im Winter 2017: In seinem Eifelhaus feiert der Kettenraucher seinen Hundertsten. Staatskarossen fahren in Langenbroich vor. Der Gesandte des Vatikans würdigt Bölls Einsatz für den Weltfrieden, Karl Heinz Bohrer bekennt als Festredner seine geheime Liebe zum "Irischen Tagebuch", und Heinrich-Böll-Preisträger Rainald Goetz zitiert jenen Abschnitt seines 1983 geschriebenen Romans "Irre", in welchem "Herr Be" noch als Anführer einer ältlichen "Peinsackparade" auftritt.
Erfolgreiche Wiederentdeckungen setzen immer die Verfremdung ihres Gegenstandes voraus. Im Falle Ernst Jüngers, zuvor als Gewaltverherrlicher abgestempelt, schuf das unwahrscheinliche Lebensalter des Autors die richtige Distanz für neugierige Beobachter. Daß eine gescheite Gesamtausgabe im Falle Bölls, als Friedensbringer des Deutschunterrichts verharmlost, einen vergleichbaren Einschnitt in der Rezeptionsgeschichte zeitigt, bleibt wohl ein Germanistentraum. Dennoch bieten bereits die ersten drei Bände der neuen Kölner Ausgabe in ihrem dunkelroten Leineneinband einen guten Abstandhalter zu jenen Taschenbüchern, denen der pädagogisch wertvolle Vorlesestoff bereits an den handkolorierten Titelbildern anzusehen war.
Immerhin teilt Heinrich Böll mit Ernst Jünger, den er im Lesehunger der Kriegsjahre ausgiebig las, das Schicksal, daß seine Haltung zum Krieg das literarische Werk ins Abseits stellte - auch wenn die Kritik bei Jünger einen Überschuß an Ästhetik ausmachte, während sie Böll ein Überangebot an guten Absichten vorwarf. Mit der Kölner Ausgabe will der Verlag die Fixierung auf den Moraldiskurs auflösen und Böll aufs Schlachtfeld der Literatur zurückholen. Bereits die frühe Veröffentlichung des elften Bandes, der Bölls erzähltechnisches Abenteuer "Billard um halb zehn" enthält, setzt ein Zeichen für die Zeichenhaftigkeit - selbst wenn die Geschichte der Architektenfamilie Fähmel, die über drei Generationen hinweg Neubau, Zerstörung und Wiederaufbau eines Klosters betreibt, kein frühes Beispiel für eine Ästhetik der Dekonstruktion abgibt und der im Kommentar erwähnte "farblich differenzierte Strukturplan" Böll nicht zum deutschen Strukturalisten macht.
Auch der vierzehnte Band, der mit den Texten der Jahre 1963 und 1964 eine Vielzahl literarischer Reflektionen und vor allem die "Frankfurter Vorlesungen" zur Poetik enthält, schiebt Fragen der Machart in den Vordergrund. Zwar stilisiert der Kölner Studienabbrecher, der sich 1946 in erster Linie wegen der Lebensmittelkarten für die Fächer Klassische Philologie und Germanistik einschrieb und bereits 1947 wegen verpaßter Rückmeldefristen die Exmatrikel erhielt, den Autor - "er hat keinen Apparat, keine Hilfstruppen" - als Antitypus des Akademikers gleichsam zum einfachen Fußsoldaten. Doch eine Gesinnungstäterschaft, welche die literarischen Tatwerkzeuge als austauschbare Nebensachen behandelt, weist Böll in seinem im "Tagesspiegel" erschienenen "Plädoyer für freigelassene Autoren, Leser und Romanfiguren" deutlich von der Hand: "Die Manifeste der Engagierten sind meistens so peinlich wie die Gegenerklärungen derer, die sich für nicht engagiert erklären."
Trug denn Böll mit seiner sagenhaften Baskenmütze, Erkennungszeichen des linken Intellektuellen spätestens seit Sartre, den Begriff der engagierten Literatur nicht gleichsam auf dem Kopf? Vielleicht hilft die Erinnerung an jene französische Nebenbedeutung von Engagement, welche die Verpflichtung zum Dienst an der Waffe bezeichnet. Denn Bölls literarisches Werk nahm, wie der zweite Band mit den Frühschriften der Nachkriegsjahre 1946 und 1947 eindrucksvoll vorführt, in der verhaßten Gußform des Stahlhelms Gestalt an. Das hier versammelte unbekannte Material und vor allem der unveröffentlichte Roman "Kreuz ohne Liebe" bilden das eigentliche Neuland der Kölner Ausgabe.
Wenn Böll mit seinen quer durchs Frühwerk gestreuten Auslassungspunkten, zum Teil die am häufigsten verwendete Interpunktion, fast den Stil einer deutschen Beat-Generation vorwegnimmt, dann tut er dies als Vertreter einer geschlagenen Generation. Gerade in den unausgegorenen Kurzgeschichten, die der angehende Schriftsteller kurz nach dem Zweiten Weltkrieg - "29 Jahre alt, davon 7 Jahre einfacher Infanterist (!) jede Sekunde dieser 7 Jahre im Gefängnis der Uniform fast verzweifelnd" - erfolglos an die Redaktionen christlicher Zeitschriften verschickte, dienen die Druckwellen der Granatexplosionen als Impulse des Schreibens. Technische Abläufe wie die "Reihenfolge Abschuß - Heulen - Einschlag" schlagen als satanische Stahlgewitter zu Buche, und mit brutaler Genauigkeit protokolliert Böll "den Tod mit seinen tausend Möglichkeiten, vom Zertretenwerden unter den Füßen einer wild stürmenden Division bis zu jenem in der vaterländischen Literatur so gerühmten Kopfschuß, der den Stürmenden angeblich im höchsten Glück ins Jenseits befördert".
Fast scheint Böll mit seinem durch die Grauzonen des Horrors streifenden Todesarten-Projekt eine unmögliche Gattung wie den entromantisierten Landserroman anzustreben. Immerhin erklärt er den erdnahen Blickwinkel des Infanteristen - "Es gibt keinen schärferen und unbestechlicheren Beobachter als den schmutzigen Frontsoldaten, der vorne in seinem Loch liegt" - zur mustergültigen Erzählperspektive. Doch letztlich stehen bei Böll auch Bodentruppen unter dem höheren Gesichtspunkt der Ewigkeit, und jedem Gefechtsablauf liegt die tiefere Matrix des Kreuzwegs zugrunde. Böll schreibt Passionen für gebrochenen Heldentenor und Stalinorgel, er verlegt das Abendmahl in den Schützengraben und stellt die Jungfrau Maria ins Trommelfeuer. Natürlich überhöht diese Deutung des Krieges als "millionenfache Kreuzigung", die in jedem Gefallenen einen Nachfolger Christi erkennt, den Leidensdruck oft auf heikle Weise ins Schicksalhafte. Dennoch eröffnet Bölls Bekenntnis zu den Schmerzen eine Dimension, welche selbst den brutalsten Bildern der Wehrmachtausstellung abgeht.
Überhaupt schlägt der Ekel, vielleicht die bessere Querverbindung zu Sartre, fast überall als Leitmotiv des Böllschen Frühwerks durch. So sammelt der jugendliche Protagonist der Liebesgeschichte "Der Schulschwänzer" in einem Stadtpark Erfahrungen, welche an die in Sartres 1938 erschienenem Debütroman "Der Ekel" beschriebene und ebenfalls in einer Grünanlage angesiedelte Urszene des Existentialismus erinnern: "Der ganze dunkle, schwärzliche Park mit seinen kahlen Bäumen und Sträuchern war wie eine lebendige, stets gegenwärtige Anklage, die ihn umkrallt hielt." Gerade die verwüstete Nachkriegswelt schildert Böll fast gänzlich ohne den Klageton eines Wolfgang Borchert, um in den Kulissen der Zerstörung statt dessen eine ästhetische Kontrastfolie zu finden. "Man hätte meinen können", heißt es in der Liebesgeschichte "Der Schulschwänzer" über Köln, "daß die ganze, große Stadt nur zerstört worden sei, damit die beiden sich hier in der Stille küssen konnten."
Bölls frühe Prosa beruht auf diesen überscharfen Kontrasten, und als guter Manichäist schlägt der Autor nicht selten im Wörterbuch des Teufels nach. Der zu Unrecht nie veröffentlichte Roman "Kreuz ohne Liebe" führt die Verstörungskraft dieses dunklen Tiefblicks vor: Alle Wege führen hier nach Golgatha. Die Geschichte der Brüder Hans und Christoph Bachem, die als Kain und Abel in den Nationalsozialismus hineinwachsen, tritt als Abrechnung mit einem Bürgertum auf, das als "Geschlecht der unbegrabenen Leichen" in jedem Zombiefilm auftreten könnte und sich durch die "morsche Substanz der Gehirne" und die "modrige Mattheit des Blutes" für die Verdammnis qualifiziert.
Im himmlischen Frieden der nivellierten Mittelstandsgesellschaft wollte Böll niemals ankommen, auch wenn seine Texte gerade mit dieser Nachkriegsepoche verschmolzen sind. Böll sucht im Rückblick vielmehr die Vorzeichen des Untergangs: "Er hatte das dunkle Gefühl", heißt es über den Nazischergen Hans, "als sei sein Mund mit einer apokalyptischen Säure gefüllt." Und auch in Christophs mit allen Schikanen geschildertem Rekrutenschicksal zeichnet sich in jeder gefalteten Uniform ein Kadaver ab.
Dennoch verfällt Böll als besessener Zeichensucher selten einem plumpen Beziehungswahn. Bereits die am Anfang des Romans stehende Überkreuzung einer im Bau befindlichen Autobahnbrücke, Abzeichen der neuen Macht, mit dem alten Strom des Rheins ist ein mythologisches Meisterstück. Selbst die mitunter ungeschickten Beschreibungen - über Christophs Geliebte Cornelia heißt es im Zeichenstil des Mondgesichts: "Brauen und Stirn und Nase und Mund im ovalen Rahmen von Kinn, Wangen und Schläfen" - entwerten dieses feine Gespür für verborgene Bedeutungen nicht.
Den Höhepunkt des Roman und zugleich sein finsteres Herzstück bildet wohl jenes abgründige Kapitel, welches das Ende des von Selbstekel ergriffenen und an die Ostfront strafversetzten Hans Bachem beschreibt: "Wie eingeklemmt zwischen zwei Finsternisse, die Finsternis des Himmels und die der Erde, kriecht eine Kompanie Infanterie, den Rücken zur Front, durch den Schlamm." Apocalypse Now - so lautet das Schlüsselwort zum Verständnis dieser Szene. Denn Hans Bachem führt als außer Kontrolle geratener Ortskommandant ein unberechenbares Dasein, welches ihn als reumütigen Doppelgänger von Marlon Brando im gleichnamigen Film erscheinen läßt. Bachem begnadigt Todgeweihte, fälscht Urkunden und brüllt irrsinnige Befehle ins Feldtelefon: "Bestellen Sie dem Herrn Major, mein Dienstplan für morgen sei, die ganze Kompanie Scheiße ... Scheiße ... Scheiße schreien zu lassen, Scheiße auf die ganze deutsche Wehrmacht!" Als Zyniker aus verlorener Ehre fällt der Saboteur nach seiner Erschießung an einer Gartenmauer auf die Knie - in die Haltung der Bußfertigkeit.
Die christlichen Ikonen bilden beim frühen Böll nur die kunstvoll bemalte Rückseite einer Ästhetik des Grauens. Auch wenn der Leser über die kölschen Mein-Gott-Ausrufe, welche einem Musenanruf gleichkommen, eine eigene Strichliste führen könnte - die neue Ausgabe zeigt einen Autor, dessen Widerspenstigkeit sich nicht in der Sitzblockade, sondern in der Schreibbewegung erweist. Dem Wiederlesen steht nichts im Weg. Und vielleicht werden, ganz wie bei Ernst Jünger, die letzten Leser die ersten sein.
Heinrich Böll: "Werke". Kölner Ausgabe. Herausgegeben von Àrpád Bernáth, Hans-Joachim Bernhard, Robert C. Conrad u.a. Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln 2002.
Band 2: "1946 - 1947". Herausgegeben von J. H. Reid. 556 S., geb., 34,90 [Euro].
Band 11: "1959". Herausgegeben von Frank Finlay und Markus Schäfer. 450 S., geb., 34,90 [Euro].
Band 14: "1963 - 1965". Herausgegeben von Jochen Schubert. 827 S., geb., 34,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH"