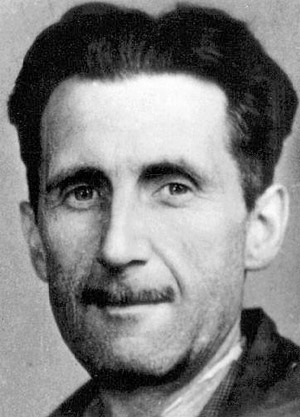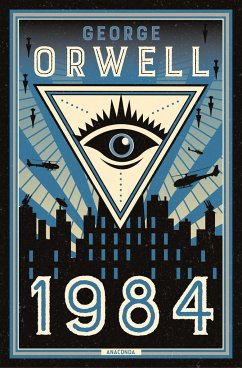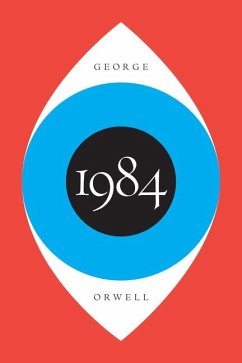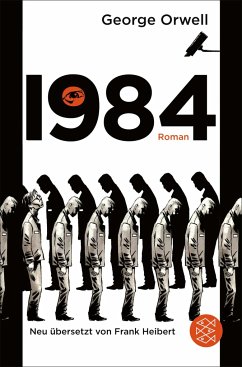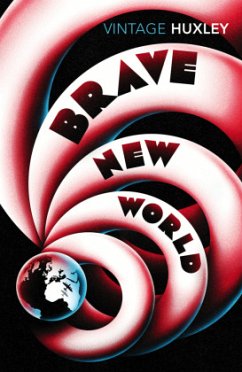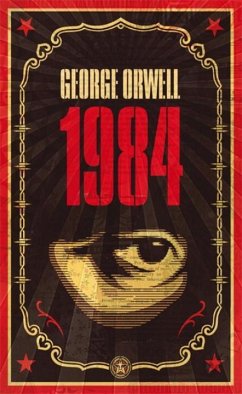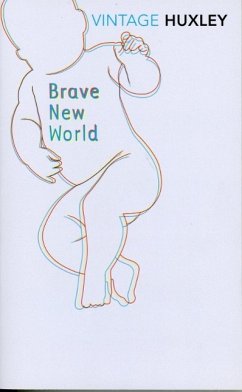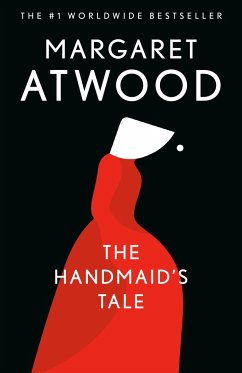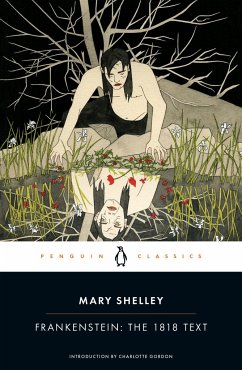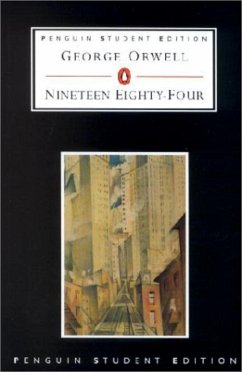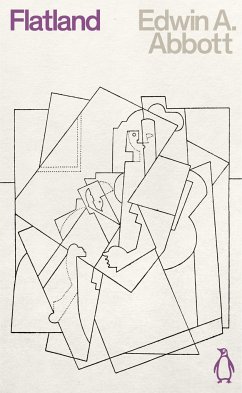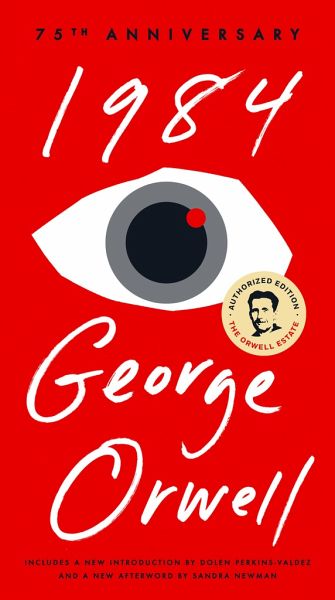
1984
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
8,49 €
inkl. MwSt.
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
4 °P sammeln!
Im Orwell-Staat wird eine neue Sprache verordnet, das so genannte "Neusprech". Zusammen mit dem so genannten "Zwiedenk" soll den Menschen das Denken abgewöhnt werden. Orwell beschrieb eindrucksvoll, wie durch Veränderung der Sprache der Manipulation des Volkes durch die herrschende Klasse Tür und Tor geöffnet werden kann. Besonders deutlich wird das, wenn die unmenschlichsten Züge eines Systems mit wohllautenden Namen besetzt sind. So gibt es zum Beispiel ein "Liebesministerium". Es sorgt nicht etwa für den liebevollen Umgang der Menschen untereinander, sondern "lehrt" den Abtrünnigen u...
Im Orwell-Staat wird eine neue Sprache verordnet, das so genannte "Neusprech". Zusammen mit dem so genannten "Zwiedenk" soll den Menschen das Denken abgewöhnt werden. Orwell beschrieb eindrucksvoll, wie durch Veränderung der Sprache der Manipulation des Volkes durch die herrschende Klasse Tür und Tor geöffnet werden kann. Besonders deutlich wird das, wenn die unmenschlichsten Züge eines Systems mit wohllautenden Namen besetzt sind. So gibt es zum Beispiel ein "Liebesministerium". Es sorgt nicht etwa für den liebevollen Umgang der Menschen untereinander, sondern "lehrt" den Abtrünnigen und Andersdenkenden mittels grausamster Foltermethoden den "Großen Bruder" zu lieben. Im "Ministerium für Wahrheit" werden Geschichte und Gegenwart dem gegenwärtigen politischen System angepasst. Wahr ist, was der "Große Bruder" als wahr definiert. Dem Volk wird klargemacht, dass alles immer schon so war, wie es jetzt ist. Anderslautendes wird aus Zeitschriften und Büchern und damit aus dem Gedächtnis der Menschen systematisch entfernt. Das "Friedensministerium" hingegen plant "Friedensmissionen", die nichts anderes sind als Kriegseinsätze. Wer wollte sich da noch wundern, dass sich hinter "Lustlagern" Zwangsarbeitslager der übelsten Art verbergen.