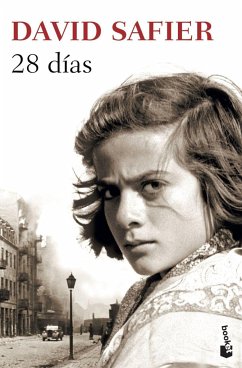Produktdetails
- Verlag: Booket
- Seitenzahl: 416
- Erscheinungstermin: Januar 2016
- Spanisch
- Abmessung: 190mm x 126mm x 27mm
- Gewicht: 280g
- ISBN-13: 9788432225758
- ISBN-10: 8432225754
- Artikelnr.: 44370133
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
- Herstellerkennzeichnung
- AGAPEA FACTORY
- c/ Bodegueros, 43nave5
- 29006 Malaga / SPANIEN, ES
- 0034 902195236

Seine minimalistische Sprache war in den zwanziger Jahren aufregend neu. Doch wie wirkt sie heute? Eine Wiederbegegnung mit Ernest Hemingways wegweisendem Roman "Fiesta" in neuer Übersetzung.
Schön, wenn man einem Lieblingsbuch aus Anlass einer Neuübersetzung wiederbegegnet. "Fiesta", so der deutsche Titel von "The Sun Also Rises", ist Hemingways erster Roman aus dem Jahr 1926 - und ein Jahrhundertbuch, so sagt es die Erinnerung an eine euphorische Jugendlektüre des Originals. Und welche kulturgeschichtliche Bedeutung! Die erste Hälfte befeuerte den Amerikaner-in-Paris-Mythos nach dem Ersten Weltkrieg, die zweite die Spanien- und Stierkampf-Legende. Auch der stilistische Einfluss des Buches kann kaum überschätzt werden. Sei einfach, sei wahr, so Hemingways Mantra.
Wenn das mit der Wahrheit bloß so einfach wäre. "Niemand kostet sein Leben voll aus, nur die Stierkämpfer" - ein klarer Satz, aber ist er wahr? Und was ist von dem vorangestellten Gertrude-Stein-Motto über die jungen Amerikaner im Paris der frühen zwanziger Jahre zu halten, sechs Worte, die die Rezeption dieses Romans bestimmten wie ein Leuchtspurgeschoss: "Ihr alle seid eine verlorene Generation." Eine verlorene Generation gab es um 1920 gewiss auf den Straßen Deutschlands; viele, die zu ihr gehörten, versuchten bald als Nationalsozialisten wieder Gewinner zu werden. Aber die jungen Amerikaner? Ihre Nation hatte ohne große Verluste als Spätteilnehmer siegreich den Ersten Weltkrieg beendet und war nun eine Weltmacht. In den Folgejahren konnten die Expats sich dank des starken Dollars im inflationsruinierten Deutschland, in Paris oder in Schweizer Skiorten ein bequemes Leben der Boheme leisten. "Verlorene Generation" scheint in diesem Kontext ziemlich larmoyant.
Das erste Drittel des Romans erweist sich beim Wiederlesen als unerwartet zäh: diese Rumhängerei in Paris, dieses gelangweilte Herumstrolchen von einer Bar zur anderen, Exzess als Existentialismus, Muster allerdings für unzählige Pop- und Partyromane aus späteren Jahrzehnten. Man steht etwas befremdet davor; aber so ist das ja oft mit früheren Lebensgefühlbüchern. Ein ersticktes Pathos steckt in der Idee einer großen Liebe, die keinen Platz in der Welt hat. Die fatale Lady Brett Ashley kann dem geliebten Jake Barnes wegen dessen heikler Kriegsverletzung nicht treu sein: "Ausgerechnet da verwundet zu werden. Sollte wohl komisch sein", grübelt er in seinen deprimierten Nächten. "Dann fing ich plötzlich an zu weinen."
Der Impotente und die Nymphomanin - Koordinaten für eine kaputte Romantik des Hatnichtsollensein. Brett hängt sich vielen anderen Männern an den Hals, die ihr kurzfristig Geld und Gaudi bieten. Jake, der Journalist, hält sich mit heroisch-masochistischer Selbstbeherrschung in der Nähe der Geliebten und versucht, ihr ein "Freund" zu sein. Die so männer- und hilfsbedürftige Brett Ashley erscheint als Schreckensgemälde der allesverschlingenden weiblichen Unersättlichkeit im Kurzhaar-Chic der Roaring Twenties. Und die Wunde des Jake Barnes ist Hemingways erste literarische Ausformung der Impotenzangst, viele weitere sollten folgen.
Die Figuren streiten und versöhnen sich, prügeln und prosten sich zu, so richtig wichtig ist das alles nicht, und es fällt schwer, als Leser Anteilnahme zu entwickeln, auch deshalb, weil Hemingway die introspektive psychologische Darstellung vermeidet. Selbsterklärend sind die Figuren allerdings auch nicht, sie reden zwar ununterbrochen, aber nie mehr als zwei oder drei läppisch-lapidare Sätze, die meist mit einer Getränkebestellung oder dem Essen zu tun haben. So ist man froh, als es von den Pariser Partymeilen endlich nach Pamplona geht und atmosphärische Reportage-Passagen über die "explodierende Fiesta" in den Roman einfließen. Die Amerikaner schaffen es, auch den wackeren Stierkämpfern bald auf die Nerven zu gehen. Brett beginnt eine Affäre mit dem jungen, heiligmäßigen Torero Pedro Romero, was wiederum viel Streit, Suff, Eifersucht und schlechte Laune stiftet.
Hemingways minimalistische Sprache hat in den zwanziger und auch noch den fünfziger Jahren aufregend neu gewirkt; schließlich war verschmockter oder überladener Stil damals weit verbreitet. Heute, wo acht von zehn Schriftstellern und überhaupt alle Krimiautoren dieser Welt sich bemühen, cool und knapp zu schreiben, ist diese Wirkung des Ungewohnten, Kühnen längst verpufft. Wenn die Figuren demonstrative Nichtigkeiten und kurzatmige Floskeln von sich geben, dann sollen wir uns nach der "Eisberg"-Theorie das Ungesagte dazudenken und spüren, was für schlimm verzweifelte Gestalten das seien: "Noch einen Port?" "Na schön." "Hallo, ihr Rumtreiber." "Wie isses?" "Gut." "Trink noch einen Cognac." "Ach Liebster, ich bin so unglücklich." "Wunderbar!" "Trinken wir noch einen." "Der Wein ist wunderbar." "Budapest ist wunderbar." "Unser Hotel ist ganz reizend." "Ein famoses Mädchen." "Wir sollten was essen." "Ich bin nicht betrunken. Höchstens vielleicht ein bisschen." "Netter Bursche." "Großartiger Bursche." "Du sagst es." So geht das über dreihundert Seiten, und in die Beschreibungen dazwischen hat Hemingway die ganze Kraft der Lakonik gelegt: "Das Essen war gut, Brathähnchen, junge grüne Bohnen, Kartoffelpüree, Salat, Apfelkuchen und Käse." Oder: "Die Weiden waren grün, und es gab schöne Bäume und manchmal zwischen den Bäumen breite Flüsse."
Ist das nun der gerühmte schlackenlose Präzisionsstil? Wie man hier sieht, gebraucht Hemingway durchaus Adjektive, nur wählt er gezielt immer die unschärfsten aus. Atmosphäre durch Tautologie: grüne Bäume, blauer Himmel, unglückliche Frauen. Oder die Beschreibung einer Kirche: "Es war schummrig und dunkel, und die Pfeiler ragten hoch hinauf, und die Leute beteten, und es roch nach Weihrauch, und es gab ein paar wunderbar große Fenster." Hier wird nicht das Wesentliche gesagt, sondern genaugenommen gar nichts; nichts jedenfalls, was nicht schon im Begriff "Kirche" als naheliegende Assoziation drinstecken würde. "In Wien war alles wie in Wien", sagt eine Figur einmal und gibt damit gewissermaßen den Extrakt einer Hemingway-Beschreibung: kein überflüssiges Wort, alles gesagt.
Immerhin, es gibt Passagen, die sich gehalten haben, Landschaftsbeschreibungen von schlichtem, biblischem Pathos, wo Hemingway flächig und leuchtend malt wie Cézanne. Höhepunkt ist der Mittelteil über die Fahrt in die spanischen Berge, wo Jake und Bill im Fluss Forellen fischen. Das ist ganz "wunderbar". Zu loben ist auch die überfällige Neuübersetzung von Werner Schmitz; sie ist in vielem frischer und treffender als die veraltete, oft hölzerne Fassung von Annemarie Horschitz-Horst von 1954, wo es über einen hilfreichen Drink schon mal hieß: "Vielleicht tut dir gerade dieser not." Und wo man über Robert Cohn erfuhr: "Er hatte aus Reaktion gegen die grässlichen Universitätsjahre geheiratet." Jetzt liest man geschmeidiger: "Er hatte geheiratet, um sich für die schlimme Zeit am College zu trösten." Ein grundsätzliches Problem besteht allerdings darin, dass der Hemingway-Stil, der so spärlich und floskelhaft daherkommt, starke klanglich-rhythmische Qualitäten hat. Im Deutschen hat das einfach nicht den Sound, so wie die Übersetzungen von Popsongs meist nicht "klingen".
Kein Zweifel, "Fiesta" ist einer der stilprägendsten Romane des zwanzigsten Jahrhunderts. Gerade deshalb erscheint er heute, bei der Lektüre, auch wie ein alter Bekannter, der seine Geschichten doch schon zu oft zum Besten gegeben hat.
WOLFGANG SCHNEIDER.
Ernest Hemingway: "Fiesta".
Roman.
Aus dem Englischen von Werner Schmitz. Rowohlt Verlag, Reinbek 2013. 320 S., geb., 19,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main