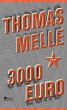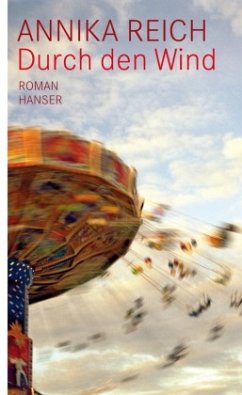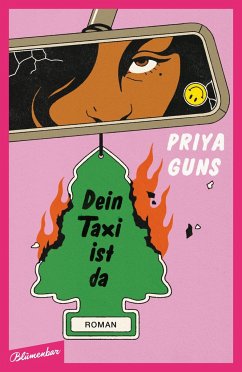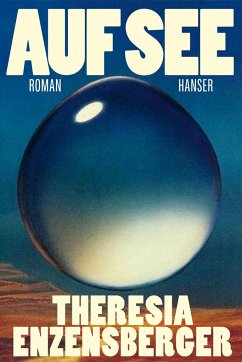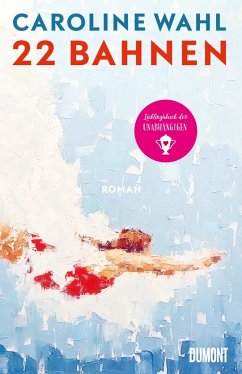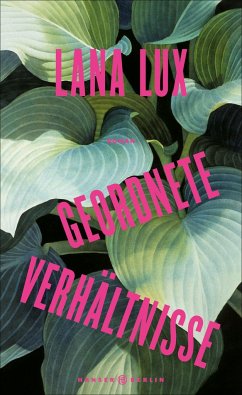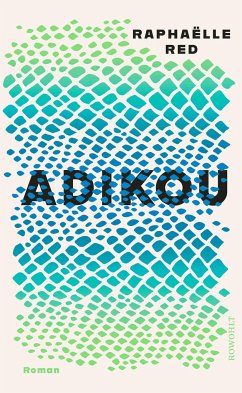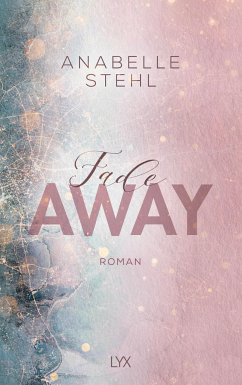Nicht lieferbar
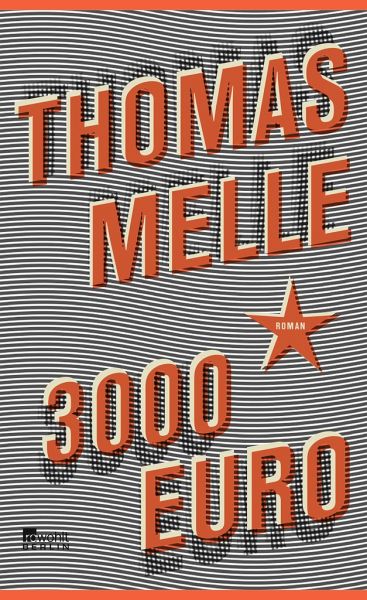
3000 Euro
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Weitere Ausgaben:
Denise kommt mehr schlecht als recht mit ihrem Leben klar. Sie arbeitet im Discounter, ihre kleine Tochter Linda überfordert sie oft; eine langersehnte New-York-Reise bleibt ein - immerhin tröstlicher - Traum. Mit dem Lohn für einen Pornodreh will sie endlich weiterkommen, aber man lässt sie auf ihr Geld warten. Immer öfter steht Anton an ihrer Kasse, der abgestürzte, verschuldete Ex-Jurastudent, der im Wohnheim schläft. Vorsichtig kommen sich die beiden näher. Während Denise wütend, aber auch stolz um ihr Recht und für ihre Tochter kämpft, während Anton seiner Privatinsolvenz ent...
Denise kommt mehr schlecht als recht mit ihrem Leben klar. Sie arbeitet im Discounter, ihre kleine Tochter Linda überfordert sie oft; eine langersehnte New-York-Reise bleibt ein - immerhin tröstlicher - Traum. Mit dem Lohn für einen Pornodreh will sie endlich weiterkommen, aber man lässt sie auf ihr Geld warten. Immer öfter steht Anton an ihrer Kasse, der abgestürzte, verschuldete Ex-Jurastudent, der im Wohnheim schläft. Vorsichtig kommen sich die beiden näher. Während Denise wütend, aber auch stolz um ihr Recht und für ihre Tochter kämpft, während Anton seiner Privatinsolvenz entgegenbangt, arrivierte frühere Freunde trifft, mal Hoffnung schöpft und sie dann wieder verliert, entwickelt sich eine zarte, fast unmögliche Liebe. Beide versuchen, sich einander zu öffnen, doch als Denise endlich ihr Geld bekommen soll und Antons Gerichtstermin naht, müssen sie sich fragen, wie viel Nähe ihr Leben wirklich zulässt_...
Thomas Melle erzählt von einer Liebe am unteren Rand der Gesellschaft, von der menschlichen Existenz in all ihrer drastischen Schönheit und Zerbrechlichkeit - ein zärtlicher, heftiger Roman über zwei Menschen und die Frage, was dreitausend Euro wert sein können.
Thomas Melle erzählt von einer Liebe am unteren Rand der Gesellschaft, von der menschlichen Existenz in all ihrer drastischen Schönheit und Zerbrechlichkeit - ein zärtlicher, heftiger Roman über zwei Menschen und die Frage, was dreitausend Euro wert sein können.