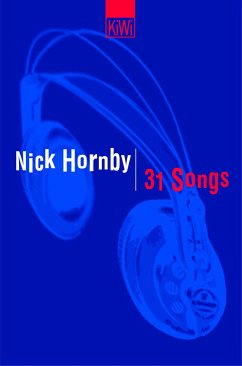Was macht einen guten Song aus und warum kann man sich an manchen Liedern nicht satt hören? Nick Hornby verrät dem Leser, welche Songs eine wichtige Rolle in seinem Leben spielen - und erzählt dabei vor allem von sich selbst. Wie 'Thunder Road' von Bruce Springsteen die Antwort auf alle Absageschreiben wurde, die er jemals erhalten hat, dass 'Caravan' von Van Morrison trotz eines winzigen Einwands auf seiner Beerdigung gespielt werden soll, warum es nicht uncool ist, einen Song von Rod Stewart zu mögen, wie Musik eine Romanfigur beeinflussen kann, ob Freunde noch Freunde sind, wenn sie einen anderen Musikgeschmack haben, was Popmusik mit Fußball vereint, was passiert, wenn ein vermeintlicher Geheimtipp plötzlich als Hintergrundmusik im Supermarkt gespielt wird, warum kleine unabhängige Plattenläden allen Ketten dieser Welt vorzuziehen sind - mit viel Selbstironie, einer wunderbar subjektiven Haltung und seinem unvergleichlichen Stil beschreibt Nick Hornby, was ihm wichtig ist - im
»Wunderschöne Meditationen über die Frage, wie man trotz Pop und mit Pop in Würde altern kann.« Oliver Fuchs Süddeutsche Zeitung

Jede Platte erzählt eine Geschichte, aber ein Leben dauert länger als einunddreißig Songs: Nick Hornbys brillante Pop-Essays
Daß im Fan das wahre Genie stecke, ist eine Behauptung, deren Wahrheit nur der ans Licht bringt, der sich nicht damit begnügt, Geschmacksurteile abzugeben. Das Interpretentum jeder Kunst hat sich, will es nicht nur unter den Eingeweihten etwas gelten, mittels vernünftiger Kriterien auszuweisen - in der Popmusik kommt erschwerend hinzu, daß viele an die Existenz solcher Kriterien gar nicht glauben und jeden unter Affirmationsverdacht stellen, der vor der Notwendigkeit, seine Urteile auch zu begründen, kapituliert. Wie aber will man begründen, warum die "Beatles" gute Musik gemacht haben? Reicht es nicht, dieser Meinung zu sein? Wer allzu begeistert ist, gerät schnell in Verlegenheit und merkt, daß es sich leichter kritisieren als loben läßt.
Nick Hornby ist ein genialer Fan und einer der ganz wenigen, die auf literarisch anspruchsvolle Weise zugeben, daß sich manche Dinge eben nicht begründen lassen. Wo andere sich im Gestrüpp zwischen dem ewigen Drei-Akkorde-Vorwurf und einer bloß unterstellten Bedeutung verheddern, vertritt er schlagfertig eine quasiromantische Genieästhetik. "Die beste Musik spricht die Seele an, nicht den Verstand, und irgendwie befürchte ich, daß die ganze Dylan-Verehrung in gewisser Weise anti-musikalisch ist." Bob Dylan, der in Hornbys Sammlung "31 Songs" mit "Can You Please Crawl Out Your Window?" vertreten ist, würde das womöglich sogar bestätigen. Grenzen ließ er sich von denen bereitwillig aufzeigen, die seine Lieder kompetent nachsangen; er litt nicht unter falscher Bescheidenheit, als er zugab, daß "Mighty Quinn" in der Version von Manfred Mann besser klang als in seiner eigenen. Was er zu Rod Stewarts "Mama You Been On My Mind" gesagt hat, das gleichfalls von ihm stammt, ist nicht überliefert.
Dafür haben wir Nick Hornby, der die Dinge nicht nur hier wohltuend zurechtrückt und Stewart aus dem flachen Hedonismus befreit, in den ihn mancher hineingeredet hat. Denn daß Stewart einer der bedeutendsten Interpreten schwierigen Fremdmaterials war, den die Rockmusik hatte, das weiß Hornby: "Er war der erste Sänger, der mich lehrte, daß Interpretation eine Kunst ist." Was Hornby uns lehrt, ist, welche Wirkungsmacht vom frühen Stewart ausging. Wer eine Ballade wie "I'd Rather Go Blind" nicht kennt, der lasse sich sagen, welches Glück er noch vor sich hat, und sich nicht anstecken von der Manie, die schon viele ergriffen hat: Stewart Ratschläge zu erteilen. "Was hätte Rod davon?" fragt Hornby. "Er ist ja bis jetzt ganz gut ohne uns klargekommen." Dieser charmant-trockene Ton, in dem jederzeit Bodenständigkeit mitschwingt, macht Hornbys Buch zum Besten, was man in diesem Genre lesen kann. Daß der Verlag das Etikett "Roman" von den Druckfahnen wieder entfernt hat, ist genauso ein Segen wie die Übersetzung und ein Lektorat, das bemerkt hat, daß Stewarts "Mama You Been On My Mind" eben nicht von dem Album "Every Picture Tells A Story" stammt, sondern von "Never A Dull Moment".
Nicht einen Moment Langeweile empfindet man auch bei Hornby. Daß ihm die Songs nur Anlaß sind für pophistorische Betrachtungen, für kluge Bemerkungen zu Geschmacksfragen, zur Haltbarkeit von Popsongs und zum Zusammenhang von Musik und Leben, wird man desto leichter in Kauf nehmen, als Hornby mit dem in britischen Kreisen besonders weit verbreiteten Hang zur Kanonbildung nichts am Hut hat. Er weiß, wann es peinlich wird, und kennt so viele gute Songs so gut, hat sie so intensiv erlebt, daß es statt dieser einunddreißig Songs genausogut einunddreißig andere sein könnten. Was er uns zur Prüfung souverän vorlegt, sind keineswegs reine Klassiker, sondern von den klassischen Musikern Lieder, die man nicht unbedingt auf der Rechnung gehabt hätte und die desto mehr erfreuen: Van Morrisons "Caravan", Jackson Brownes wunderbares "Late For The Sky" und Bruce Springsteens "Thunder Road". Wie ernst diese Auswahl, die auch Abgelegenes enthält, zu nehmen ist, sieht man daran, daß der "Independent" sich kürzlich auf einer ganzen Seite mit Hornbys alles überstrahlender Liebe zu Springsteens gewaltigem Song befaßte.
Man könnte, nicht nur anläßlich der deutschen Neuübersetzung des "Fängers im Roggen" (F.A.Z. vom 26. Februar), Nick Hornby den Holden Caulfield der Popkritik nennen. Er schreibt mit Mut, Eigensinn und einer gesunden Ignoranz gegenüber dem Geschmäcklerischen; aber noch im schroffen Urteil spürt man Hornbys Bedürfnis, Anschluß zu finden mit dem, was er sagt. Es ist ein erwachsen gewordener Holden Caulfield, der zu uns spricht, Vater eines behinderten Sohnes, der Glück darüber empfindet, daß dieser Sohn mit Popmusik etwas anfangen kann. Denn die Lauen, die sich an Songs nur erinnern, wenn sie damit Ereignisse aus ihrem eigenen Leben verbinden, und es nicht begreifen, daß es auch umgekehrt sein kann und das Leben von der Popmusik nahezu vollständig beherrscht wird - diese Nebenbei-Hörer sind ihm verdächtig. Wer aber die Popmusik liebt, der wird auch dieses Buch lieben.
Nick Hornby: "31 Songs". Aus dem Englischen übersetzt von Clara Drechsler und Harald Hellmann. Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln 2003. 160 S., geb., 14,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main