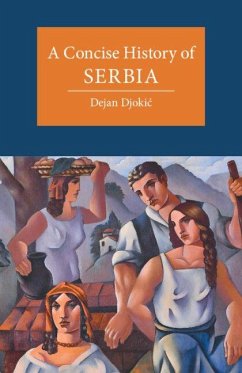This accessible and engaging single-volume history of Serbia covers the full span of history, from the sixth-century Slav migrations up to the present day. It traces key developments surrounding Serb states, institutions, and societies, while incorporating the individual experiences and perspectives of ordinary people.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Zur Korrektur nationalistischer Großerzählungen: Dejan Djokic wagt sich an eine weit mehr als ein Jahrtausend durchmessende Geschichte Serbiens
Kann ein Einzelner eine Nationalgeschichte schreiben? Was müsste man nicht alles wissen, was nicht alles sein, um das bewältigen zu können? Im Fall einer Geschichte Serbiens, um die es hier geht: Byzantinist und Mediävist, Frühneuzeitler und Zeitgeschichtler, Kenner der Renaissance und der Kreuzzüge, mit altkirchenslawischen, griechischen, osmanischen, venezianischen, ragusanischen und ungarischen Chroniken vertraut, zudem natürlich Militärhistoriker, Wirtschaftsgeograph, Religionsforscher, Sozialwissenschaftler und so fort. Der in London lebende und lehrende serbische Historiker Dejan Djokic, der vor einigen Jahren ein exzellentes Buch über die Gründung Jugoslawiens nach dem Ersten Weltkrieg vorgelegt hat, nähert sich dieser Aufgabe denn auch in angemessener Demut.
In seiner "Concise History of Serbia" erläutert er einleitend ausführlich, was sein Buch nicht sei und nicht sein könne. Mit den Fragen "Wo ist Serbien?" und "Wann ist Serbien?" steckt er das amorphe Terrain ab: "Für die meiste Zeit, die dieses Buch abdeckt, existierte kein Land namens Serbien. Dies ist ein häufiges Problem, mit dem ein Historiker konfrontiert ist, der eine 'nationale' Geschichte schreibt." Autoren synthetischer Geschichten Griechenlands, Italiens, Deutschlands und vieler anderer Länder gehe es schließlich ähnlich, merkt der Autor an. Deshalb taucht "Serbien" bei Djokic in vielen frühen Kapiteln just so auf wie in diesem Satz: in Anführungszeichen, als Konstrukt, Zitat und nachträgliche Idee.
Djokic fragt eingangs, wann aus den slawischen Stämmen, die um das sechste Jahrhundert nach Christi auf die Balkanhalbinsel einwanderten, in der Fremd- sowie der Selbstwahrnehmung "Serben" wurden, und betont die Unterschiede zum heutigen Verständnis dessen, was ein Volk sei. Er greift die These auf, dass die Serben womöglich Nachfahren von nach Süden gewanderten Sorben seien. Dafür kann er Indizien anführen und nennt die Annahme, balkanische Serben und Lausitzer Sorben seien aus einem Stamm hervorgegangen, "nicht unplausibel". Da fehlt eigentlich nur noch eine Städtepartnerschaft Bautzen-Belgrad.
Ob Sorben oder Serben: Sechs Jahrhunderte nach der Ankunft der Slawen auf dem Balkan schuf die kreuzritterliche Eroberung Konstantinopels 1204 die Bedingungen für den Aufstieg eines serbischen Reiches, das stets auf das zweite Rom fixiert blieb. "Die mittelalterlichen Serben", schreibt Djokic, "betrachteten ihr Land als zum Westen gehörig - nicht aus irgendeinem Wunsch heraus, dem Osten zu entfliehen (der für sie eine positive Konnotation hatte), sondern einfach deshalb, weil sie westlich von Konstantinopel lebten, das als Zentrum der zivilisierten Welt galt."
Leider werden zu dieser Feststellung keine Quellen genannt, sodass unklar bleibt, auf welche Zeugnisse sich die Darstellung dieser mittelalterlichen serbischen Selbstwahrnehmung bezieht. Das Schicksal Konstantinopels strahlte aber fraglos auf die Balkanhalbinsel aus. So, wie der Zusammenbruch der byzantinischen Herrschaft im vierten Kreuzzug die Voraussetzungen geschaffen hatte, unter denen sich ein serbisches Reich ausbreiten konnte, läutete die Eroberung der Stadt durch die Osmanen 250 Jahre später das Ende dieses Reiches ein. Ein Vorbote des nahenden Endes war die erste Schlacht auf dem Amselfeld 1389, die in späteren Legenden neu erfunden wurde. Zur Schicksalsschlacht des Serbentums oder gar des Christentums schlechthin wurde sie erst in der Rückschau stilisiert.
Detailliert und stringent ist Djokics Darstellung der osmanischen Eroberungen in Europa. Die begannen 1371 mit der serbischen Niederlage in der Schlacht an der Maritza, dem Strom, der bei den Griechen Evros heißt und als Grenzfluss zur Türkei in der Migrationskrise unserer Tage wieder eine Rolle spielt. Bis sie 1683 vor Wien scheiterten, schienen die Osmanen unaufhaltsam. Djokic erklärt dies nicht allein mit der anfänglichen militärischen Überlegenheit der Eroberer, sondern auch mit pragmatischen Abwägungen der Serben und anderer balkanischer Bevölkerungsgruppen, die sich im Süden von den Osmanen und im Norden von Ungarn bedrängt sahen: "Angesichts der Wahl zwischen osmanischer oder ungarischer Herrschaft scheinen viele Serben Erstere vorgezogen zu haben. Die Osmanen galten als relativ tolerant gegenüber anderen Religionen, während ein Bündnis mit Ungarn möglicherweise zur Kirchenunion mit Rom und zur vollständigen Eingliederung des serbischen Reiches in Ungarn geführt hätte." Tatsächlich scheinen die Eroberer zumindest anfangs einen positiven Eindruck bei den Christen auf dem Balkan hinterlassen zu haben, so Djokic: "Die relative Toleranz der Osmanen gegenüber der orthodoxen Kirche stand im Gegensatz zum Druck auf Balkanmigranten in Ungarn und Venedig, die Vormachtstellung Roms und das katholische Dogma zu akzeptieren."
Auch wirtschaftliche Erwägungen sprachen anfangs womöglich für die neuen Herren: "Ein besser reguliertes und günstigeres osmanisches Steuersystem muss für die serbische und andere südosteuropäische Bauernschaft, die zuvor oft der Gnade ihrer christlichen Grundbesitzer ausgeliefert war, attraktiv gewesen sein." Djokic geht auch auf die Praxis der "Knabenlese" ein, also auf die systematische Entführung balkanslawischer männlicher Kinder aus christlichen Familien, die als zwangskonvertierte Muslime oft hohe und höchste Würdenträger im Osmanischen Reich wurden. Viele erfolgreiche Heerführer oder Großwesire der Sultane waren balkanslawischer Abkunft und über die "Knabenlese" (im Serbischen "Blutgabe" genannt) gesellschaftlich aufgestiegen. "Die Osmanen interessierten sich besonders für Jungen und junge Männer aus angesehenen christlichen Familien", schreibt Djokic und deutet nebenbei ein Forschungsdesiderat an: "Serbische und andere südslawische Konvertiten zum Islam leisteten einen wichtigen Beitrag zur osmanischen Kultur und Wissenschaft, bleiben jedoch bemerkenswert durch ihre Abwesenheit in Geschichten Serbiens und des Balkans."
Djokic begeht nicht den Fehler, dem nationalistischen serbischen (sowie bulgarischen, griechischen oder albanischen) Narrativ eines "Türkenjochs", das dem Balkan jahrhundertelangen Stillstand beschert habe, das Gegen-Zerrbild einer vermeintlich friedlich-toleranten Pax Ottomana gegenüberzustellen. "Der osmanische Staat sorgte dafür, dass Muslime privilegierte Mitglieder der Gesellschaft blieben, während Nicht-Muslime diskriminierenden Gesetzen und Steuersystemen unterworfen waren", schreibt er und warnt vor einem romantisierenden Blick auf das halbe Jahrtausend osmanischer Herrschaft am Balkan. Er macht auch deutlich: Das aus dem Zerfall der osmanischen Herrschaft im neunzehnten Jahrhundert entstandene, nach 1918 für gut siebzig Jahre in Jugoslawien aufgegangene Serbien war nicht die Fortsetzung des mittelalterlichen serbischen Reichs, das in zeitweiliger Konkurrenz zu Bulgarien und gleichsam im Kielwasser von Byzanz entstanden war. Eine solche Kontinuität wurde erst nachträglich erfunden, ähnlich wie in dem weitaus bekannteren Fall Griechenlands.
Das Osmanische Reich hatte wie später Jugoslawien fast alle Angehörigen des serbischen Volkes in den Grenzen des gleichen Staates vereint. Mit dem Zerfall Jugoslawiens 1991 endete diese Zeit. Das serbische Bestreben der Neunzigerjahre, die Grenzen kriegerisch zu ändern, um alle Serben in einem nunmehr nur noch serbischen Staat zu vereinen, gehört naturgemäß zu den dunkelsten Kapiteln in Djokics Buch, in dem die damit einhergegangenen Verbrechen umfassend aufgeführt werden.
Fazit? Den gewaltigen Versuch, eine sich über weit mehr als ein Jahrtausend erstreckende Nationalgeschichte zu schreiben, hat Djokic umsichtig gelöst - soweit sich das beurteilen lässt. Denn die Aufgabe übersteigt natürlich nicht nur das Wissen eines einzelnen Historikers, selbst eines so skrupulösen wie Djokic, sondern allemal auch das jedes Rezensenten, der diese beachtliche Arbeit zu bewerten versucht. MICHAEL MARTENS
Dejan Djokic: "A Concise History of Serbia".
Cambridge University Press, Cambridge 2023.
542 S., br., 33,50 Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main