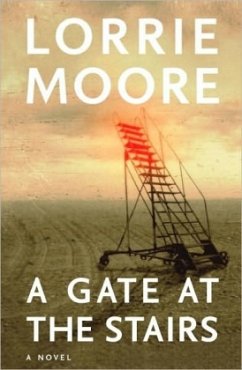Während sich Amerika in aller Stille für den Irakkrieg rüstet, versucht die 20jährige Tessie, Famerstochter aus dem mittleren Westen, in einer sich verändernden Welt, ihren Weg zu finden. Ein Roman über den tiefverwurzelten Rassismus, die Schrecken des Krieges, eine lyrische und sehr weise Betrachtung unserer Welt.

Sprachbombardierung: Die Amerikanerin Lorrie Moore ist eine Meisterin der kurzen Form - aber nicht des Romans.
Von Eva Menasse
Ein eher unproduktives Gefühl ist die enttäuschte Liebe. Sie macht nicht nur bitter und faltig, sondern wahrscheinlich ungerecht, weil der Blick an den Extremen hängenbleibt, auf die Fallhöhe zwischen Erwartung und Enttäuschung konzentriert, und die Zwischentöne und Schattierungen auf der Strecke bleiben.
Zum Thema Liebe: Die Kurzgeschichten und Erzählungen der Autorin Lorrie Moore gehörten seit vielen Jahren zum Besten und Schrägsten, was die intelligente amerikanische Literatur zu bieten hatte. Die umjubelte Miranda July schien direkt aus Moores Schreibseminar gekommen. Und neben Moores literarischem Laserschwert wirkte, nur zum Beispiel, ein Philip Roth, den man hierzulande gern für den Olymp des amerikanischen Witzes hält, wie der redundante, joviale Viagra-Opa, der er, von ein paar Ausnahmen abgesehen, seit vielen Büchern und Jahrzehnten ohnehin ist. In ihren Erzählungen, die in den Bänden "Leben ist Glückssache", "Pepsi Hotel" und "Was man von einigen Leuten nicht behaupten kann" erschienen sind, demonstrierte Moore mit Nachdruck, was man für eine gute Erzählung können muss: Sie deckt mit sicherem Griff gerade den hässlichsten Charakterwinkel ihrer Figuren auf, sie schneidet aus ihren zwar oft skurrilen, aber deutlich dem Leben abgelauschten Geschichten einen besonders ungewöhnlichen Ausschnitt heraus wie eine Filmemacherin, die ihre Kamera im Schuh oder im Kronleuchter versteckt, weil konventionelle Einstellungen sie einfach tödlich langweilen. Dazu benützt sie ihre Sprache voller messerscharfer Formulierungen und halsbrecherischer Metaphern so instinktiv und unverfroren, wie es vielleicht nur ein Wunderkind vermag, das mit neunzehn seinen ersten literarischen Preis gewonnen hat.
Lorrie Moore schrieb immer, als hätte sie sich den Slogan "Bombardiert mit Sprache alles, was nach political correctness aussieht" in ihren Schreibtisch gesägt. Gewiss hätte sie auch als Gag-Schreiberin einer intellektuellen Late-Night-Show ein bequemes Auskommen finden können, doch literarisch konnte man sie nie als Pointenschleuder missverstehen. Denn ihren oft haarsträubenden Humor hat sie immer nur in den Dienst gebrochener Charaktere und schrecklicher Geschichten gestellt. Ebendas machte den Sucht-Faktor aus: die Kombination von greller Komik mit tiefsten psychischen Abgründen.
Dabei konnte man durchaus auf die Idee kommen, dass hier eine hochbegabte, aber reichlich neurotische Autorin das Schreiben als Angsttherapie betrieb. Über alle inneren Widerstände hinweg lockte sie einen in ihre Horror-Szenarien hinein: Eine Frau stürzt so unglücklich von einer Picknickbank, dass sie dabei das Neugeborene ihrer Freundin tötet. Manchmal aber waren es auch bloß intelligente Frauen mittleren Alters, deren Humor kein Mensch, vor allem kein Mann, zu verstehen schien und die irgendwann unsicher wurden, ob sie nicht vielleicht doch die überempfindlichen Schrullen sind, von denen sie in den Blicken der anderen lasen: "Was ist das für ein Parfum? wurde sie einmal von einem Studenten gefragt. Raumspray, antwortete sie. Sie lächelte, aber er sah sie nur entnervt an."
Ihre Erzählung "You're ugly too" ("Hässlich sind Sie auch") wurde von John Updike unter die "Best American Short Stories of the Century" aufgenommen, und die Kernszene ist so unvergesslich wie typisch Lorrie Moore: Eine Frau und ein Mann, die von der Schwester der Frau auf deren Halloween-Party verkuppelt werden sollen, stehen in ihren kindischen Kostümen auf einem Balkon hoch über Manhattan. Sie "trägt" einen riesigen Knochen, der vermeintlich ihren Kopf durchbohrt, er geht als nackte Frau, eine seiner Plastikbrüste leider etwas verrutscht. Da erzählt die Frau aus Verlegenheit einen geschmacklosen Krebskranken-Witz und die Szene implodiert. Ein Paar werden die beiden nicht mehr, eher Feinde fürs Leben.
Nun hat diese schwarzhumorige Kurzgeschichten-Meisterin einen Roman vorgelegt, nicht ihren ersten, doch lag der letzte viele Jahre zurück. Er heißt "Ein Tor zur Welt", und wir kommen, siehe oben, zum Thema Enttäuschung. Denn dieser Coming-of-Age-Roman einer jungen Frau aus dem Mittleren Westen in den Monaten nach dem 11. September und vor dem Hintergrund des beginnenden Afghanistan-Krieges ist vor allem: lau. Und damit das Gegenteil dessen, was Lorrie Moores nadelspitzes Schreiben immer ausgezeichnet hat. Die Geschichte selbst enthält zwar die üblichen schrägen Elemente: Tassie, die Heldin, sucht einen Babysitter-Job und wird ausgerechnet von der exzentrischen Mittvierzigerin Sarah Brink angeworben, die auf verzweifelter Jagd nach einem Adoptivkind ist. Zweimal nimmt Sarah Tassie zum Kennenlern-Gespräch mit einer "biologischen Mutter" mit. Beim ersten Mal verdirbt die mundflinke Sarah das Gespräch mit einer hochschwangeren Gefängnisinsassin, beim zweiten Mal klappt es und sie können ein zweijähriges "bi-ethnisches" Mädchen mitnehmen. Als das Kind in der vorwiegend weißen Stadt Troy als "Nigger" beschimpft wird, gründet Sarah einen Gesprächskreis für die Eltern bi-ethnischer Kinder. Diese teilweise höchst inkorrekten, teilweise herzzerreißenden Diskussionen ("Rassenblindheit ist ein rassistisches, weißes Konzept!") fügt Moore merkwürdig lustlos als bloße Dialogfetzen ein, die Tassie aus dem Kinderzimmer belauscht. Wenn das zum dritten Mal kommt, überblättert man es. Und das ist der Hauptvorwurf an diesen Roman: die geradezu schockierende Fahrlässigkeit, mit der auf jegliche Dramaturgie, Raffung, Verdichtung, Vernetzung verzichtet wird. In der ersten Hälfte plätschert das Buch dahin, in der zweiten überschlagen sich die Ereignisse künstlich und gehen einem dennoch nicht nahe. Tassie hat sich in einen vermeintlichen Brasilianer verliebt - natürlich entpuppt er sich als Islamist. Ihr jüngerer Bruder Robert meldet sich freiwillig zum Militär - natürlich kommt er gleich um. Das süße kleine Mädchen wird Sarah Brink und ihrem alternden Schönling von Ehemann wieder weggenommen - denn sie haben verheimlicht, dass ihr eigenes Kind vor vielen Jahren durch grobe Fahrlässigkeit ums Leben gekommen ist.
Aber das Schmerzhafteste ist, dass dieser schwache Roman sogar Lorrie Moores ureigene Stärken zu dementieren scheint. Die Wortspiele, der Witz, die Frechheiten, die von Frank Heibert und Patricia Klobusiczky einfallsreich ins Deutsche übertragen worden sind, wirken in diesem uninspirierten Ambiente verzweifelt bemüht, sie sind der Erzählung nicht eingepasst, sondern aufgepappt. Es kommt so weit, dass sie peinlich wirken, wie ein Spaßmacher, der weiterhampelt, obwohl längst keiner mehr lacht. Nein, wir schlagen "Ein Tor zur Welt" mit Aplomb zu und empfehlen allen, die sie noch nicht kennen, von ganzem Herzen Lorrie Moore als große, schrille Meisterin der kleinen Form.
Lorrie Moore: "Ein Tor zur Welt". Roman.
Aus dem Amerikanischen von Patricia Klobusiczky und Frank Heibert. Berlin Verlag, Berlin 2011. 381 S., geb., 24,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main