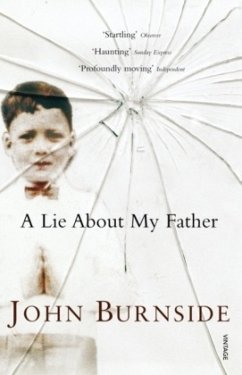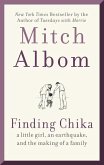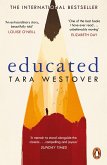A moving, unforgettable memoir of two lost men: a father and his child.
He had his final heart attack in the Silver Band Club in Corby, somewhere between the bar and the cigarette machine. A foundling; a fantasist; a morose, threatening drinker who was quick with his hands, he hadn't seen his son for years.
John Burnside's extraordinary story of this failed relationship is a beautifully written evocation of a lost and damaged world of childhood and the constants of his father's world: men defined by the drink they could take and the pain they could stand, men shaped by their guilt and machismo.
A Lie About My Father is about forgiving but not forgetting, about examining the way men are made and how they fall apart, about understanding that in order to have a good son you must have a good father.
'Memoir this good illuminates something larger than itself. It is an exercise in understanding, compassion and forgiveness' Sunday Telegraph
SaltireScottish Book of the Year and the Scottish Arts Council Non-Fiction Book of the Year.
He had his final heart attack in the Silver Band Club in Corby, somewhere between the bar and the cigarette machine. A foundling; a fantasist; a morose, threatening drinker who was quick with his hands, he hadn't seen his son for years.
John Burnside's extraordinary story of this failed relationship is a beautifully written evocation of a lost and damaged world of childhood and the constants of his father's world: men defined by the drink they could take and the pain they could stand, men shaped by their guilt and machismo.
A Lie About My Father is about forgiving but not forgetting, about examining the way men are made and how they fall apart, about understanding that in order to have a good son you must have a good father.
'Memoir this good illuminates something larger than itself. It is an exercise in understanding, compassion and forgiveness' Sunday Telegraph
SaltireScottish Book of the Year and the Scottish Arts Council Non-Fiction Book of the Year.