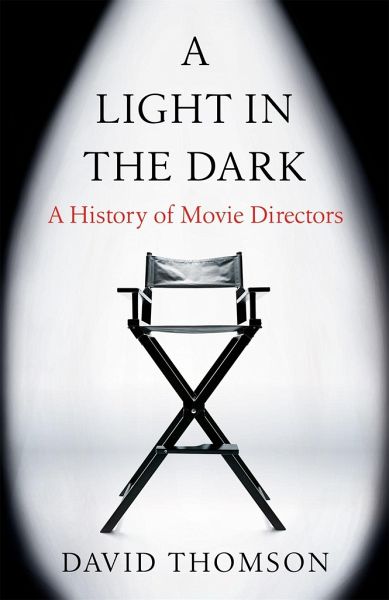
A Light in the Dark
A History of Movie Directors
Versandkostenfrei!
Versandfertig in 2-4 Wochen
16,99 €
inkl. MwSt.
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
8 °P sammeln!
A notable work by the doyen of writers about cinema
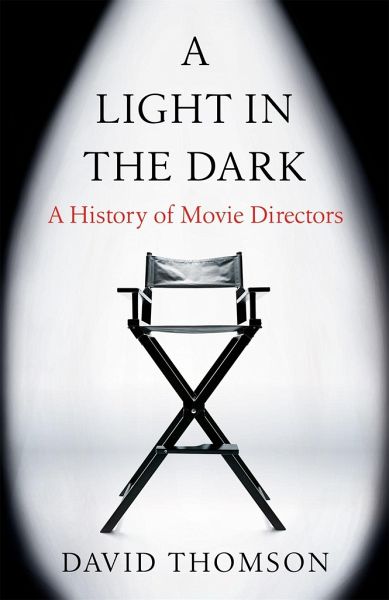
A History of Movie Directors

Rechnungen
Bestellstatus
Retourenschein
Storno