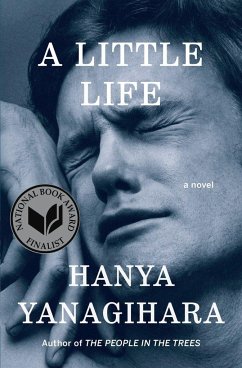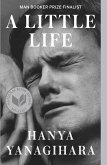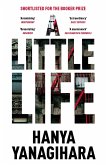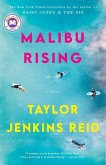NATIONAL BOOK AWARD FINALIST SHORT-LISTED FOR THE MAN BOOKER PRIZE Brace yourself for the most astonishing, challenging, upsetting, and profoundly moving book in many a season. An epic about love and friendship in the twenty-first century that goes into some of the darkest places fiction has ever traveled and yet somehow improbably breaks through into the light. Truly an amazement-and a great gift for its readers. When four classmates from a small Massachusetts college move to New York to make their way, they're broke, adrift, and buoyed only by their friendship and ambition. There is kind, handsome Willem, an aspiring actor; JB, a quick-witted, sometimes cruel Brooklyn-born painter seeking entry to the art world; Malcolm, a frustrated architect at a prominent firm; and withdrawn, brilliant, enigmatic Jude, who serves as their center of gravity. Over the decades, their relationships deepen and darken, tinged by addiction, success, and pride. Yet their greatest challenge, each comes to realize, is Jude himself, by midlife a terrifyingly talented litigator yet an increasingly broken man, his mind and body scarred by an unspeakable childhood, and haunted by what he fears is a degree of trauma that he'll not only be unable to overcome-but that will define his life forever. In rich and resplendent prose, Yanagihara has fashioned a tragic and transcendent hymn to brotherly love, a masterful depiction of heartbreak, and a dark examination of the tyranny of memory and the limits of human endurance.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Er wird geliebt, er wird gehasst, er wird gelesen - der Roman "A Little Life" der Amerikanerin Hanya Yanagihara
Wie heißt es so schön: In jedem dicken Buch steckt ein dünnes, das heraus will. Das gilt ganz sicher auch für "A Little Life", 720 Seiten stark, 720 englischsprachige wohlgemerkt (was in einer deutschen Übersetzung etwa 1000 Seiten gleichkommen dürfte), dem Roman, der in Amerika und England derzeit, wenn man sich die auf Twitter geteilten Leserbekundungen durchliest, für reichlich Tränen der Rührung und durchlesene Nächte sorgt. Zwar hat er weder den Man Booker Prize noch den National Book Award gewonnen (für beide war er nominiert), doch welches Buch braucht schon Preise, wenn es von seinen Lesern hemmungslose Begeisterung oder sogar Liebe entgegengebracht bekommt. Außerdem, das muss ordnungsgemäß erwähnt werden, hat es den Kirkus Prize gewonnen, und das sind neben der Ehre auch immerhin 50 000 Dollar.
"A Little Life" ist der zweite Roman von Hanya Yanagihara, 1975 in Los Angeles geboren, an verschiedenen Orten in den Vereinigten Staaten aufgewachsen, darunter mehrfach Hawaii. Ihr erstes Buch, "The People in the Trees" (2013), basierte auf der wahren Geschichte eines Arztes und Nobelpreisträgers namens Daniel Carleton Gajdusek, der in Papua-Neuguinea wirkte und Gutes tat - bis bekannt wurde, dass er viele der Kinder, die er dort so rührend adoptiert hatte, sexuell missbrauchte. Dieser Roman errang so etwas wie einen Achtungserfolg bei der amerikanischen Kritik, galt aber als schwierig oder jedenfalls nicht leicht zugänglich, weil er so kühl geschrieben war.
Für ihr Debüt brauchte Yanagihara zwölf Jahre - Buch Nummer zwei floss in 18 fiebrigen Monaten nur so aus ihr heraus, jedenfalls hat sie es so beschrieben. Dabei konnte sie nur abends, nachts und an Wochenenden daran schreiben. Denn im Haupt- oder Nebenberuf, je nachdem, wie man es betrachten will, arbeitet sie für "T", die Hochglanzstilbeilage der "New York Times". Vorher schrieb sie für das Reisemagazin "Condé Nast Traveller", etwa über Rajasthans farbenfrohe Textilien oder die sechs Dinge, die man in Asien getan haben muss, bevor man stirbt. Mit anderen Worten: die Schriftstellerin ist Journalistin. Was hierzulande nicht gerne gesehen wird (Stichwort Schuster und Leisten) - in Amerika ist es kein Problem. Da darf es ruhig sein, dass jemand spartenübergreifend schreibt, ohne dass es den Kollegen die Laune verschlägt - jedenfalls nicht gleich von vornherein schon aus Prinzip.
"A Little Life" erzählt von der Freundschaft von vier Männern in New York, die zu Beginn in ihren zwanziger Jahren sind - und am Ende des Buchs über fünfzig. Es fängt harmlos und vergnüglich an wie so viele tolle amerikanische Romane, die von Mittzwanzigern erzählen und dem damit verbundenen Lebensstil - ein bisschen melancholisch vielleicht, aber im Grunde voll Hoffnung und in Erwartung großer Dinge, die noch kommen. Doch beinahe unmerklich wandelt sich die Geschichte in etwas viel Dunkleres. Wie schon in ihrem ersten Buch geht es um Missbrauch und um seine Folgen - und als Hauptfigur, als eine Art Sorgen-Zentrum des Romans, entpuppt sich der labilste der vier, er heißt Jude und wird den traumatischen Ereignissen seiner Kindheit nicht entkommen.
Die Spielhandlung ist vage die Gegenwart. Es fehlen genaue Anhaltspunkte, ich glaube, es ist noch nicht einmal je ein Smartphone erwähnt, geschweige denn 9/11 oder ein Präsident. Die Autorin interessiert sich ausschließlich für ihre Figuren und wie es ihnen geht - und sie hat sich Männer als Protagonisten ausgesucht, wie sie in Interviews erzählte, weil deren emotionales Spektrum gesellschaftlich reglementiert sei. Weil Männern nicht so eine verschwenderische Palette von Gefühlsregungen zur Verfügung stehe wie ihr und ihren Freundinnen. Ihr ganzes Leben lang habe sie sozusagen in ihrem männlichen Freundeskreis recherchiert, wie diese Gefühle äußerten. Und alles Negative, also Angst, Zweifel, Traurigkeit et cetera, äußere sich da meistens in einer großen Sprachlosigkeit. Das habe sie als Schriftstellerin interessiert. Dem nachzuspüren, was ungesagt bleibe.
Der Roman ist eine Zumutung - nicht nur von der Länge her (und der Schwere des Buchs, das sich nicht gut halten lässt, jedenfalls nicht lange, jedenfalls nicht bequem), sondern auch von Teilen des Inhalts - und von seinem Hang zur Redundanz. Was Jude alles erleiden musste und muss, wie ihn das brach, wie oft er sich auf den 720 Seiten bei allen für alles Mögliche entschuldigt, vor allem dafür, dass es ihn gibt, es ist wirklich kaum auszuhalten. Aber Yanagihara hat es bewusst auf sich genommen, dass man ihr Buch zu viel finden kann. Sie habe ein Buch schreiben wollen, sagte sie, in dem alles maßlos sei. Und darüber habe sie mit ihrem Lektor harte Kämpfe ausgefochten. Der wollte, dass sie kürze, nicht alles ausführe, sondern einiges, vor allem die schlimmsten Einzelheiten des Missbrauchs, der Phantasie ihrer Leser überlasse, doch das wollte sie nicht.
Ganz ehrlich, ich hätte das Buch in der Version, die ihr Lektor vorschlug, lieber gelesen. Mir persönlich war es oft zu viel. Doch wie man weiß, ist persönlicher Geschmack eines Rezensenten exakt das, was in einer Rezension am allerwenigsten weiterführt - insofern gilt es nicht. Dies ist exakt der Roman, den die Autorin schreiben wollte, und auch wenn vieles daran unbequem ist oder einem Leser sogar lästig werden kann: es ist trotzdem ein in vielerlei Hinsicht bemerkenswerter Roman.
Da wäre zum einen die Lässigkeit, mit der hier Männerfreundschaft erzählt wird. Die Grenzen zur Homosexualität verwischen sich, beziehungsweise gesteht die Autorin ihren Protagonisten zu, dass es keine Begrenzungen gibt. Wo Freundschaft endet und Liebe beginnt, darum kreist dieser Roman, und irgendwann schleicht sich eben auch Begehren ein, und das passiert vollkommen undramatisch und so natürlich, als würden wir tatsächlich schon im Jahr 2015 nach Christus leben, und nachdem man beim Lesen kurz darüber stolpert, dass ein Mann, Willem, der einem bis dahin 445 Seiten als solide heterosexuell geschildert wurde, mit einem Mal nahezu beiläufig erkennt, dass er seinen langjährigen besten Freund liebt - "Und plötzlich schien seine Schüchternheit, seine Verwirrung, sein Schwanken albern. Er war zu Hause, und zu Hause, das war Jude. Er liebte ihn; es war ihm bestimmt, mit ihm zusammen zu sein; er würde ihm nie weh tun - da war er sich ganz sicher. Was also gab es da zu fürchten?" -, schüttelt man sich, schämt sich kurz - und liest weiter.
Und dann ist das Buch so aberwitzig unironisch. So über alle Maßen undistanziert. Seine Helden in Schutz nehmend. Liebevoll. Warm, fast schon mütterlich. Man mag kaum glauben, dass eine New Yorkerin es geschrieben hat, die sind doch sonst durch jahrzehntelange Therapien nicht in der Lage, irgendetwas direkt zu fühlen oder spiegeln, sondern alles ist mehrfach gebrochen, durchschaut und mit selbstreflektierendem, geistreichem Kommentar versehen und zuletzt dadurch jeder Bedeutung beraubt.
Yanagihara dagegen erlaubt ihren Helden beinahe schon Saint-Exupéry-hafte Einsichten und Lebensweisheiten. Etwa, hier spricht Jude zu einem jüngeren Menschen, dessen Mathenachhilfelehrer er ist: "Der einzige Trick an Freundschaft ist, glaube ich, Leute zu finden, die besser sind als man selbst - nicht klüger, nicht cooler, aber freundlicher und großzügiger und versöhnlicher - und sie dann dafür zu schätzen, was sie einem beibringen können, und zu versuchen, ihnen zuzuhören, wenn sie einem etwas über einen selbst sagen, ganz egal wie schlecht - oder gut - das sein mag, und ihnen zu vertrauen, was von allem das Schwerste ist. Aber auch das Beste."
Geschrieben ist das Buch in einer uneitlen Sprache, die höflich hinter der Handlung zurücktritt. Manchmal rammt es hart am Kitsch vorbei, was daran liegt, dass so viele Figuren ständig ihre Gefühle äußern. Vielleicht wollte Yanagihara der in der realen Welt beobachteten Sprachlosigkeit unter Männern etwas Mutmachendes entgegensetzen? (Willem, zu Jude: "Ich mache mir manchmal Sorgen, dass du beschlossen hast, dich selbst davon zu überzeugen, dass du irgendwie unattraktiv oder nicht liebenswert bist, und dass du entschieden hast, dass gewisse Erfahrungen außerhalb deiner Reichweite liegen. Aber das tun sie nicht, Jude: Jeder wäre glücklich, mit dir zusammen zu sein." (. . .) "Du hast recht. Es tut mir leid. Und ich bin dankbar, Willem, das bin ich wirklich. Aber das hier ist einfach zu schwierig für mich zu besprechen.")
"A Little Life" steht auf so gut wie allen englischsprachigen Beste-Bücher-des-Jahres-Listen, die dieser Tage im Minutentakt erscheinen. Auf Twitter finden sich zahlreiche Lesermeinungen wie diese: "A Little Life ist nicht nur ein Buch, es ist eine tiefgehende Lebenserfahrung". Oder: "Grad fertig mit A Little Life von Hanya Yanagihara. Raubt einem den Atem und bricht einem das Herz. Hab nicht so geschluchzt seit Der Gott der Kleinen Dinge". Oder: "Dieses Buch hat mein Leben ruiniert, Sie sollten es lesen."
Offenbar gibt es auf dieser Welt gerade eine Sehnsucht nach Gefühl. Nach ernst gemeintem, unmissverständlichem, unerschrockenem Gefühl.
JOHANNA ADORJÁN
Hanya Yanagihara: "A Little Life". Doubleday, 720 Seiten, 15,95 Euro. Bisher nur auf Englisch
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main