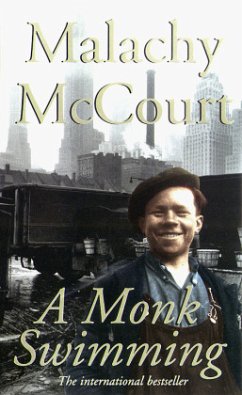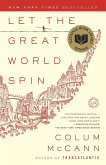1952 verlässt Malachy McCourt das irische Limerick, den Ort seiner Kindheit, den Ort der Armut und der Erniedrigung. Auf der "America" bricht er nach New York auf. Der Autor erinnert sich an seine Flucht vor dem trinkenden Vater, an die Ausschweifungen in New York. Mitten im wildn Lebensrausch bemerkt er, dass er den Erinnerungen an Limerick und den Prägungen durch seine Eltern nicht entfliehen kann.

Macht Durst: Malachy McCourt auf durchweichten Lebenspfaden
Alle Menschen haben ihre Geschichte, aber nur wenige können sie amüsant erzählen. Malachy McCourt, Amerikaner aus Irland, kann es. Dabei ist er kein Schriftsteller im klassischen Sinne, sondern ein Schauspieler mit blühender Fantasie und großer Mitteilungs- und Schreiblust. Er führt seine narrativen Neigungen auf seine nationale Abstammung zurück, und vielleicht ist es der Ire in ihm, der hemmungslos plaudert. Auf jeden Fall prägt ihn ein Sippenerbe. Auch der ältere Bruder, Frank McCourt, hat seinen Buchbeitrag zur Familiengeschichte geliefert.
Was Malachy McCourt über die Suaden des gemeinsamen Vaters zu berichten weiß, das sprengt alle Vorstellungen. Im Übrigen hat Malachy junior nichts Positives über den Senior zu sagen. Der war offenbar ein Negativ-Ire von der Stange, sauffreudig, hinter Weiberröcken her, zeugungsstark und unfähig, die bedrohlich wachsende Familie vor sozialem Elend zu bewahren.
Warum die McCourts, nach der Geburt von Frank und Malachy, aus New York ins südwestirische Limerick wechselten, ist dem erzählenden Sohn entweder unklar oder egal, er gibt uns keinen Hinweis. Jedenfalls wurde die Stadt zum Schauplatz einer bedrückenden Geschichte, in der kleine Geschwister Hungers sterben, der Vater sich verdrückt, die Mutter in Depressionen versinkt. Die Brüder Frank und Malachy träumten von der Flucht zurück in die unbegrenzten Möglichkeiten des Landes, in dem sie zur Welt gekommen waren. Sie gelang ihnen: 1949 ging Frank nach New York und holte 1952 den Jüngeren nach.
Malachy in Amerika, das ist der eigentliche Inhalt des Erinnerungsbuches, aber die irische Misere schaut immer durch. Sie tut es nicht nur deshalb, weil man die Erinnerung an seine Herkunft nicht abschütteln kann. Wesentlicher ist, dass Malachy das meiste von dem Irentum, das er am Vater und an dessen Saufkumpanen verabscheut hatte, selbst verkörpert. Auch er ist den Teufelsgetränken zugeneigt. Auch er bramarbasiert, dass die Schwarte kracht, kehrt den Frauenhelden heraus, ist ein Familienvater von zweifelhaftem Wert. Niemals versucht er, sein Selbstporträt zu retuschieren, er malt sich als den Schubiack, der er war. Wer erwartet, einer Beichte samt Reue und Besserung auf der Spur zu sein, der wird enttäuscht. Die Sünden, für die Malachy den Vater verurteilt, erscheinen, wenn er sie begeht, als lässlich. Die eigene Rolle als irischer Lümmel gefällt ihm offenkundig, manchmal aalt er sich darin. Sie hat ihm ja auch eine Menge Spaß gebracht, und, das muss man ihm lassen, er weiß den Spaß an sein Publikum weiterzugeben. Heiterkeit keltert er aus seinen Versuchen, eine Berufslaufbahn zu Stande zu bringen. Am Anfang, da ist er zwanzig, malocht er in den New Yorker Docks, wird dann Barmann in gängigen Lokalen. Danach gelingen ihm Auftritte in TV-Talkshows und auf Off-Broadway-Bühnen. Schließlich macht er Geld, indem er aus europäischen Städten Goldbarren nach Indien und in andere asiatische Fernen schmuggelt. Solche Abenteuer bringen ihm abstruse Einblicke in fremdländische Hinterzimmerbetten, und durch jede Türritze, die er entdeckt, lässt er auch uns schauen.
Er kann gar nicht anders, manischer Geschichtentransporteur, der er ist. Er hat auch vor seinen orientalischen Ausflügen nicht anders gekonnt. Wenn wir mit ihm an den New Yorker Bartresen sitzen, begegnen wir allen, über die während der fünfziger und sechziger Jahre die Skandalblätter schreiben: Frank Sinatra und Peter O'Toole, Rex Harrison und Brendan Behan, Shirley MacLaine, Grace Kelly und viele andere mehr. Wir tumben Europäer kennen so manchen Namen kaum, und einen erklärenden Anhang hat sich der Autor gespart. Doch was wir verstehen, scheint ein Beweis dafür, dass es in New Yorks Flimmer-Society wirklich so zuging, wie manche amerikanischen Filme es zeigten. Malachy ist offenkundig stolz darauf, all den Prominenten begegnet zu sein. Wie stolz, das verrät das Understatement, mit dem er sein Namedropping betreibt: Er präsentiert die Berühmtheiten cool und rotzig wie ein Teenie, der in der Disco seine Kumpels entdeckt. Denselben Ton hat er drauf, wenn er auf die Politikgeschichte des zwanzigsten Jahrhunderts zu sprechen kommt, besonders wenn es um Politiker geht, die den Erdball erschütterten.
Wie hat sich der erzählfreudige Sauf-Ire nach seinem Sturm und Drang in der Welt eingerichtet? Wir erfahren es nicht, die reiferen Jahre kommen, obwohl die Originalausgabe erst 1998 erschien, in Malachys Autobiografie nicht vor. Vielleicht gibt es gar keine reiferen Jahre? Oder der Autor hat sich in eine Ordnung geschickt, die ihm zu langweilig schien, um sie Lesern zuzumuten? Wie auch immer, ein schlüssiges Resümee seines Lebensberichtes lässt sich nicht ziehen. So bleibt uns nur ein Flirt mit der Kunstgattung, die den Namen der Titelstadt trägt: "Nach New York kam Malachy aus Irland, / welcher stets einen Schnaps und ein Bier fand. / Ja, er soff jeden Schluck, / schrieb darüber ein Book. / Darin steht, dass er alles recht wirr fand."
SABINE BRANDT.
Malachy McCourt: "Der Junge aus Limerick". Erinnerungen. Aus dem Englischen übersetzt von Claudia Feldmann. Argon Verlag, Berlin 1999. 332 S., geb., 38,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main