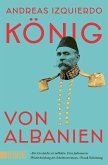Abrauschen - von Berlin-Neukölln nach Salzburg und wieder zurück. Frech und geistesgegenwärtig erzählt Kathrin Röggla von einer rasant-komische Reise durch die Großstadt, die Provinz, das Leben und die Sprache. »Ein unentwegtes Crossover von Slang, Straßenstimmen, Wortspielen und Poesie. Die Sprache von Abrauschen ist schnell und gelenkig, beweglich genug, um die irrwitzig dahin- und durcheinanderschießenden Phänomene dieser 90er-Jahre-Welt einzufangen.« Uwe Pralle, Frankfurter Rundschau

Mit Kathrin Röggla unterwegs in der Prärie des Selbst
Was den Romantikern das Waldesrauschen war und späteren Dichterschulen das Grundrauschen der Großstadt, ist den Nachwuchsautoren der Netsurfer-Generation das Geräusch, das die Luftkühlung des Computers erzeugt. Letzteres dürfte in die Literaturgeschichte eingehen als die Begleitmusik, bei der sich am unbefangensten verewigen ließ, was einem, um es im mählich aussterbenden Jargon der "Neuen Frankfurter Schule" zu sagen, durch die Rübe rauschte. Schreibt man alles klein, wie die Salzburgerin Kathrin Röggla, Jahrgang 1971, in ihrem etwas übermütig als Roman deklarierten Prosastück "Abrauschen", fließt der Wortstrom noch widerstandsloser. Ist das Ventil einmal entsichert, die Schleuse geöffnet, gibt es kein Halten mehr, vom fast konventionellen Beginn - "mein vater war ein gartenzwerg, d.h. zwerg ist das falsche wort, aber immerhin, man kann was damit anfangen" - bis zum eher vorläufigen Ende: "irgendwie riecht es nach meer, habe ich mir aber eben gedacht und bin endlich weitergegangen."
Das rutschige Surfbrett dieser cool auftretenden, doch mit unzähligen Füllwörtern wie zum Schutz gepolsterten Sprache trägt die Erzählerin von Berlin-Neukölln, wo sie einen Teil ihres jungen Lebens verbracht hat, in ihre Heimatstadt Salzburg, wo sie ein geerbtes Appartement vorübergehend bewohnen und dann verkaufen will. Denn "man braucht eben geld, um loszuheizen quer durch die selbstprärie". Die Exponentin der "erbsengeneration" hat ihr Söhnchen bei sich, das manchmal sechs Jahre alt ist, manchmal verblüffend frühreif und schließlich gespenstisch gealtert. Das Nomadenlager von Mutter, Kind und Fernseher wird zeitweise durch den Erzeuger des Kleinen, einen Berliner Brillenträger mit Potenzproblemen, zum Beinahe-Idyll komplettiert: "wir ziehen jetzt an einem familienstrang, und in diesem flaschenhals sitzt man ein leben lang."
Aber die Flasche wird nicht verkorkt, vielmehr: "miteinander 1 glas warmes wasser werden, das ist mit uns nicht drin." Der Freund "vertschüßt" sich, wie man in jenen Kreisen sagt, und der Sohn gibt, wenn wir das richtig verstanden haben, mit allen Symptomen von Altersschwäche seinen Geist auf. Die Heldin hingegen kehrt in ungebrochener Jugendlichkeit nach Berlin zurück und ist "im prinzip doch nur ein gefrierfach weitergekommen".
Eine traurige Geschichte, die den aufgedreht geschwätzigen Tonfall des Textes Lügen straft, und eine alte Geschichte obendrein, vom neonfarbenen Lack des Zeitgeistes nur notdürftig überdeckt. Das Daseinsgefühl der mit allen Szene-Wassern gewaschenen Städteflüchterin schwankt zwischen zwei simplen Sehnsüchten: "abhauen" und "andocken", Freiheit und Geborgenheit. Und wie Heerscharen von Späterwachsenen vor ihr fürchtet sie, es könne ihr durch Stillstand etwas Wesentliches entgehen: "ja, auflösen möchte ich mich, zu einem faden werden, der sich durch die stadt strickt, und nicht zu einer tastenkombination, die man drückt und dann steht man da als anrufbeantworter. nicht irgend so ein wischi-waschi-unternehmen hat man sich an land gezogen, sondern ein leben!"
Spaß, neudeutsch Fun, ist bei dieser Gemütslage längst nicht mehr angesagt. Salzburg und Berlin sind hier an Trostlosigkeit einander ebenbürtig: das eine die provinzmiefige Kehrseite einer Festspielstadt, das andere eine unwirtliche Metropolenbaustelle, wo Achtundsechziger-Fossilien vom "vormauerfallberlin" schwärmen. Kathrin Röggla ist eine wache Beobachterin, und zwischen den Untiefen und Trübstellen, die in ihrem Rede- beziehungsweise Schreibschwall lauern, leuchten immer wieder Bilder von erfrischender Originalität und Skurrilität auf.
Die Sprache freilich, die auf den ersten Blick so schick verwildert und experimentierfreudig anmutet, nervt mit modischem Müll: Da hat ständig jemand etwas "am laufen", Inversionen wie "ist mein toter vater wieder aufgetaucht" und Vergleiche nach dem Muster "diese liegemumie an frau" lassen sich kaum mehr zählen. Zweisprachige Konstruktionen, als da sind "das total neglected kind" oder "dein little leben", mögen zwar milieugetreu wiedergegeben sein, wirken aber leider bloß albern. Sei's drum: Wo es rauscht, da klappert mit Sicherheit auch irgendwo die Mühle. Doch "gegen dieses rauschen", schreibt Kathrin Röggla ganz richtig, "ist kein kraut gewachsen". KRISTINA MAIDT-ZINKE
Kathrin Röggla: "Abrauschen". Roman. Residenz Verlag, Salzburg und Wien 1997. 124 S., geb., 34,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main