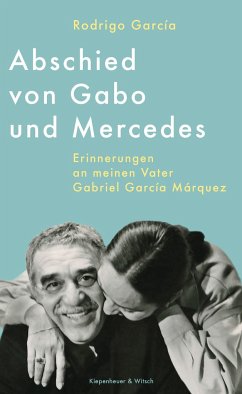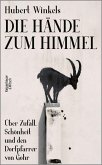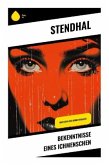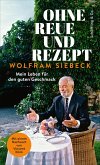»So ist das eben mit Ihrem Vater«, sagt seine Sekretärin zu mir. »Er kann sogar über Hässliches schön sprechen.«
Als Gabriel García Márquez von seinen Ärzten im März 2014 ins Krankenhaus eingewiesen wird, setzt sofort ein riesiger Rummel ein, denn es gibt im Krankenhaus kaum jemanden, der nicht plötzlich dringend in seinem Zimmer etwas zu erledigen hätte. Nach der Untersuchung kommt die niederschmetternde Nachricht: Wahrscheinlich sei es Lungenkrebs, er habe nicht mehr lange zu leben. Die Familie beschließt, ihn nach Hause zu holen, wo sich die Situation schnell zuspitzt: Aus der ursprünglich prognostizierten Lebenserwartung von Monaten werden Wochen, dann nur noch 24 Stunden.
Mit großer Wärme, in vielen Rückblicken und einer fast schon schelmischen Haltung zum Tod erinnert sich der Sohn, ein Filmemacher, in diesem wunderbaren Text an den Tod und das Leben seines Vaters, die außergewöhnlich symbiotische Beziehung seiner Eltern und den späteren Tod seiner Mutter,um beiden ein Denkmal zu setzen.
Als Gabriel García Márquez von seinen Ärzten im März 2014 ins Krankenhaus eingewiesen wird, setzt sofort ein riesiger Rummel ein, denn es gibt im Krankenhaus kaum jemanden, der nicht plötzlich dringend in seinem Zimmer etwas zu erledigen hätte. Nach der Untersuchung kommt die niederschmetternde Nachricht: Wahrscheinlich sei es Lungenkrebs, er habe nicht mehr lange zu leben. Die Familie beschließt, ihn nach Hause zu holen, wo sich die Situation schnell zuspitzt: Aus der ursprünglich prognostizierten Lebenserwartung von Monaten werden Wochen, dann nur noch 24 Stunden.
Mit großer Wärme, in vielen Rückblicken und einer fast schon schelmischen Haltung zum Tod erinnert sich der Sohn, ein Filmemacher, in diesem wunderbaren Text an den Tod und das Leben seines Vaters, die außergewöhnlich symbiotische Beziehung seiner Eltern und den späteren Tod seiner Mutter,um beiden ein Denkmal zu setzen.

Zum zehnten Todestag des großen kolumbianischen Schriftstellers Gabriel García Márquez erscheinen zwei neue Bücher: eines von ihm und eines über ihn. Welches soll man lesen?
Von Hernán D. Caro
Bereits Monate bevor der Roman "Wir sehen uns im August" des vor zehn Jahren verstorbenen kolumbianischen Nobelpreisträgers Gabriel García Márquez jetzt postum erschienen ist, hatte sich eine kleine Debatte entfacht. Denn wie die beiden Söhne des Schriftstellers, Rodrigo und Gonzalo García Barcha, im Vorwort des Buches eingestehen, sagte ihr Vater einst über den Roman: "Dieses Buch taugt nichts. Es muss vernichtet werden."
Darf man ein Werk, das ein Schriftsteller verstoßen hat, nach dessen Tod doch herausbringen? Die Antworten auf diese ewige Frage, diesmal von der spanischsprachigen Zeitschrift "WMagazín" gestellt, waren - wie zu erwarten - widersprüchlich. "Es liegt ein Funken Eitelkeit darin, von einem anderen zu verlangen, das zu zerstören, was man geschaffen hat", sinnierte ein Autor. "Man weiß, dass der andere es nicht tun wird." Eine Buchhändlerin nannte die Veröffentlichung des Romans "das gute Recht" der Erben - und freute sich über das Geschäft. Ein anderer Buchhändler prangerte "diese Praxis" an, "den Autor als Ware zu fetischisieren". Franz Kafka und Max Brod wurden erwähnt. Und jemand verwies auf einen Spruch, der von Henry James stammen soll: "Es ist unmoralisch, die Taschen und Schubladen eines Toten zu durchsuchen."
Jetzt, da der Roman also erschienen ist, sind die Meinungen über seine Qualität ebenso gespalten. Während die spanische Zeitung "La Vanguardia" das Buch für ein "weiteres Meisterwerk des Autors von 'Hundert Jahre Einsamkeit'" hält, hätte man sich laut der "New York Times" einen "unbefriedigenderen Abschied" von García Márquez "kaum vorstellen können".
"Wir sehen uns im August" erzählt die Geschichte von Ana Magdalena Bach, einer Frau mittleren Alters, die jeden August von Neuem auf eine karibische Insel fährt, um am dortigen Friedhof einen Strauß Gladiolen auf das Grab ihrer Mutter zu legen. Ana Magdalena liebt Bücher und Musik, hat von der Mutter "das Leuchten der goldenen Augen", die "Tugend der wenigen Worte und die Klugheit, ihr Temperament zu zügeln", geerbt und ist seit vielen Jahren glücklich verheiratet.
Bei einem ihrer Inselbesuche lernt die Frau einen eleganten Ausländer kennen. Sie trinken ein Glas zusammen, führen ein "banales Gespräch" - der Mann ist weder besonders kultiviert noch besonders lustig, er hat aber "ein gutes und zaghaftes Herz" - und schließlich schlafen sie miteinander, wobei der Mann sich als "vortrefflicher Liebhaber" offenbart, der Ana Magdalena "ohne Eile zum Siedepunkt führte".
Als die Frau am nächsten Tag erwacht, ist der schneidige Fremde weg. Ihr bleiben nur das kränkende Geschenk eines Zwanzigdollarscheines, die "brutale Erkenntnis", zum ersten Mal in ihrem Leben "mit einem Mann, der nicht der ihre war, gevögelt" zu haben, und das brennende und verwirrende Verlangen danach, diese Nacht zu wiederholen. Und so endet das erste der insgesamt sechs kurzen Kapitel des Romans.
Dieses Kapitel hatte García Márquez im Jahr 1999 bei einem literarischen Treffen in Madrid vorgelesen. Damals sprach er von der ersten Kurzgeschichte eines geplanten Erzählbands. Stattdessen erschien dann aber 2002 García Márquez' hervorragende Autobiographie "Leben, um davon zu erzählen" und zwei Jahre später der Kurzroman "Erinnerung an meine traurigen Huren", den viele aus gutem Grund problematisch, wenn nicht anstößig fanden: Es geht darin um einen Neunzigjährigen, der gern mit einer vierzehnjährigen Prostituierten schlafen würde. Dieses Werk galt bisher als das letzte des Autors.
Wie man nun aber weiß, arbeitete García Márquez an "Wir sehen uns im August" weiter - und aus der Erzählung wurde ein Roman. Allerdings war diese Arbeit, wie seine Söhne berichten, äußerst beschwerlich. Denn García Márquez litt in seinen letzten Jahren an Demenz. "Die Erinnerung ist zugleich mein Rohstoff und mein Werkzeug", soll er gesagt haben. "Ohne sie ist alles dahin." Die Krankheit habe es für ihn unmöglich gemacht, den Roman zu einem befriedigenden Abschluss zu bringen. So fällte er irgendwann das oben zitierte vernichtende Urteil über sein eigenes Buch.
Trotzdem haben die Söhne entschieden, es zu veröffentlichen. Nach einer erneuten Lektüre des Romans hätten sie ihn "sehr viel besser" als noch zuvor gefunden. Und sie vermuten in ihrem Vorwort, dass "eben die eingeschränkten Fähigkeiten", die García Márquez nicht mehr erlaubten, mit der "gewohnten Sorgfalt" zu schreiben, ihn womöglich auch daran gehindert haben, zu erfassen, wie gut der Roman "ungeachtet seiner kleinen Mängel" sei.
Die erzählerische Prämisse, die im ersten Kapitel von "Wir sehen uns im August" gesetzt wird, ist spannend - wenn auch nicht besonders originell. Eine Frau, in deren Alltag Liebe, Zufriedenheit und Struktur herrschen, wird plötzlich von der Erfahrung der leichtsinnigen Lust überwältigt. Die bringt sie aus dem Gleichgewicht, erfüllt sie aber auch mit Neugier und Lebensdrang. So entscheidet Ana Magdalena, ihr eigenes Schicksal zu gestalten - und sei es nur für eine Nacht im Jahr. Bei ihren nächsten Inselfahrten wird sie jenen Fremden zwar nicht mehr finden können, dafür aber andere Liebhaber und dadurch auch einigermaßen sich selbst.
Es gibt in "Wir sehen uns im August" Momente, die an bekannte und beliebte narrative Stärken des Autors erinnern. Die erste Szene des Romans, in der Ana Magdalena auf der namenlosen Insel ankommt, beispielsweise: Die Ortschaft, durch die sie auf dem Weg zu ihrem Hotel - dem "ältesten und schäbigsten" - vorbeifährt, ist von jener besonderen Widersprüchlichkeit, die viele der Schauplätze von García Márquez' Werken kennzeichnet: Sie sind arm, heiß, abgelegen - aber auch auf mysteriöse Weise bezaubernd: "Der Chauffeur", lesen wir, "fuhr sie holpernd durch den ärmlichen Ort mit seinen Häusern aus Rohr und Lehm, den mit Palmwedeln gedeckten Dächern und dem glühenden Sand der Straßen vor einem Meer in Flammen."
Auch später treffen wir auf manche jener Motive, die viele Leserinnen und Leser an García Márquez am meisten schätzen, wie etwa die unverschämte und dabei oft berührende Freiheit, mit der er das Begehren verlorener Seelen schildert; die Beschreibung der so zärtlichen wie leidenschaftlichen Intimität, die - ausgerechnet! - Eheleute verbinden kann; oder die melancholische Erkenntnis - zu der in García Márquez' Büchern weniger die Protagonisten als die Leser selbst gelangen -, große Liebe und große Einsamkeit seien unzertrennlich.
Doch sehr bald werden die Probleme von "Wir sehen uns im August" immer deutlicher. Den Figuren des Romans fehlt es an Tiefe. García Márquez beobachtet vor allem ihre Handlungen, ihr Innenleben bleibt im Großen und Ganzen unangetastet. Dadurch erscheinen die Figuren wie Marionetten - und der Roman selbst wirkt eher wie ein Entwurf als eine lebendige Geschichte.
Oft öffnet García Márquez Erzählstränge, die ins Nichts führen. Oft wiederholen sich Beschreibungen und Informationen. Zweimal bestellt Ana Magdalena Gin mit Eis und Soda, zweimal erfahren wir, dieses sei "das einzige alkoholische Getränk, das sie gut vertrug". Die Szenen, in denen sich die Frau und die Männer, die sie auf der Insel kennenlernt, annähern, sind fast identisch - Hotelbar, altmodische, süßliche Livemusik, aufreizender Tanz. Die Männer selbst sind immer rätselhaft, "vornehm" gekleidet und unglaublich gut im Bett.
Vor allem aber vermisst man im neuen Roman schmerzhaft den Sinn für Humor, eine gewisse ironische Distanz, mit der García Márquez die überschwänglichen, dramatischen, tragischen, wunderschönen Liebesgeschichten von "Hundert Jahre Einsamkeit" oder "Die Liebe in den Zeiten der Cholera" kontrastierte. An einer Stelle von "Wir sehen uns im August" heißt es: "Dann sah sie ihn über die Schulter hinweg an, und ihr blieb die Luft weg. 'Pardon', sagte sie verblüfft, 'aber ich bin nicht passend gekleidet.' Seine Erwiderung kam sofort: 'Sie kleiden das Kleid.' Der Satz beeindruckte sie. . . . Dann schaute sie erneut über die Schulter, nun nicht mehr, um den Besitzer der Stimme kennenzulernen, sondern um ihn mit den schönsten Augen, die er je sehen sollte, in Besitz zu nehmen. 'Sie sind sehr liebenswürdig', sagte sie charmant, 'es gibt keine Männer mehr, die so etwas sagen.'" Diese und andere ähnliche Stellen sind einfach kitschig.
Das mögen harte Worte sein. Doch gelten sie einem Schriftsteller, der einige der besten literarischen Werke des 20. Jahrhunderts geschrieben hat, dessen Romane und Erzählungen von einzigartiger Phantasie und Beobachtungsgabe, stilistischer Genauigkeit und emotionalem Reichtum sind, der faszinierende, komplexe Welten und Protagonisten schuf - und der in dem Bewusstsein, dass seine kreativen Kräfte am Ende seines Lebens nachgelassen hatten, jenes Buch, bei dem diese Kräfte vermisst werden, nicht veröffentlichen wollte. Gerade deswegen ist die Lektüre von "Wir sehen uns im August" frustrierend - und die Veröffentlichung des Romans eine unglückliche Entscheidung. Die Söhne des Schriftstellers lügen nicht, wenn sie ihre Entscheidung - irritierenderweise - selbst einen "Akt des Verrats" nennen.
Und so könnte die Affäre hier enden. Aber vielleicht gibt es in dieser Geschichte wenn auch keine gute Wendung, so doch so etwas wie eine kuriose und schöne Coda.
Parallel zur Veröffentlichung von "Wir sehen uns im August" erscheint auf Deutsch auch ein schmaler Band mit dem Titel "Abschied von Gabo und Mercedes". Autor ist der in Los Angeles lebende Fernseh- und Filmregisseur Rodrigo García: derselbe Sohn von García Márquez also, der mit seinem Bruder, trotz des Verbots des Vaters und der "kleinen Mängel" im Manuskript von "Wir sehen uns im August", seine Finger nicht davon lassen konnte - und der noch dazu gerade "Hundert Jahre Einsamkeit" als Serie für Netflix adaptiert, auch wenn der Nobelpreisträger die Verfilmung des Romans immer abgelehnt hat.
Und doch hat dieser Sohn ein liebevolles, ergreifendes und ja respektvolles Buch geschrieben, das die eigentlich besondere Neuerscheinung zum zehnten Todestag des Autors ist. Die Wege der Liebe, wie die Leser von García Márquez es wissen, sind eben unergründlich.
Rodrigo García erzählt von der Krankheit und dem Tod seines Vaters im April 2014 und auch vom Tod seiner Mutter Mercedes Barcha, der langjährigen Ehefrau von García Márquez, sechs Jahre später. Er schreibt von der eisernen Disziplin des Schriftstellers bei der Arbeit, aber auch von seiner Wärme, seinem Witz und seinem hartnäckigen Optimismus. Wir erfahren von García Márquez' Verzweiflung angesichts seines zunehmenden geistigen Verfalls und auch von seinen Versuchen, diesen Verfall mit Humor zu nehmen: "Ich verliere das Gedächtnis, aber zum Glück vergesse ich, dass ich es verliere", pflegte der Schriftsteller zu sagen. Oder auch: "Alle behandeln mich wie ein Kind. Wie gut, dass ich das mag."
Einmal geht es in "Abschied von Gabo und Mercedes" um García Márquez' Zustand kurz vor seinem Tod. "Vor einigen Monaten fragte mich eine Freundin, wie es meinem Vater mit seinem Gedächtnisverlust gehe", schreibt der Sohn. "Ich antwortete, er lebe ausschließlich in der Gegenwart, unbelastet von der Vergangenheit, frei von Erwartungen an die Zukunft . . . 'Er weiß also nicht, dass er sterblich ist', schloss sie. 'Der Glückliche.'" Vielleicht ist dies der würdige letzte Blick auf den großen Erzähler.
Gabriel García Márquez, "Wir sehen uns im August". Aus dem Spanischen von Dagmar Ploetz. 144 Seiten, 23 Euro. Rodrigo García: "Abschied von Gabo und Mercedes". Aus dem Englischen von Elke Link. 176 Seiten, 22 Euro. Beide sind im Verlag Kiepenheuer & Witsch erschienen.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur FAS-Rezension
Zum zehnten Todestag von Gabriel García Márquez erscheinen zwei Bände, die sich Rezensent Hernán Caro vornimmt: Gabriel García Márquez' nachgelassenes Romanfragment "Wir sehen uns im August" und die Erinnerungen von Sohn Rodrigo García, der in "Abschied von Gabo und Mercedes" vom Leben seiner Eltern erzählt , "liebevoll, ergreifend und, ja, respektvoll", so Caro. Die Demenzerkrankung seines Vaters spielt hier ebenso eine Rolle wie dessen Schreibarbeit, aber auch die Versuche, der Krankheit mit Humor zu begegnen, erfahren wir, etwa, wenn er davon spricht, dass er immerhin vergesse, dass er alles vergisst. Ein "würdiger letzter Blick" auf den kolumbianischen Literaturnobelpreisträger, befindet Caro.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»Ein erstaunliches Buch. Das Werk eines Mannes, der nicht nur Begabung, Sensibilität und Takt besitzt, sondern auch ein sehr guter Handwerker ist. Als Drehbuchautor, Filmregisseur und Produzent in Los Angeles weiß er genau, wann eine Szene fertig ist und das nächste Wort zuviel wäre.« Paul Ingendaay FAZ Podcast 20240407
Noch einmal in die karibische Wunderwelt
Ein letztes, allerletztes Werk von Gabriel García Márquez aus dem Nachlass. Und ein bewegendes Buch seines Sohnes Rodrigo über die Demenz des Vaters: Wer muss da nicht heulen?
Als Gabriel García Márquez 2014 im Alter von 87 Jahren starb, war er schon seit einiger Zeit dement. Wie lange lässt sich nur ungefähr sagen, denn der Verfall der schöpferischen Kraft des kolumbianischen Nobelpreisträgers ging in kleinen Schritten über einen längeren Zeitraum vor sich. Über den letzten großen öffentlichen Auftritt von "Gabo", wie man ihn in der spanischsprachigen Welt nennt, am 26. März 2007 beim Kongress der spanischen Sprache in Cartagena de Indias (Kolumbien) haben nicht nur wir in der F.A.Z. berichtet, die Szene diente auch dem Biographen Gerald Martin als eindringliches Schlussbild seines Buches "Gabriel García Márquez: A Life" (2008).
Martin schildert dort einen Mann von achtzig Jahren, der auf seinen vierzig Jahre zuvor erschienenen Kultroman "Hundert Jahre Einsamkeit" und den 25 Jahre zuvor erhaltenen Literaturnobelpreis zurückblickt; der die Ehrung durch fünf kolumbianische Präsidenten und den spanischen König entgegennimmt und dann auch noch seinen Freund Bill Clinton begrüßt, weil man sich unter Superpromis eben kennt; der sich an die Entbehrungen erinnert, die er mit seiner Frau Mercedes geteilt hat, bevor ihn 1967 der Weltruhm und der Aufstieg zur lateinamerikanischen Kulturikone ereilten; und der nun, während er es einigermaßen achtbar durch seine Rede schafft, die größte Distinktion nach dem Nobelpreis erlebt: dass die Königlich-Spanische Akademie ihn ehrt, indem sie zu seinem Geburtstag in die Karibik reist und dem neuen Literaturspanisch denselben Rang zuweist wie dem alten. Cervantes und García Márquez, vier Jahrhunderte voneinander entfernt, Verfasser der beiden größten, wirkmächtigsten, meistverkauften Romane der spanischen Sprache. "Hundert Jahre Einsamkeit", so der Biograph Gerald Martin, sei sogar der erste "globale Roman" überhaupt. So steckt alles voller Symbolik, tönendem Pathos und Panhispanismus, was an Gabo natürlich vorbeigeht, denn er hält nichts von salbungsvollem Quaken und Männern im dunklen Anzug. Minutenlange Ovationen folgen. Doch der leicht verwirrte Schriftsteller, dem sie gelten, kann sich nicht einmal mehr an alles erinnern, was er in seinem Leben geschrieben hat.
Man muss dieses langsame Verlöschen eines der großen Sprachkünstler des vergangenen Jahrhunderts vor Augen haben, wenn man von seiner Spätzeit spricht. Es gibt keinen besseren Zeugen dafür als Rodrigo García Barcha, den älteren der beiden Söhne. García, der schon seit Jahrzehnten als Filmregisseur und Produzent in Los Angeles lebt, konnte bei seinen Besuchen in Mexiko-Stadt oder auf Familienfesten über Jahre hinweg das Fortschreiten der Alzheimer-Krankheit seines Vaters beobachten. In einem bewegenden Buch, das jetzt bei Kiepenheuer & Witsch auf Deutsch erschienen ist - "Abschied von Gabo und Mercedes" (F.A.Z. vom 28. Mai 2021) -, erzählt der heute Fünfundsechzigjährige von den schwierigen, traurigen, aber auch abgrundtief komischen Szenen, die sich zwischen den Söhnen und ihrem weltberühmten Vater in Mexiko-Stadt ereigneten. "Wer sind die Leute da im Nebenzimmer?", fragt der Schriftsteller einmal die Haushälterin. "Ihre Söhne", lautet die Antwort. "Wirklich? Diese Männer? Carajo. Das ist ja unglaublich." Zwischen Sorge und Einsicht, Kummer und Krankenschwester-Witzen (Gabo bleibt ein kolumbianischer Macho) entfaltet sich in dem schmalen Buch ein Sterbedrama, das durch die pointierte Prosa des Sohnes auch literarisch beeindruckt.
Er habe sich an Joan Didions "Das Jahr des magischen Denkens" und Philip Roths "Mein Leben als Sohn" orientiert, sagt Rodrigo García im Videochat von Los Angeles aus. Doch die absurde Seite von Verfall und Tod habe ihn schon lange fasziniert. Nicht umsonst hat er an der gefeierten HBO-Serie "Six Feet Under" mitgearbeitet, deren Dreh- und Angelpunkt ein familiengeführtes Bestattungsunternehmen ist. "Schon die Tatsache, dass das Leben endet, ist ja absurd. Und obwohl wir uns daran gewöhnt haben sollten, macht uns das Ende des Lebens immer noch sprachlos."
Dann kommt García auf die Erinnerung zu sprechen, memoria - die eigene, die durch das Sterben in Gang gesetzt wird, und die andere, deren Verschwinden den Vater zur Verzweiflung treibt, bis er lernt, ein Leben ohne persönlichen Echoraum zu akzeptieren. Im Buch gelten dem Gedächtnisverlust des Vaters die traurigsten Szenen. Einmal sagt eine Sekretärin: "Was machen Sie hier draußen, Don Gabriel?" - "Weinen." - "Weinen? Sie weinen doch gar nicht." - "Doch. Aber ohne Tränen. Ist Ihnen nicht bewusst, dass mein Kopf jetzt kaputt ist?" Es ist zum Heulen, es ist die Wahrheit, es ist das Ende eines beispiellosen Lebens. So geht es einem Mann, der den erstaunlichen Satz gesagt hat, nach seinem achten Lebensjahr habe er eigentlich nichts Wichtiges mehr erlebt. "Erinnerung", sagt Rodrigo García, "ist das einzige Thema des Schriftstellers. Für meinen Vater war sie der wichtigste Rohstoff."
Eine Rekonstruktion ganz anderer Art stellt das globale literarische Ereignis dieser Tage dar: Heute erscheint, in vielen Sprachen zugleich, García Márquez' nachgelassenes Buch "Wir sehen uns im August" (Kiepenheuer & Witsch). Die Übersetzung stammt wie beim Buch des Sohnes von der begnadeten Dagmar Ploetz. Zwei Kapitel waren schon vor vielen Jahren in Spanien und Kolumbien in der Presse erschienen, man war beeindruckt, aber Genaueres wusste niemand. War das schmale Werk, eher eine Novelle als ein Roman, überhaupt fertig geworden? Hatte García Márquez es freigegeben?
Wir sehen uns im August" ist ein poetisches Kammerstück über das Verkümmern der Liebe und den Blick einer Frau auf ihre Ehe, die Familie, das Leben selbst. An jedem 16. August fährt Ana Magdalena Bach, 46 Jahre alt - den Namen hat sich der Autor von Bachs zweiter Ehefrau geliehen -, auf eine kleine Karibikinsel, legt Gladiolen an das Grab ihrer Mutter, erzählt dem Grabstein vom abgelaufenen Jahr und nimmt am nächsten Tag wieder die Fähre nach Hause. Nur dass sie diesmal die Nacht nicht allein verbringt.
Der Ehebruch wühlt sie auf, aber irgendwie schafft sie es, das veränderte Wesen, das sie selbst ist, in ihr gewohntes Leben zurückzutragen, zu einem attraktiven Mann, einer Tochter, einem Sohn. Und doch geschieht es im Jahr darauf wieder. Nicht mit demselben. Und noch einmal. Ein zwielichtiger Playboy lädt sie ins Cabriolet ein. Ein Geschäftsmann hinterlässt ihr im Morgengrauen seine Visitenkarte. Der allererste Mann hat sie gedemütigt, indem er ihr einen Zwanzigdollarschein ins Buch schob. Jedes Mal, nur für einen Tag und eine Nacht, erschüttert die Reise zum Grab der Mutter die Lebensroutine, von der die Heldin dachte, sie sei alles, was noch vor ihr liegt.
Unter den Bewunderern von García Márquez bevorzugen manche die saftigen Romane, andere die gertenschlanken Novellen. Wer in den letzten Jahren noch einmal "Hundert Jahre Einsamkeit" gelesen hat, wird sich an die athletische Prosa erinnern, die schamlosen Übertreibungen und jede Menge karibisches Wunderzeug. Auch in "Wir sehen uns im August" blitzen Sätze auf, die nur García Márquez schreibt, weil nur er sich das traut. "Den Wunsch, auf der Insel begraben zu werden, hatte ihre Mutter drei Tage vor ihrem Tod geäußert" steht da. "Ana Magdalena wollte zur Beerdigung fahren, doch das hielt niemand für vernünftig, da nicht einmal sie selbst glaubte, den Schmerz überleben zu können." Ist das nicht ein bisschen viel? Wer soll denn das glauben?
Aber dann liest man weiter und glaubt es ihm. Schmerz und Begehren - hier ausnahmsweise weibliches Begehren! - haben bei García Márquez die Macht von Wirbelstürmen. Diese Weltsicht wirkt ansteckend, sie könnte den eigentlichen Zauber seiner Bücher ausmachen. Man wird davongetragen, aber ohne billige Tricks. Man glaubt dieser Stimme die markigen Aussagen und immer wieder verblüffenden Verallgemeinerungen und denkt: Tolstoi hat sich das auch getraut. Und: Schade, dass jetzt wirklich nichts mehr von ihm kommt.
Sie wusste, dass er gepflegt war und makellos gekleidet", heißt es über den ersten Liebhaber dieser Frau, die so unbefleckt in die Ehe gegangen ist, wie es Frauen bei García Márquez manchmal tun, weil die Männer bei García Márquez einen Kick daraus kriegen. Sie wusste weiter, dass er "tumbe Hände hatte, was der farblose Lack auf den Nägeln betonte, und ein gutes und zaghaftes Herz". Etwas Großzügiges, Unbekümmertes liegt in diesem Schreiben, und das ist eine seltene Kategorie. Im Bett übrigens stellt Ana Magdalena an ihrem Liebhaber fest, "dass er nicht so gut ausgestattet war wie ihr Mann, der einzige erwachsene Mann, den sie nackt kannte, aber der hier zeigte sich ruhig und aufgerichtet". Nicht schlecht, darauf muss man erst mal kommen; die Attribute gelten ja auch für die Prosa.
Vor zwanzig Jahren gab es schon einmal ein letztes Buch dieses legendären Autors. Es heißt "Erinnerung an meine traurigen Huren" und ist eine nobelpreisträgerhafte Macho-Phantasie, die García Márquez' karibische Welt viel ärmer darstellt, als wir sie in Erinnerung haben, als Abgesang eines neunzigjährigen Mannes und eine letzte Feier voyeuristischer Genüsse. "Wir sehen uns im August" ist von anderem Kaliber, schillernder, spannender, witziger und vitaler. Die letzte Szene beschert uns Lesern einen Schock, ein gelüftetes Geheimnis und eine rabiate Tat, wie sie nur den Figuren dieses Autors in den Sinn kommen.
Im Nachwort berichtet der Lektor und Verlagsleiter Cristóbal Pera von fünf verschiedenen Textfassungen und einer digitalen Masterkopie. Letztere habe lange bei der Agentin Carmen Balcells in Barcelona gelegen. Pera schildert den synoptischen Prozess und betont, nichts hinzugeschrieben zu haben. Mehr zum philologischen Verfahren erfahren wir nicht. Ein einziger Widerspruch wird nicht aufgelöst. Im Vorwort sagt Rodrigo García, das abschließende Urteil seines Vaters über sein letztes Werk habe gelautet: "Dieses Buch taugt nichts. Es muss vernichtet werden." Cristóbal Pera dagegen zitiert im Nachwort einen handschriftlichen Vermerk des Autors auf der fünften Fassung vom 5. Juli 2004: "Großes endgültiges OK." Vielleicht darf man es bei diesem Satz des Sohnes belassen: "Der Schreibprozess war ein Wettlauf zwischen dem Perfektionismus des Sprachkünstlers und seinen schwindenden geistigen Kräften." Keine Frage, wer ihn gewonnen hat.
2015 kaufte das Harry Ransom Center in Austin, Texas den Nachlass des Nobelpreisträgers für 2,2 Millionen Dollar. Dort, unter rund einer Million Büchern und 42 Millionen Manuskripten, ruhen schon bedeutende Konvolute von James Joyce, Doris Lessing, Robert De Niro und David Foster Wallace. An diesem "Treffpunkt für neugierige Geister" (Eigenwerbung) wäre das letzte Werk des beliebtesten lateinamerikanischen Schriftstellers aller Zeiten aber wohl irgendwann als Raubkopie nach draußen gedrungen, das war auch der Familie klar. "Deshalb", sagt Rodrigo García, "haben wir es lieber selbst gemacht." Es war die richtige Entscheidung. PAUL INGENDAAY
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Ein letztes, allerletztes Werk von Gabriel García Márquez aus dem Nachlass. Und ein bewegendes Buch seines Sohnes Rodrigo über die Demenz des Vaters: Wer muss da nicht heulen?
Als Gabriel García Márquez 2014 im Alter von 87 Jahren starb, war er schon seit einiger Zeit dement. Wie lange lässt sich nur ungefähr sagen, denn der Verfall der schöpferischen Kraft des kolumbianischen Nobelpreisträgers ging in kleinen Schritten über einen längeren Zeitraum vor sich. Über den letzten großen öffentlichen Auftritt von "Gabo", wie man ihn in der spanischsprachigen Welt nennt, am 26. März 2007 beim Kongress der spanischen Sprache in Cartagena de Indias (Kolumbien) haben nicht nur wir in der F.A.Z. berichtet, die Szene diente auch dem Biographen Gerald Martin als eindringliches Schlussbild seines Buches "Gabriel García Márquez: A Life" (2008).
Martin schildert dort einen Mann von achtzig Jahren, der auf seinen vierzig Jahre zuvor erschienenen Kultroman "Hundert Jahre Einsamkeit" und den 25 Jahre zuvor erhaltenen Literaturnobelpreis zurückblickt; der die Ehrung durch fünf kolumbianische Präsidenten und den spanischen König entgegennimmt und dann auch noch seinen Freund Bill Clinton begrüßt, weil man sich unter Superpromis eben kennt; der sich an die Entbehrungen erinnert, die er mit seiner Frau Mercedes geteilt hat, bevor ihn 1967 der Weltruhm und der Aufstieg zur lateinamerikanischen Kulturikone ereilten; und der nun, während er es einigermaßen achtbar durch seine Rede schafft, die größte Distinktion nach dem Nobelpreis erlebt: dass die Königlich-Spanische Akademie ihn ehrt, indem sie zu seinem Geburtstag in die Karibik reist und dem neuen Literaturspanisch denselben Rang zuweist wie dem alten. Cervantes und García Márquez, vier Jahrhunderte voneinander entfernt, Verfasser der beiden größten, wirkmächtigsten, meistverkauften Romane der spanischen Sprache. "Hundert Jahre Einsamkeit", so der Biograph Gerald Martin, sei sogar der erste "globale Roman" überhaupt. So steckt alles voller Symbolik, tönendem Pathos und Panhispanismus, was an Gabo natürlich vorbeigeht, denn er hält nichts von salbungsvollem Quaken und Männern im dunklen Anzug. Minutenlange Ovationen folgen. Doch der leicht verwirrte Schriftsteller, dem sie gelten, kann sich nicht einmal mehr an alles erinnern, was er in seinem Leben geschrieben hat.
Man muss dieses langsame Verlöschen eines der großen Sprachkünstler des vergangenen Jahrhunderts vor Augen haben, wenn man von seiner Spätzeit spricht. Es gibt keinen besseren Zeugen dafür als Rodrigo García Barcha, den älteren der beiden Söhne. García, der schon seit Jahrzehnten als Filmregisseur und Produzent in Los Angeles lebt, konnte bei seinen Besuchen in Mexiko-Stadt oder auf Familienfesten über Jahre hinweg das Fortschreiten der Alzheimer-Krankheit seines Vaters beobachten. In einem bewegenden Buch, das jetzt bei Kiepenheuer & Witsch auf Deutsch erschienen ist - "Abschied von Gabo und Mercedes" (F.A.Z. vom 28. Mai 2021) -, erzählt der heute Fünfundsechzigjährige von den schwierigen, traurigen, aber auch abgrundtief komischen Szenen, die sich zwischen den Söhnen und ihrem weltberühmten Vater in Mexiko-Stadt ereigneten. "Wer sind die Leute da im Nebenzimmer?", fragt der Schriftsteller einmal die Haushälterin. "Ihre Söhne", lautet die Antwort. "Wirklich? Diese Männer? Carajo. Das ist ja unglaublich." Zwischen Sorge und Einsicht, Kummer und Krankenschwester-Witzen (Gabo bleibt ein kolumbianischer Macho) entfaltet sich in dem schmalen Buch ein Sterbedrama, das durch die pointierte Prosa des Sohnes auch literarisch beeindruckt.
Er habe sich an Joan Didions "Das Jahr des magischen Denkens" und Philip Roths "Mein Leben als Sohn" orientiert, sagt Rodrigo García im Videochat von Los Angeles aus. Doch die absurde Seite von Verfall und Tod habe ihn schon lange fasziniert. Nicht umsonst hat er an der gefeierten HBO-Serie "Six Feet Under" mitgearbeitet, deren Dreh- und Angelpunkt ein familiengeführtes Bestattungsunternehmen ist. "Schon die Tatsache, dass das Leben endet, ist ja absurd. Und obwohl wir uns daran gewöhnt haben sollten, macht uns das Ende des Lebens immer noch sprachlos."
Dann kommt García auf die Erinnerung zu sprechen, memoria - die eigene, die durch das Sterben in Gang gesetzt wird, und die andere, deren Verschwinden den Vater zur Verzweiflung treibt, bis er lernt, ein Leben ohne persönlichen Echoraum zu akzeptieren. Im Buch gelten dem Gedächtnisverlust des Vaters die traurigsten Szenen. Einmal sagt eine Sekretärin: "Was machen Sie hier draußen, Don Gabriel?" - "Weinen." - "Weinen? Sie weinen doch gar nicht." - "Doch. Aber ohne Tränen. Ist Ihnen nicht bewusst, dass mein Kopf jetzt kaputt ist?" Es ist zum Heulen, es ist die Wahrheit, es ist das Ende eines beispiellosen Lebens. So geht es einem Mann, der den erstaunlichen Satz gesagt hat, nach seinem achten Lebensjahr habe er eigentlich nichts Wichtiges mehr erlebt. "Erinnerung", sagt Rodrigo García, "ist das einzige Thema des Schriftstellers. Für meinen Vater war sie der wichtigste Rohstoff."
Eine Rekonstruktion ganz anderer Art stellt das globale literarische Ereignis dieser Tage dar: Heute erscheint, in vielen Sprachen zugleich, García Márquez' nachgelassenes Buch "Wir sehen uns im August" (Kiepenheuer & Witsch). Die Übersetzung stammt wie beim Buch des Sohnes von der begnadeten Dagmar Ploetz. Zwei Kapitel waren schon vor vielen Jahren in Spanien und Kolumbien in der Presse erschienen, man war beeindruckt, aber Genaueres wusste niemand. War das schmale Werk, eher eine Novelle als ein Roman, überhaupt fertig geworden? Hatte García Márquez es freigegeben?
Wir sehen uns im August" ist ein poetisches Kammerstück über das Verkümmern der Liebe und den Blick einer Frau auf ihre Ehe, die Familie, das Leben selbst. An jedem 16. August fährt Ana Magdalena Bach, 46 Jahre alt - den Namen hat sich der Autor von Bachs zweiter Ehefrau geliehen -, auf eine kleine Karibikinsel, legt Gladiolen an das Grab ihrer Mutter, erzählt dem Grabstein vom abgelaufenen Jahr und nimmt am nächsten Tag wieder die Fähre nach Hause. Nur dass sie diesmal die Nacht nicht allein verbringt.
Der Ehebruch wühlt sie auf, aber irgendwie schafft sie es, das veränderte Wesen, das sie selbst ist, in ihr gewohntes Leben zurückzutragen, zu einem attraktiven Mann, einer Tochter, einem Sohn. Und doch geschieht es im Jahr darauf wieder. Nicht mit demselben. Und noch einmal. Ein zwielichtiger Playboy lädt sie ins Cabriolet ein. Ein Geschäftsmann hinterlässt ihr im Morgengrauen seine Visitenkarte. Der allererste Mann hat sie gedemütigt, indem er ihr einen Zwanzigdollarschein ins Buch schob. Jedes Mal, nur für einen Tag und eine Nacht, erschüttert die Reise zum Grab der Mutter die Lebensroutine, von der die Heldin dachte, sie sei alles, was noch vor ihr liegt.
Unter den Bewunderern von García Márquez bevorzugen manche die saftigen Romane, andere die gertenschlanken Novellen. Wer in den letzten Jahren noch einmal "Hundert Jahre Einsamkeit" gelesen hat, wird sich an die athletische Prosa erinnern, die schamlosen Übertreibungen und jede Menge karibisches Wunderzeug. Auch in "Wir sehen uns im August" blitzen Sätze auf, die nur García Márquez schreibt, weil nur er sich das traut. "Den Wunsch, auf der Insel begraben zu werden, hatte ihre Mutter drei Tage vor ihrem Tod geäußert" steht da. "Ana Magdalena wollte zur Beerdigung fahren, doch das hielt niemand für vernünftig, da nicht einmal sie selbst glaubte, den Schmerz überleben zu können." Ist das nicht ein bisschen viel? Wer soll denn das glauben?
Aber dann liest man weiter und glaubt es ihm. Schmerz und Begehren - hier ausnahmsweise weibliches Begehren! - haben bei García Márquez die Macht von Wirbelstürmen. Diese Weltsicht wirkt ansteckend, sie könnte den eigentlichen Zauber seiner Bücher ausmachen. Man wird davongetragen, aber ohne billige Tricks. Man glaubt dieser Stimme die markigen Aussagen und immer wieder verblüffenden Verallgemeinerungen und denkt: Tolstoi hat sich das auch getraut. Und: Schade, dass jetzt wirklich nichts mehr von ihm kommt.
Sie wusste, dass er gepflegt war und makellos gekleidet", heißt es über den ersten Liebhaber dieser Frau, die so unbefleckt in die Ehe gegangen ist, wie es Frauen bei García Márquez manchmal tun, weil die Männer bei García Márquez einen Kick daraus kriegen. Sie wusste weiter, dass er "tumbe Hände hatte, was der farblose Lack auf den Nägeln betonte, und ein gutes und zaghaftes Herz". Etwas Großzügiges, Unbekümmertes liegt in diesem Schreiben, und das ist eine seltene Kategorie. Im Bett übrigens stellt Ana Magdalena an ihrem Liebhaber fest, "dass er nicht so gut ausgestattet war wie ihr Mann, der einzige erwachsene Mann, den sie nackt kannte, aber der hier zeigte sich ruhig und aufgerichtet". Nicht schlecht, darauf muss man erst mal kommen; die Attribute gelten ja auch für die Prosa.
Vor zwanzig Jahren gab es schon einmal ein letztes Buch dieses legendären Autors. Es heißt "Erinnerung an meine traurigen Huren" und ist eine nobelpreisträgerhafte Macho-Phantasie, die García Márquez' karibische Welt viel ärmer darstellt, als wir sie in Erinnerung haben, als Abgesang eines neunzigjährigen Mannes und eine letzte Feier voyeuristischer Genüsse. "Wir sehen uns im August" ist von anderem Kaliber, schillernder, spannender, witziger und vitaler. Die letzte Szene beschert uns Lesern einen Schock, ein gelüftetes Geheimnis und eine rabiate Tat, wie sie nur den Figuren dieses Autors in den Sinn kommen.
Im Nachwort berichtet der Lektor und Verlagsleiter Cristóbal Pera von fünf verschiedenen Textfassungen und einer digitalen Masterkopie. Letztere habe lange bei der Agentin Carmen Balcells in Barcelona gelegen. Pera schildert den synoptischen Prozess und betont, nichts hinzugeschrieben zu haben. Mehr zum philologischen Verfahren erfahren wir nicht. Ein einziger Widerspruch wird nicht aufgelöst. Im Vorwort sagt Rodrigo García, das abschließende Urteil seines Vaters über sein letztes Werk habe gelautet: "Dieses Buch taugt nichts. Es muss vernichtet werden." Cristóbal Pera dagegen zitiert im Nachwort einen handschriftlichen Vermerk des Autors auf der fünften Fassung vom 5. Juli 2004: "Großes endgültiges OK." Vielleicht darf man es bei diesem Satz des Sohnes belassen: "Der Schreibprozess war ein Wettlauf zwischen dem Perfektionismus des Sprachkünstlers und seinen schwindenden geistigen Kräften." Keine Frage, wer ihn gewonnen hat.
2015 kaufte das Harry Ransom Center in Austin, Texas den Nachlass des Nobelpreisträgers für 2,2 Millionen Dollar. Dort, unter rund einer Million Büchern und 42 Millionen Manuskripten, ruhen schon bedeutende Konvolute von James Joyce, Doris Lessing, Robert De Niro und David Foster Wallace. An diesem "Treffpunkt für neugierige Geister" (Eigenwerbung) wäre das letzte Werk des beliebtesten lateinamerikanischen Schriftstellers aller Zeiten aber wohl irgendwann als Raubkopie nach draußen gedrungen, das war auch der Familie klar. "Deshalb", sagt Rodrigo García, "haben wir es lieber selbst gemacht." Es war die richtige Entscheidung. PAUL INGENDAAY
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main