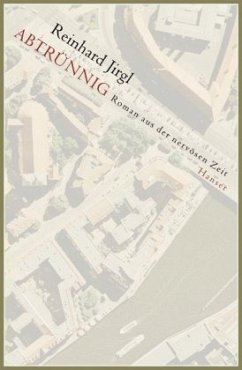Berlin 2002, die Stadt als Fluchtpunkt zweier Männer. Der eine, freier Journalist in Hamburg, hat sich scheiden lassen und geht einem Impuls folgend nach Berlin, zu der Frau, die er liebt. Der andere, einst DDR-Grenzer in Frankfurt an der Oder, jetzt beim Bundesgrenzschutz, verliebt sich in eine junge Frau aus der Ukraine und verhilft ihr und ihrem Bruder illegal nach Berlin. Reinhard Jirgl beschreibt die Stadt als Moloch, der die kleinen Menschen und ihre Nöte durch die Mangel dreht und kuriert - ein Großstadtroman in bester Tradition.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Berlin ist doch Weimar: Reinhard Jirgls wütende Romanpredigt
Dieser Roman möchte Dynamit sein. Schon der Titel klingt wie eine Kampfansage. Zwei abtrünnige Eigenbrötler stellt Reinhard Jirgl vor und so gegeneinander, daß sich ihre beiden namenlosen Erzählstimmen überlagern und gleichsam zu Varianten eines einzigen, widerständigen Lebens verschwimmen. Der eine ist ein "sogenannt freier Journalist" aus Hamburg, dessen Ehe nach sechzehn Jahren ebenso gescheitert ist wie seine Karriere. Die Wut darüber schreibt er sich mit einem Buch von der Seele, das sich allmählich als das vorliegende Manuskript herausstellt. Schließlich, so lautet die Begründung des verzweifelten Westdeutschen: "Wer schreibt, kann nicht töten."
Der andere Ich-Erzähler kommt aus Ostdeutschland und ist Beamter des Bundesgrenzschutzes in Frankfurt an der Oder. Im Gegensatz zum Journalisten hat er seine Ehefrau einst so innig geliebt, daß er auch Jahre später nicht über deren plötzlichen Krebstod hinweggekommen ist. Beide Männer sind zutiefst verstörte Charaktere, die bereits "mit Sterben begonnen" haben, wie es der Journalist einmal ausdrückt. In ihren zwei Lebensbeichten ist bereits alles verloren, bevor überhaupt der erste Satz über sie gefallen ist. Man kennt das aus den früheren Romanen Jirgls, die ebenfalls von gesellschaftlich derangierten Außenseitern handelten, deren Untergang von vornherein besiegelt war. Das hat dem Autor den Ruf eines "Apokalyptikers" eingetragen, dem er hier erneut alle Ehre macht.
Dabei hat sich Jirgl immer als sozial engagierter Schriftsteller verstanden. 1953 in Ost-Berlin geboren, in der DDR totgeschwiegen und erst spät entdeckt, richtet er seinen Blick bewußt auf die Opfer, die Verlierer, die Fußlahmen der deutschen Geschichte. Über die Jahre hinweg hat sich der Radius dieses Blicks stetig erweitert. Waren "Abschied von den Feinden" und "Hundsnächte" noch Abrechnungen mit der DDR-Diktatur und ging es in "Die Unvollendeten" zuletzt um das deutsche Vertriebenen-Trauma, stehen im neuen Roman die Schattenseiten unserer Wettbewerbsgesellschaft im Mittelpunkt. Tatsächlich hat Jirgl in "Abtrünnig" exakt dort weitergeschrieben, wo der Vorgänger aufhörte: bei den düsteren Prophezeiungen des dortigen Erzählers, wonach "das 20. Jahrhundert der Lager & Vertreibungen . . . soeben wieder begonnen hat". Der neue Roman ist entsprechend ein einziger langer, sarkastischer Rundumschlag gegen die heutige "Religion" des weltumspannenden Kapitalismus, der längst alle Lebensbereiche bis in die Intimsphäre hinein durchdringt.
Zeitpunkt und Schauplatz des Buchs sind gut gewählt. Jirgl siedelt seine Geschichte im Berlin der "Neuen Mitte" an, in den Jahren 2000 bis 2004, also in der Ära des deutschen "Hauptstadt-Kollers", jenen Jahren des großen Metropolenversprechens, das nach dem Einbruch der New Economy und den New Yorker Anschlägen von 2001 zum "sündhaft teuren Versprecher" schrumpfte. Beide Männer zieht es wegen einer Frau nach Berlin. Der Journalist, der aus Kummer über seine gescheiterte Ehe zum Trinker wurde, hat sich in seine Suchttherapeutin mit dem sprechenden Namen Sophia verliebt. Der BGS-Beamte verhilft einer jungen Russin namens Valentina unerlaubt zur Flucht - und folgt ihr in die Hauptstadt nach, um dort als Taxifahrer nach ihr zu suchen. Damit ist das Unglück beider Männer besiegelt. Denn sowohl Valentina als auch Sophia entpuppen sich als skrupellose Sirenen in modernem Gewand, die es im Sinne einer "Affektökonomie" bestens verstehen, Männer erotisch anzulocken und danach für ihre Zwecke auszubeuten. Valentina verdingt sich als "Zimmermädchen", um beim Sex reiche Geschäftsleute auszuhorchen. Sophia ist mit einem Immobilienmakler verheiratet, der ihr die Praxis bezahlt, damit sie für ihn die Patienten ausspioniert. Ökonomisch riskante Investitionen wie "Kinder oder andere Seuchen" sind in dieser Ehe bezeichnenderweise nicht vorgesehen.
Der "Fetischismus des Geldes", von dem Jean Baudrillard schrieb, herrscht in Jirgls Großstadtkosmos und korrumpiert das Denken und Fühlen. Insofern tobt zwar auch hier jener Metropolenkampf der Klassen und Geschlechter gegeneinander, der schon Alfred Döblins armen Franz Biberkopf ruinierte. Doch ist "die Peitsche" roher Gewalt in Jirgls Moloch des dritten Jahrtausends dem "Palmwedel" eines ständigen Sich-verkaufen-Müssens gewichen, wie ausgerechnet "Stalin" dem ehemaligen Grenzbeamten einmal im Traum erklärt. Die Handlung des Romans wird immer wieder durch solche Traumsequenzen und traktathaften Abhandlungen und Erläuterungen unterbrochen, die von Friedrich Nietzsche bis zu Michel Foucault, von Pizzaros Greueltaten an den Indios bis zur Folter in den Konzentrationslagern reichten. Vieles, allzu vieles fährt Jirgl für seine Kulturkritik auf und reißt so den Leser immer wieder aus dem Sog des Erzählten heraus. Wenngleich diese sperrigen Einschübe (ähnlich wie die an Arno Schmidt geschulte Privat-Orthographie) wohl als Ausdruck einer Verweigerungshaltung beabsichtigt sind, klingt Jirgl darin doch oft so beflissen, daß man den Eindruck gewinnt, eher eine wissenschaftliche Streitschrift denn einen Roman zu lesen - samt Anhang am Schluß.
Dabei hätte sich die Grundaussage seiner wütenden Predigt auch ohne diese gelehrten Hinweise schnell erschlossen: Der scheinbar befriedete und von allen politischen Ideologien befreite homo oeconomicus stellt sich wiederum als jene alte "Bestie Mensch" heraus, die Artgenossen nicht selten aus purer Langeweile zu Tode quält. Nur machen sich die Schinder von heute dafür nicht mehr die Hände schmutzig, sondern richten ihre Gegner lieber gesichtslos über den finanziellen Ruin zugrunde.
Das bekommt bei Jirgl vor allem der zunehmend schlechter beauftragte Journalist zu spüren. Rezensionen, die ihm zugesagt waren, werden im schwelenden Berliner Zeitungskrieg kurzerhand an andere Autoren vergeben; Exklusiv-Interviews ohne Begründung nicht abgedruckt; Ausfallhonorare nicht gezahlt. Weil sich jedoch für diese Willkür nie ein klarer Schuldiger finden läßt, richtet sich die "jähe Wut" des verelendenden Schreibers schon bald gegen alles und jeden. Sein von Häme und Haß getränkter Bericht bringt tatsächlich das Dilemma vieler freier Autoren in Deutschland treffend auf den Punkt, die oft genug zu reinen Service-Bittstellern degradiert sind, ohne sich eine intellektuelle Querköpfigkeit aus Existenznot noch leisten zu können. Dieser demütigende Prozeß einer weitreichenden Entwertung von Fähigkeiten ist von Jirgl gut beobachtet und beschrieben.
Und doch sind seine Folgerungen daraus vollkommen überzogen. Seine Generalabrechnung scheut nicht einmal vor dem - aberwitzigen - Vergleich der heutigen Totalökonomisierung mit dem Nationalsozialismus zurück. Dabei lauert der wahre Ausbeuter bei Jirgl ähnlich wie bei George Orwell letztlich im eigenen Kopf. So träumt der am Ende zum mordenden Amokläufer gewordene Journalist schließlich von der freiwilligen Selbstabschaffung. Dafür meldet er sich im Traum zu seiner eigenen Tötung an: in einem Institut, das (im kalkulierten Anklang an die nationalsozialistische Endlösung) "Anstalt für finale Problemlösung" heißt. "Abtrünnig" ist Parabel und Pamphlet zugleich, wutschnaubend und düster, packend und verbissen - ein Buch wie ein völlig überladenes, zum Sinken verurteiltes Rettungsboot.
GISA FUNCK
Reinhard Jirgl: "Abtrünnig". Roman aus der nervösen Zeit. Hanser Verlag, München 2005. 544 S., geb., 25,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur TAZ-Rezension
Als ziemlich sperriges Ding, aber doch höchst interessant und in Passagen großartig, würdigt Cristina Nord diesen neuen Roman Reinhard Jirgls. Kurz beschreibt sie Jirgls Erzählweise, die Verschränkung der Geschichten zweier Protagonisten. Sie werden laut Rezensentin durch eine Art "Hyperlink-Verfahren" so ineinandergefügt, "dass sich ein nicht lineares Lesen anbietet". Hinzukommen essayistische Passagen und immer wieder Rückgriffe auf die DDR- und die Nazi-Vergangenheit. Mit Bewunderung konstatiert Nord auch, dass Jirgl bestimmte Motive älterer Romane hier wieder aufnimmt und weiter entwickelt. Es scheint, dass Jirgl, bei aller Anknüpfung an Techniken der Avantgarde, ganz altmodisch an einem Werk zu arbeiten scheint. In Momenten, so kritisiert die Rezensentin, lässt Jirgl dem Lebensekel der Protagonisten allzuviel Raum. Auch gehe dem Roman ein wenig die Dichte der Vorgänger ab. Aber sie bleibt fasziniert.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
"Ein virtuoses Stück Literatur über das Schreiben." Martina Meister, Frankfurter Rundschau, 10.10.05 "Reinhard Jirgls Buch ist ein schwieriger und kompromissloser Roman. Gerade weil es sich auch um einen politischen Roman handelt. ´Abtrünnig´ ist vor allem aber ein großer Roman." Uwe Schütte, Wiener Zeitung, 09.12.05 "Der Berliner Autor Reinhard Jirgl geht höchst kunstvoll aufs Ganze und überragt mit ´Abtrünnig. Roman aus der nervösen Zeit´ die Konkurrenz um Längen...der stärkste neue deutschsprachige Roman weit und breit." Heinrich Vogler, Der Bund, 15.12.05