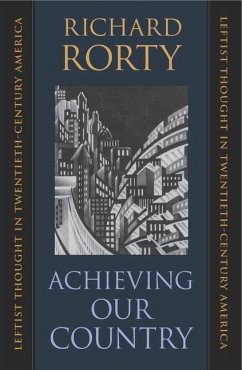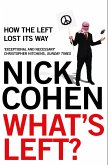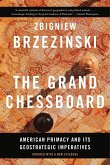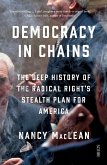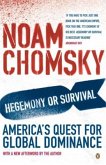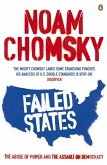Must the sins of Americaâ s past poison its hope for the future? Lately the American Left, withdrawing into the halls of academe to rue the nationâ s shame, has answered yes in word and deed. Rorty challenges this lost generation to understand its potential role in the tradition of democratic intellectual labor that began with Whitman and Dewey.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Jetzt träumen sie wieder. Bei der amerikanischen Linken lebt die Sehnsucht nach der guten Zeit auf, als der Sozialismus noch geholfen hat. Das muß in den fünfziger Jahren gewesen sein und hängt mit dem New Deal, dem Wirtschaftswachstum des Zweiten Weltkriegs und dem Massenerfolg des massenproduzierenden Fordismus zusammen. Für die träumende Linke war es das patriotische Bündnis von Geist und Tat, Intellektuellen und Gewerkschaften, Klassenbewußtsein und Kampf, das diese glücklichen Zeiten ermöglicht hat: Gerechtigkeit, Wohlstand und Gleichheit für alle.
Bei Richard Rorty, der jüngst seine Massey Lectures an der Harvard-Universität veröffentlicht hat ("Achieving our Country. Leftist Thought in Twentieth-Century America"), beginnt der Sündenfall der Linken während des Vietnamkriegs. Damals habe die Sozialkritik sich vom antikommunistischen Reformismus verabschiedet, um den Preis freilich, daß soziale Gerechtigkeit und Gleichheit aus dem Blick gerieten zugunsten eines systemverändernden kulturkritischen Radikalismus. Die "Neue Linke" mutierte vom Akteur zum Zuschauer, das Ganze als das Unwahre liebevoll verneinend. Sie habe dabei doppelt verloren, meint Rorty: den Kontakt zu den Gewerkschaften und der Arbeiterklasse sowie den Stolz auf ihr Land. In eins mit der Korrespondenztheorie der Wahrheit, habe sie unnötigerweise auch das Engagement innerhalb ihrer Klasse und Nation vernachlässigt. Whitman und Dewey - Rortys Helden - wurden durch Poe und Lacan ersetzt.
Gerechtigkeit hatte früher, so Rorty, vor allem einen Inhalt: anständige Löhne, bessere Arbeitsbedingungen und das Ende von Rassenvorurteilen. Die Institutionen der Verfassung sind dazu da, Ungleichheiten des Marktes zu korrigieren. Doch fahrlässig habe die Linke sich von der politischen Ökonomie verabschiedet. Das tat übrigens zur gleichen Zeit auch die Habermas-Schule in Deutschland. Aufgrund dieses Realitätsverlustes mangelt es der Linken heute aber an Antworten, wo Ungleichheiten wachsen und Einkommen im Maße explodierender Börsenindizes und sinkender Mindestlöhne sich spreizen. "Erst wenn die Intellektuellen und die Gewerkschaften wieder zu jener linken Bewegung sich vereinigen, wie sie noch in den vierziger und fünfziger Jahren existierte, wird das erste Jahrzehnt des nächsten Jahrhunderts wieder zu einer zweiten progressiven Ära werden", heißt es nicht ohne Pathos in Rortys rückwärtsgewandter Prophetie. Rorty erzählt liebevoll Geschichten seiner Familie in den dreißiger Jahren, allesamt Kämpfer für den New Deal, deren Ziel es war, mit Gesetzen und Bürokratie den Reichtum umzuverteilen, den das kapitalistische System produziert hat. "Die Streikenden vor den Kohlegruben und den Stahlwerken sind die Heroen meiner Zeit."
Es ist ein konservativer Sozialismus, den diese Linke träumt. Nachdem alle alternativen ökonomischen Systeme aus der Welt verschwunden sind, offenbare der globale Kapitalismus jene destruktive Wucht, die alle sozialen Bindungen auflöst. Im hundertfünfzigsten Jahr des Kommunistischen Manifestes sei der Kapitalismus so geworden, wie Marx ihn anaylsiert habe: Stabile Arbeitsbeziehungen verwässern, soziale Sicherungsnetze werden löchrig, Flexibilität wird zur unerträglichen Zumutung, und die Ungleichheit der Einkommen erhält immer unanständigere Züge.
Die amerikanische Linke kehrt von der Kulturkritik zur politischen Ökonomie zurück und besinnt sich ihrer alten Bündnispartner. Wie Rorty entdeckt auch Richard Sennett ("Der flexible Mensch. Die Kultur des neuen Kapitalismus") plötzlich die guten Seiten des Fordismus, den er, wie auch alle anderen intellektuellen Klassenkameraden, früher als falsches Bewußtsein und monotone Entfremdung der Fließbandexistenz und Brot-und-Butter-Sozialismus geißelte. Jetzt loben sie wieder den Egalitarismus des weißen, männlichen Mittelklasse-Ecklöhners, dem seine Gewerkschaft jährlich höhere Einkommen und kürzere Arbeitszeiten erstritt. War er nicht vielleicht besser dran, verglichen mit jenem Zeit und Erfahrung zersetzenden Anspruch prekärer Arbeitsverhältnisse, die heute das Zeitarbeitsunternehmen Manpower - seit es General Motors als größten amerikanischen Arbeitgeber verdrängte - von seinen Beschäftigten einfordert?
Michael Walzer, der dem links-liberalen Sennett ansonsten links-kommunitaristisch fernsteht, klagt gleichlautend über den Verlust des enagierten Bündnisses. In den Horkheimer-Vorlesungen, die er gerade unter dem Titel "Die Ausgrenzungen der liberalen politischen Theorie" in Frankfurt gehalten hat, schwärmt auch Walzer vom wärmenden Materialismus der Bewegungen. Einen gefährlichen Verlust an Wirklichkeitsbindung diagnostiziert er bei jener transzendentalen Neuen Linken, die den reinen Gedanken leidenschaftslos wahrheitsfähig machen wolle. Statt einer abstrakt am Modell von Juroren oder Richtern orientierten Wahrheitstheorie, fern vom politischen Alltag, solle die Linke lieber Maß nehmen an der Praxis kollektiver Tarifverhandlungen der Gewerkschaften oder am Flugblatteintüten politischer Kampagnen. Kein Gedanke, der nicht eingebettet wäre in eine soziale Praxis der Leiblichkeit, meint Walzer. Statt erhabener Alles-oder-nichts-Prinzipien rät er zum Einverständnis in die Wiederkehr von Kompromiß und Niederlage. Selbst die Haltung der Leidenschaftslosigkeit kommt nicht ohne Leidenschaft aus, will sie sich gegen den falschen Enthusiasmus der Reaktion stemmen.
Überraschend ist es nicht, daß die Linke nach dem Untergang der kapitalistischen Alternative sich reuevoll wieder an den geschmähten Reformismus erinnert. Wenn der Kapitalismus nicht überwunden werden kann, soll er wenigstens bezähmt werden. Doch die Sehnsucht nach den guten fünfziger Jahren kann außer dem Gestus beschwörender Melancholie nicht viel mehr anbieten. RAINER HANK
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main