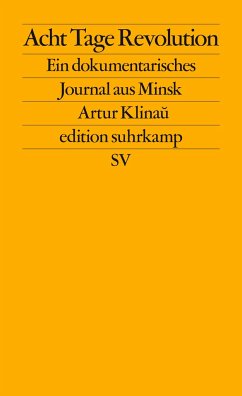Belarus, August 2020. Die Präsidentschaftswahl ist in vollem Gange. Artur Klinau, Schriftsteller und Künstler, erhält einen Anruf: Seine Tochter Marta wurde verhaftet. Er fährt nach Minsk und macht sich auf die Suche. In den überfüllten Gefängnissen der Stadt werden Menschen festgehalten, die gegen massive Wahlfälschungen protestiert haben und nun der Gewalt der Staatsmacht ausgeliefert sind. Erschütternde Berichte über Folterungen dringen nach außen.
Minutiös protokolliert Klinau seine Erfahrung dieser dramatischen Tage. Zugleich setzt er die Ereignisse ins Verhältnis zur jüngeren Geschichte des Landes und erschließt ihren politischen, historischen und lebensweltlichen Kontext. Mit bitterem, spöttischem Strich zeichnet er das Porträt eines Diktators, eines "Künstlers" sui generis, der seine Werke mit der Axt erschafft.
Minutiös protokolliert Klinau seine Erfahrung dieser dramatischen Tage. Zugleich setzt er die Ereignisse ins Verhältnis zur jüngeren Geschichte des Landes und erschließt ihren politischen, historischen und lebensweltlichen Kontext. Mit bitterem, spöttischem Strich zeichnet er das Porträt eines Diktators, eines "Künstlers" sui generis, der seine Werke mit der Axt erschafft.
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Atemlos liest Rezensentin Ilma Rakusa Artur Klinaus Bericht über die weißrussischen Aktivisten in "Acht Tage Revolution". Nachdem seine Tochter, die sich als Wahlhelferin gemeldet hatte, vom Lukaschenko-Regime verhaftet worden ist, begibt sich Klinau auf die Suche nach ihr, hält schriftlich fest, was er selbst erlebt und von anderen erfährt und stellt Parallelen zu seinen Erinnerungen an vergangene Proteste her, resümiert die Rezensentin. Dabei veranschauliche der Autor die bedrückende Stimmung unter dem Regime mit satirischen Zwischentönen und "Kafka-Referenzen". Auch malerische Metaphern heben dies Buch von anderen Sachbüchern ab, meint Rakusa, die "Acht Tage Revolution" zum "bewegendsten Buch" über die weißrussichen Proteste im Sommer 2020 kürt.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»Es ist das bewegendste Buch, das über die weissrussischen Proteste im Sommer 2020 geschrieben wurde ...« Ilma Rakusa Neue Zürcher Zeitung 20220203