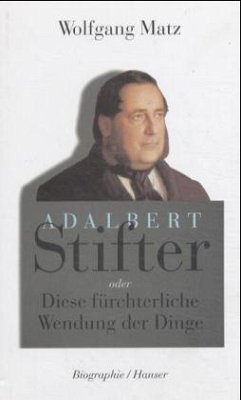Zeitlebens war Adalbert Stifter, der Dichter gewaltiger Landschaftsschilderungen und einfühlsamer Figurenporträts, zerrissen zwischen bürgerlichem Lebensanspruch und absolutem Künstlertum. Wie kein zweiter kannte Stifter auch die Nachtseite des Lebens. In Wolfgang Matz' äußerst lebendig geschriebener Darstellung eines widerspruchsvollen Lebens und nicht minder widersprüchlichen Werks entsteht das Bild einer diffizilen, hochsensiblen und damit überaus modernen Künstlerexistenz.

Wolfgang Matz erzählt Stifters allzu stilles Leben / Von Christoph Bartmann
Aufregungen sind die Ausnahme in der Stifter-Rezeption. Einige Jahrzehnte ist es schon her, daß Arno Schmidt unter dem berühmt gewordenen Titel "Der sanfte Unmensch" eine Polemik entfachte und seiner Haßliebe zu Stifter im allgemeinen und zum "Nachsommer" im besonderen Ausdruck gab. Denselben Roman geißelte wenig später Horst Albert Glaser in seiner Studie "Die Restauration des Schönen" als "Ideologie", ja "Kapitalismus- und Rentnerutopie". In solchen Begriffen spricht sich ein deutsches Ressentiment gegen Stifters spezifisch österreichische Geistesverfassung aus. Ein Streit blieb jedoch aus, denn niemand wollte die Attacken erwidern. Zur selben Zeit begann eine literarische Renaissance Stifters. Thomas Bernhard und Peter Handke haben erklärt, wie stark sie Stifters psychologisch schlichte und phänomenologisch brisante Schreibweise beeinflußt hat. Der aus den Überresten des "Habsburgischen Mythos" auferstandene Mitteleuropa-Kult hat Stifter ebenfalls zu neuem Interesse verholfen.
In ähnlich gemessenem Takt wie Stifters Prosa schreitet die Stifter-Biographik voran. Nun hat, fast sechzig Jahre nach Urban Roedls Standardwerk, Wolfgang Matz eine neue Lebensgeschichte vorgelegt. Ihm ist eine gründlich gearbeitete und gut lesbare Darstellung gelungen, die von kritischer Anteilnahme an Stifters Leben und von Liebe zu seinem Werk geprägt ist. Leben und Werk, das ist der überlieferte Auftrag des biographischen Erzählens. Matz will ihn gegen den herrschenden Trend der Literaturwissenschaft erneuern.
Denn die beliebte These vom "Verschwinden des Autors", so hat er andernorts ausgeführt, bedeute "das Zurückweichen vor einer der schwierigsten Unternehmungen überhaupt: der Darstellung eines Individuums in der Gesamtheit seiner inneren und äußeren Bezüge". Wie solle man etwa den "Nachsommer" verstehen, ohne Kenntnis davon zu haben, daß er für Stifter die Funktion einer "literarischen Wunscherfüllung" besaß? Erst das Leben, meint Matz, entscheidet über die "Wahrheit" der Literatur. Wüßte man nichts über Stifters Unglück im Leben, nähme man das Glück in den Romanen womöglich für bare Münze. Das "Zugrunderichtende" und "Entsetzliche", diese für Stifter so bezeichnende "fürchterliche Wendung der Dinge", liefert für all das Schöne und Positive die ästhetische und moralische Deckung.
Damit die These von der literarischen Wunscherfüllung aufgeht, ist es nötig, daß im Leben all die Wünsche offenbleiben, die von der Literatur hernach erfüllt werden. Deshalb trägt Stifters Leben auch bei Matz wieder Züge jenes biedermeierlichen Rührstücks, als das es die volkstümliche Biographik und vor allem Stifter selbst stets beschrieben haben. In diesem Leben scheint alles zur Klage bestimmt: die kleinbürgerlich-ländliche Herkunft aus dem Böhmerwald, der frühe Tod des Vaters, die unerfüllte Liebe zu Fanny Greipl und der Ehetrott mit Amalie, das Scheitern im Studium und der Broterwerb als Hauslehrer.
Der literarische Erfolg, der sich um 1840 mit den Erzählungen "Der Condor", "Feldblumen" und "Das Haidedorf" rasch und nachhaltig einstellt, kann den trostlosen Gesamteindruck dieses Lebens kaum aufhellen. Auf eine Phase des persönlichen und politischen Optimismus, die im Oktober 1848 in der Zerschlagung der Revolution durch Windischgrätz ein symbolträchtiges Ende findet, folgen, so hat es den Anschein, nur noch Enttäuschungen, Krisen und Krankheiten. Daß mit seinen Leiden auch Stifters literarische Produktion wächst und in den letzten Lebensjahren mit dem "Nachsommer" und "Witiko" monumentale Gestalt annimmt, scheint Matz' These von der Literatur als Therapeutikum eines mißlungenen Lebens zu erhärten.
Ungeachtet seiner Prämisse, daß im verunglückten Leben der Schlüssel für das geglückte Werk zu suchen sei, begleitet Matz Stifters Lebensweg häufig mit Mißvergnügen. Bisweilen stellt er Vermutungen darüber an, was ohne Stifters "Gebundenheit an Autorität" und ohne seine Hinnahme der "naturgegebenen Ordnung" aus ihm geworden wäre. Solche Überlegungen sind nicht nur inkonsequent, sondern auch unhistorisch. Gewiß eignet sich Stifter weniger zum Helden als Hölderlin. Doch ist seine Demut vor der "Ordnung der Dinge" ebensowenig eine persönliche Attitüde wie der von Matz zum Vergleich herangezogene Freiheitsrausch der Tübinger Stiftler von 1793. Matz hätte Neuland betreten können, wenn er Stifters notorischen Schwäche-Gestus in positiven Begriffen beschrieben hätte, anstatt als bloßen Mangel an Selbstbewußtsein und als Unfähigkeit, "sein Unglück offen auszusprechen".
Alles, was ihn bedrückte, habe Stifter "konsequent verdrängt", schreibt Matz, und auch dessen übermäßige Eß- und Trinklust will ihm als Symptom zeittypischer Behäbigkeit erscheinen. Hier spricht aus Matz der Anwalt des rechten Maßes. Auch Stifters Rastlosigkeit und gleichzeitiger Pedanterie, seinen weitgespannten beruflichen Aktivitäten und seiner Selbstarchivierung zu Lebzeiten stellt er kein gutes Zeugnis aus. Die modernen Züge in Stifters Leben, seine Funktion als Beamter oder sein Verhandlungsgeschick als Autor, sieht Matz mit Unbehagen.
Eine Äußerung Stifters über seine "Liebhabereien als Dichter Maler Restaurateur alter Bilder und Geräte nebst Gerumpel, wozu mich noch im vorigen Sommer die Cactusnarrheit überfallen hat", kommentiert er ungnädig: "Wenn Stifter je dem Klischee des biedermeierlichen Spießers entsprochen hat, dann jetzt ( . . .). Er pflegte seine Kakteen und hätschelte seinen Hund: Beschäftigungen eines Mannes, der nicht weiß, wohin mit seinen Gefühlen, der niemanden hat, dem er wirkliche Zuneigung schenken kann." Das ist nicht die einzige Stelle, wo Matz auf Stifters Idiosynkrasien mit psychotherapeutischen Gemeinplätzen antwortet. "Mir tut not zu produzieren, und ich werde es", schreibt Stifter mit achtundzwanzig Jahren in einem Brief an Adolf von Brenner. Warum eigentlich soll man ein Leben mißlungen nennen, das in Verfolgung der eigenen Vorsätze ein literarisches Werk von diesem Rang und Umfang hervorgebracht hat? Die Biographie von Matz geht zwar in ihrer subtilen, detailgenauen Beschreibung des Werks ein gutes Stück über die traditionelle Stifter-Biographik hinaus; sie bleibt aber insofern selbst traditionell, als sie sich im Leben weitgehend an Stifters eigene Sprachregelungen hält. Die Authentizität seiner Lebensäußerungen ist jedoch eine literarische und keine bloß dokumentarische. Oft scheint Stifters Rhetorik des Unglücks von der Kafkas nicht weit entfernt. Seine Briefe an Fanny etwa, in denen Matz das Motiv eines "vorbeugenden Verzichts" offenlegt, hätten es verdient, mit derselben stilistischen Aufmerksamkeit gelesen zu werden, wie sie Kafkas Briefen an Felice längst zuteil wird. So bleibt, Matz' Anstrengung zum Trotz, der Befund von Thomas Mann, Stifter sei "kritisch viel zu wenig ergründet", bestehen.
Wolfgang Matz: "Adalbert Stifter oder Diese fürchterliche Wendung der Dinge". Biographie. Carl Hanser Verlag, München und Wien 1995. 406 S., geb., 54,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
»Das Buch baut auf der bisherigen Forschung auf und fesselt durch seine literarische Qualität, welche die Lektüre geradezu spannend macht.« (Peter Vodosek, ekz.bibliotheksservice, 07.03.2016) »Sehr viel Wissen zu Stifters Leben: Das dient dem Werkverständnis.« (Vorarlberger Nachrichten, 30.04./01.05.2016) »klug und anschaulich« (Armin Jetter, Buchprofile/Medienprofile 61/2016, Heft 2) »So gründlich und fesselnd ist dieses Leben und Schreiben noch nicht dargestellt worden.« (Klaus Bellin, Leseart 2/16) »Dieses das Werk und das nicht einfache Leben Stifters aufschließende Buch sollte in keinem Schrank hiesiger Literaturfreunde fehlen.« (Stefan Rammer, Passauer Neue Presse, 06.08.2016) »Beiträge zum Verständnis fremder Welterfahrung: Der seltsamste deutschsprachige Schriftsteller überhaupt in aller Ruhe enträtselt« (Jürgen Kaube, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 28.11.2016) »Mit Wolfgang Matzens imposanter, höchst detailgenauer Studie wird dem großen alten Mann der österreichischen Literatur so sympathisch wie verdient Gerechtigkeit.« (Erika Deiss, Mannheimer Morgen, 11.11.2016) »Standardwerk zu Leben und Werk von Adalbert Stifter« (Manfred Orlick, literaturkritik.de, 27.01.2018)