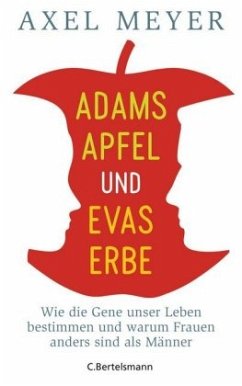Der renommierte Evolutionsbiologe über die Macht der Gene
Wie funktioniert die genetische Lotterie des Lebens? Was ist typisch für Männer, was ist typisch für Frauen? Warum verhalten wir uns so, wie wir es tun? Warum haben wir die gleichen Talente wie der Vater oder die gleichen Charaktereigenschaften wie die Großmutter? Wo endet die Macht der Gene, und was lässt sich durch Ernährung, Erziehung und Kultur ändern?
Der Evolutionsbiologe Axel Meyer beschäftigt sich mit den »heißen Eisen« der Genforschung und erläutert, was zu Themen wie Geschlecht vs. Gender, Intelligenz, Homosexualität und ethnischen Unterschieden bekannt ist. Provokant, anschaulich und auf aktuellem Forschungsstand zeigt er auf, wie stark uns Gene bestimmen.
Dieses Buch regt zum Denken und Diskutieren an - es ist von hoher gesellschaftlicher Relevanz.
Wie funktioniert die genetische Lotterie des Lebens? Was ist typisch für Männer, was ist typisch für Frauen? Warum verhalten wir uns so, wie wir es tun? Warum haben wir die gleichen Talente wie der Vater oder die gleichen Charaktereigenschaften wie die Großmutter? Wo endet die Macht der Gene, und was lässt sich durch Ernährung, Erziehung und Kultur ändern?
Der Evolutionsbiologe Axel Meyer beschäftigt sich mit den »heißen Eisen« der Genforschung und erläutert, was zu Themen wie Geschlecht vs. Gender, Intelligenz, Homosexualität und ethnischen Unterschieden bekannt ist. Provokant, anschaulich und auf aktuellem Forschungsstand zeigt er auf, wie stark uns Gene bestimmen.
Dieses Buch regt zum Denken und Diskutieren an - es ist von hoher gesellschaftlicher Relevanz.
Man soll uns nicht mit Wühlmäusen vergleichen
Paarungsverhalten und Fortpflanzung: Der Evolutionsbiologe Axel Meyer versucht zu erklären, warum Frauen anders als Männer sind. Wie ein Wissenschaftler verhält er sich dabei nicht durchgehend.
Axel Meyer, international anerkannter Evolutionsbiologe an der Universität Konstanz, möchte in seinem Buch auf naturwissenschaftlicher Grundlage zeigen, was Männer und Frauen so alles voneinander unterscheidet. Er beginnt dabei ganz sachlich. Ein großer Teil des Buches widmet sich Grundlagen der Evolutionsbiologie, der sexuellen Auslese, klassischen Genetik und Genomik. Alles in allem ist die Darstellung leicht nachvollziehbar und oft informativ, mit extremen Urteilen hält sich der Autor zurück. Und doch spiegelt das Buch eine Klarheit und Eindeutigkeit vor, die sich dem Umstand verdankt, dass abweichende Erkenntnisse oder Deutungen in ihm nicht vorkommen.
Das gilt für naturwissenschaftliche Argumente und erst recht für die oft völlig ignorierten Erkenntnisse aus anderen Disziplinen. Meyer sieht sich selbst mit Blick auf Geschlechterdebatten als Anwalt der naturwissenschaftlichen Vernunft. An vielen für seine Argumentation entscheidenden Stellen wird man ihm das aber nicht so einfach durchgehen lassen wollen.
In der Evolutionsbiologie spielt das an Fruchtfliegen entdeckte "Bateman-Prinzip" für das Verständnis der Geschlechterrollen eine prominente Rolle: Es besagt, dass der Fortpflanzungserfolg von Männchen variabler als der von Weibchen ist, da sie eine variablere Zahl von Sexualpartnern haben - viele Männchen kommen nie zum Zuge, während andere viele Sexualpartner haben. Folglich ist der Fortpflanzungserfolg von Männchen stärker von der Zahl der Partner abhängig als bei Weibchen. Die Ursache für diesen Sachverhalt ist, dass Weibchen meist mehr Zeit und Energie in ihren Nachwuchs investieren als Männchen und daher eine begrenzte Ressource sind, um die Männchen konkurrieren.
Das klingt alles einleuchtend und wird gern als Erklärung für aggressives, kompetitives Verhalten von Männern und wählerisches, zurückhaltendes Agieren von Frauen herangezogen. Die Realität ist allerdings schon bei Tieren, erst recht aber bei Menschen weitaus vielschichtiger. Zwar gibt es nur wenige Daten, die einen Vergleich verschiedener Kulturen ermöglichen, aber vieles deutet darauf hin, dass in manchen von ihnen der Fortpflanzungserfolg von Männern weitaus variabler ist als in anderen, weshalb sich auch das Potential für unterschiedliche sexuelle Auslese bei Männern und Frauen deutlich unterscheidet und Faktoren wie das numerische Geschlechtsverhältnis oder die Populationsdichte wichtige Rollen spielen. Das Bateman-Prinzip allein eignet sich nicht, universelle Geschlechterrollen bei Menschen - Männer sind vom Mars, Frauen von der Venus - abzuleiten.
Mehrere Seiten widmet Meyer der Monogamie und Polygamie bei Präriewühlmäusen. Bloß erschließt sich nicht, warum er das eigentlich tut. Vielleicht, um zu zeigen, dass es eine hormonelle Ursache für unterschiedliche Paarungsmuster bei nahverwandten Arten gibt. Aber was hat das mit Menschen zu tun? Nichts - bei Kleinsäugern wie den Nagetieren ist Sozial- und Paarungsverhalten tatsächlich stark olfaktorisch und hormonell gesteuert. Bei Primaten spielen aber andere Mechanismen die entscheidende Rolle. Paarungsverhalten dient bei Primaten auch anderen sozialen Zwecken als Paarung und Fortpflanzung, und dies hat zur Abkopplung von hormonellen Mechanismen geführt.
Erst im vierzehnten Kapitel kommt Meyer zu dem Thema, dessen Behandlung viele Leser wohl schon gleich zu Beginn erwarteten: wie unterschiedlich Mann und Frau nun "wirklich" sind. Aber er referiert dort nur längst bekannte Ergebnisse, ohne auch nur mit einem Wort auf die methodologischen Probleme hinzuweisen, die mit ihrer Gewinnung verknüpft sind. Frauen sind also empathischer als Männer, dafür Männer besser als Frauen in Mathematik. Allerdings zeigen Experimente, dass solche erhobenen Unterschiede verschwinden, wenn die Testpersonen nicht darüber informiert werden, welche Eigenschaften im Experiment geprüft werden. Man kann auch diese Experimente einer Kritik unterziehen, aber erwähnen muss man sie schon. Wo nicht, entsteht der Eindruck, dass vorgefasste Festschreibungen den Ausschlag geben, nicht wissenschaftliche Einsichten.
Meyer führt im selben Kapitel auch die beiden amerikanischen Wissenschaftler Stephen Ceci und Wendy Williams als Kronzeugen für seine Behauptung an, die ungleiche Repräsentation von Frauen und Männern in mathematischen, naturwissenschaftlichen und technischen Fächern lasse sich durch Quoten nicht ändern - Frauen entschieden sich eben dafür, Familie und Kind einer Karriere vorziehen. Kein Wink wird aber dem Leser gegeben, dass die Arbeiten der beiden Forscher methodologisch wie statistisch äußerst umstritten sind und eine Außenseiterposition darstellen.
In den letzten Kapiteln wird Meyer dann deutlich polemischer, und es häufen sich halbgare und verzerrende Attacken auf fast alles, was "gender" im Namen führt. Ein sorgfältiger Autor sollte nicht einfach die immer wieder kolportierte Zahl von zweihundert Gender-Professuren in Deutschland wiederholen. Professuren mit einer Aufgabenbestimmung für Geschlechterforschung sind meist mit einer anderen Fachdisziplin verbunden - es sind zuallererst Professuren für Medizin, Biologie, Soziologie und so fort. Vollprofessuren für Geschlechterforschung gibt es tatsächlich nur wenige. "Gender mainstreaming" ist ein anderes Stichwort, das der Autor zu polemischen Zwecken verwendet. Dabei handelt es nur um das Prinzip, die unterschiedlichen Lebenssituationen und Interessen von Frauen und Männern - tatsächlich von beiden Geschlechtern - bei allen Entscheidungen auf allen gesellschaftlichen Ebenen zu berücksichtigen. Auch der Versuch, mehr Frauen zur Teilnahme an klinischen Versuchen zu neuen Medikamenten zu bringen, ist nichts anderes als Gender mainstreaming.
Ein weiterer Gegner von Meyer ist der "Kulturalismus", vulgo kultureller Relativismus. Wer aber die Existenz in der Evolution fundierter menschlicher Universalien behauptet, sollte auch den Einfluss kultureller Hegemonie auf kulturelle Diversität thematisieren, wie er sich in Zeiten der Globalisierung einstellt. Beispiele dafür gibt es zuhauf. Anthropologen haben anhand von Schönheitswettbewerben gezeigt, wie lokale Ideale von Attraktivität verdrängt werden. Auf Fidschi ist traditionell jeder Körper der Pflege und Sorge mehrerer Personen unterstellt, und ein wohlgenährter, robuster Körper galt als ideal und schön. "Dünn werden" wurde in diesem Kontext als eine Krankheit begriffen.
Achtzehn Monate nachdem Fernsehen mit westlichen Programmen verfügbar wurde, konnten Anthropologen einen signifikanten Anstieg von Versuchen feststellen abzunehmen - nicht weil dünn sein als schön galt, sondern weil ein solches Aussehen als Mittel zum Erreichen von Wohlstand betrachtet wurde. Anstatt solche und zahlreiche ähnliche Erkenntnisse zu diskutieren und vielleicht zu widerlegen, werden sie einfach ignoriert oder als antiwissenschaftlicher Hokuspokus mit Anthroposophie und Homöopathie in einen Topf geworfen.
Wer sich als Wissenschaftler des Themas Geschlechterdifferenzen annimmt, der kann sich nicht auf sein Gebiet zurückziehen, sondern muss andere Zugänge berücksichtigen. Biologie kann möglicherweise gewisse Grenzen menschlicher Verhaltensvielfalt erkennen lassen, aber biologische Erkenntnisse lassen auch Zweifel zu, dass diese Grenzen für immer unverrückbar sind.
THOMAS WEBER
Axel Meyer: "Adams Apfel und Evas Erbe". Wie die Gene unser Leben bestimmen und warum Frauen anders sind als Männer.
C. Bertelsmann Verlag, München 2015. 410 S., geb., 19,99 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Paarungsverhalten und Fortpflanzung: Der Evolutionsbiologe Axel Meyer versucht zu erklären, warum Frauen anders als Männer sind. Wie ein Wissenschaftler verhält er sich dabei nicht durchgehend.
Axel Meyer, international anerkannter Evolutionsbiologe an der Universität Konstanz, möchte in seinem Buch auf naturwissenschaftlicher Grundlage zeigen, was Männer und Frauen so alles voneinander unterscheidet. Er beginnt dabei ganz sachlich. Ein großer Teil des Buches widmet sich Grundlagen der Evolutionsbiologie, der sexuellen Auslese, klassischen Genetik und Genomik. Alles in allem ist die Darstellung leicht nachvollziehbar und oft informativ, mit extremen Urteilen hält sich der Autor zurück. Und doch spiegelt das Buch eine Klarheit und Eindeutigkeit vor, die sich dem Umstand verdankt, dass abweichende Erkenntnisse oder Deutungen in ihm nicht vorkommen.
Das gilt für naturwissenschaftliche Argumente und erst recht für die oft völlig ignorierten Erkenntnisse aus anderen Disziplinen. Meyer sieht sich selbst mit Blick auf Geschlechterdebatten als Anwalt der naturwissenschaftlichen Vernunft. An vielen für seine Argumentation entscheidenden Stellen wird man ihm das aber nicht so einfach durchgehen lassen wollen.
In der Evolutionsbiologie spielt das an Fruchtfliegen entdeckte "Bateman-Prinzip" für das Verständnis der Geschlechterrollen eine prominente Rolle: Es besagt, dass der Fortpflanzungserfolg von Männchen variabler als der von Weibchen ist, da sie eine variablere Zahl von Sexualpartnern haben - viele Männchen kommen nie zum Zuge, während andere viele Sexualpartner haben. Folglich ist der Fortpflanzungserfolg von Männchen stärker von der Zahl der Partner abhängig als bei Weibchen. Die Ursache für diesen Sachverhalt ist, dass Weibchen meist mehr Zeit und Energie in ihren Nachwuchs investieren als Männchen und daher eine begrenzte Ressource sind, um die Männchen konkurrieren.
Das klingt alles einleuchtend und wird gern als Erklärung für aggressives, kompetitives Verhalten von Männern und wählerisches, zurückhaltendes Agieren von Frauen herangezogen. Die Realität ist allerdings schon bei Tieren, erst recht aber bei Menschen weitaus vielschichtiger. Zwar gibt es nur wenige Daten, die einen Vergleich verschiedener Kulturen ermöglichen, aber vieles deutet darauf hin, dass in manchen von ihnen der Fortpflanzungserfolg von Männern weitaus variabler ist als in anderen, weshalb sich auch das Potential für unterschiedliche sexuelle Auslese bei Männern und Frauen deutlich unterscheidet und Faktoren wie das numerische Geschlechtsverhältnis oder die Populationsdichte wichtige Rollen spielen. Das Bateman-Prinzip allein eignet sich nicht, universelle Geschlechterrollen bei Menschen - Männer sind vom Mars, Frauen von der Venus - abzuleiten.
Mehrere Seiten widmet Meyer der Monogamie und Polygamie bei Präriewühlmäusen. Bloß erschließt sich nicht, warum er das eigentlich tut. Vielleicht, um zu zeigen, dass es eine hormonelle Ursache für unterschiedliche Paarungsmuster bei nahverwandten Arten gibt. Aber was hat das mit Menschen zu tun? Nichts - bei Kleinsäugern wie den Nagetieren ist Sozial- und Paarungsverhalten tatsächlich stark olfaktorisch und hormonell gesteuert. Bei Primaten spielen aber andere Mechanismen die entscheidende Rolle. Paarungsverhalten dient bei Primaten auch anderen sozialen Zwecken als Paarung und Fortpflanzung, und dies hat zur Abkopplung von hormonellen Mechanismen geführt.
Erst im vierzehnten Kapitel kommt Meyer zu dem Thema, dessen Behandlung viele Leser wohl schon gleich zu Beginn erwarteten: wie unterschiedlich Mann und Frau nun "wirklich" sind. Aber er referiert dort nur längst bekannte Ergebnisse, ohne auch nur mit einem Wort auf die methodologischen Probleme hinzuweisen, die mit ihrer Gewinnung verknüpft sind. Frauen sind also empathischer als Männer, dafür Männer besser als Frauen in Mathematik. Allerdings zeigen Experimente, dass solche erhobenen Unterschiede verschwinden, wenn die Testpersonen nicht darüber informiert werden, welche Eigenschaften im Experiment geprüft werden. Man kann auch diese Experimente einer Kritik unterziehen, aber erwähnen muss man sie schon. Wo nicht, entsteht der Eindruck, dass vorgefasste Festschreibungen den Ausschlag geben, nicht wissenschaftliche Einsichten.
Meyer führt im selben Kapitel auch die beiden amerikanischen Wissenschaftler Stephen Ceci und Wendy Williams als Kronzeugen für seine Behauptung an, die ungleiche Repräsentation von Frauen und Männern in mathematischen, naturwissenschaftlichen und technischen Fächern lasse sich durch Quoten nicht ändern - Frauen entschieden sich eben dafür, Familie und Kind einer Karriere vorziehen. Kein Wink wird aber dem Leser gegeben, dass die Arbeiten der beiden Forscher methodologisch wie statistisch äußerst umstritten sind und eine Außenseiterposition darstellen.
In den letzten Kapiteln wird Meyer dann deutlich polemischer, und es häufen sich halbgare und verzerrende Attacken auf fast alles, was "gender" im Namen führt. Ein sorgfältiger Autor sollte nicht einfach die immer wieder kolportierte Zahl von zweihundert Gender-Professuren in Deutschland wiederholen. Professuren mit einer Aufgabenbestimmung für Geschlechterforschung sind meist mit einer anderen Fachdisziplin verbunden - es sind zuallererst Professuren für Medizin, Biologie, Soziologie und so fort. Vollprofessuren für Geschlechterforschung gibt es tatsächlich nur wenige. "Gender mainstreaming" ist ein anderes Stichwort, das der Autor zu polemischen Zwecken verwendet. Dabei handelt es nur um das Prinzip, die unterschiedlichen Lebenssituationen und Interessen von Frauen und Männern - tatsächlich von beiden Geschlechtern - bei allen Entscheidungen auf allen gesellschaftlichen Ebenen zu berücksichtigen. Auch der Versuch, mehr Frauen zur Teilnahme an klinischen Versuchen zu neuen Medikamenten zu bringen, ist nichts anderes als Gender mainstreaming.
Ein weiterer Gegner von Meyer ist der "Kulturalismus", vulgo kultureller Relativismus. Wer aber die Existenz in der Evolution fundierter menschlicher Universalien behauptet, sollte auch den Einfluss kultureller Hegemonie auf kulturelle Diversität thematisieren, wie er sich in Zeiten der Globalisierung einstellt. Beispiele dafür gibt es zuhauf. Anthropologen haben anhand von Schönheitswettbewerben gezeigt, wie lokale Ideale von Attraktivität verdrängt werden. Auf Fidschi ist traditionell jeder Körper der Pflege und Sorge mehrerer Personen unterstellt, und ein wohlgenährter, robuster Körper galt als ideal und schön. "Dünn werden" wurde in diesem Kontext als eine Krankheit begriffen.
Achtzehn Monate nachdem Fernsehen mit westlichen Programmen verfügbar wurde, konnten Anthropologen einen signifikanten Anstieg von Versuchen feststellen abzunehmen - nicht weil dünn sein als schön galt, sondern weil ein solches Aussehen als Mittel zum Erreichen von Wohlstand betrachtet wurde. Anstatt solche und zahlreiche ähnliche Erkenntnisse zu diskutieren und vielleicht zu widerlegen, werden sie einfach ignoriert oder als antiwissenschaftlicher Hokuspokus mit Anthroposophie und Homöopathie in einen Topf geworfen.
Wer sich als Wissenschaftler des Themas Geschlechterdifferenzen annimmt, der kann sich nicht auf sein Gebiet zurückziehen, sondern muss andere Zugänge berücksichtigen. Biologie kann möglicherweise gewisse Grenzen menschlicher Verhaltensvielfalt erkennen lassen, aber biologische Erkenntnisse lassen auch Zweifel zu, dass diese Grenzen für immer unverrückbar sind.
THOMAS WEBER
Axel Meyer: "Adams Apfel und Evas Erbe". Wie die Gene unser Leben bestimmen und warum Frauen anders sind als Männer.
C. Bertelsmann Verlag, München 2015. 410 S., geb., 19,99 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main