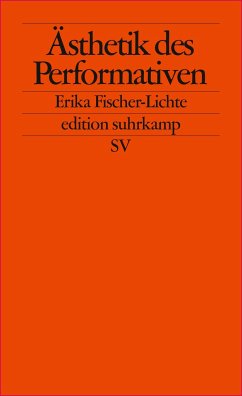Spätestens seit den 60er Jahren lassen sich zeitgenössische Kunstwerke nicht mehr in den Begriffen herkömmlicher Ästhetiken erfassen. Anstatt 'Werke' zu schaffen, bringen die Künstler zunehmend Ereignisse hervor, die in ihrem Vollzug die alten ästhetischen Relationen von Subjekt und Objekt, von Material und Zeichenstatus außer Kraft setzen. Um diese Entwicklung verstehen zu können, entwickelt Erika Fischer-Lichte in ihrer grundlegenden Studie eine Ästhetik des Performativen, die den Begriff der Aufführung in den Mittelpunkt stellt. Dieser umfaßt die Eigenschaften der leiblichen Kopräsenz von Akteuren und Zuschauern, der performativen Hervorbringung von Materialität sowie der Emergenz von Bedeutung und mündet in eine Bestimmung der Aufführung als Ereignis. Die Aufhebung der Trennung von Kunst und Leben, welche die neueren Ausdrucksformen anstreben, wird hier ästhetisch auf den Begriff gebracht.

Erika Fischer-Lichte findet eine Ästhetik für unsere Gegenwart
Ästhetik des Performativen", der Titel des neuesten Buchs der Berliner Theaterwissenschaftlerin Erika Fischer-Lichte, ist so abstrakt, wie man es von einer akademischen Veröffentlichung - in Deutschland wenigstens - erwartet. Doch die Autorin beginnt mit der im konkreten Sinn des Wortes atemberaubend genauen Beschreibung einer "Performance" der Künstlerin Marina Abramovic, die sich am 24. Oktober 1975 ereignete. Vor dem in einer Innsbrucker Galerie versammelten Publikum entledigte sich Abramovic ihrer Kleidung, aß dann langsam ein ganzes Kilo Honig und leerte eine Flasche Rotwein. Sie zerbrach das Rotweinglas in ihrer nackten Hand, ritzte mit einer Rasierklinge ein sternförmiges Monogramm in ihren Bauch und peitschte ihren Rücken, um sich mit ausgebreiteten Armen unter Heizstrahlern auf ein Kreuz aus Eisblöcken zu legen. Nach einer halben Stunde hielten es einige Zuschauer nicht mehr aus, dies alles mit anzusehen, und beendeten die Performance, indem sie Marina Abramovic vom Ort ihrer selbstinszenierten Leiden trugen.
Fischer-Lichte protokolliert in solcher Detailintensität, daß man als Leser tatsächlich das Dilemma der Zuschauer von 1975 spürt, und auf den folgenden Seiten macht sie mit einer Fülle von Verweisen auf Künstler wie John Cage und Joseph Beuys oder auf Günter Grass (der sich bei einer Lesung des "Butt" von einem Schlagzeuger begleiten ließ) klar, warum sie das Innsbrucker Ereignis als einen besonders hervorstechenden Fall dessen ansieht, was sie die "performative Wende" in der kulturellen Szene der sechziger und siebziger Jahre nennt. In eindrucksvoller Kohärenz entwickelt ihr Buch eine Ästhetik dieser performativen "Kunst", und es gehört zu seinen Hauptverdiensten, daß Fischer-Lichtes Begriffe einen Bereich von Phänomenen anschaulich erschließen - ganz unabhängig davon, ob der Leser, wie die Autorin selbst offenbar, bereit ist, sich von solchen Performanz-Ereignissen faszinieren zu lassen, oder sie als Abweg der westlichen Kultur verdammen möchte. Fischer-Lichtes Unterscheidungen sind konsequent induktiv entwickelt, ausgehend von der Beobachtung, daß das typische Verhältnis zwischen Performance-Künstler und Publikum der von jeder Interpretation vorausgesetzten Dichotomie zwischen Zuschauer-Subjekt und Kunst-Objekt nicht entspricht. Interpretation als Sinnzuschreibung kann also weder die angemessene Zuschauerreaktion auf Performanz-Kunst sein noch die Grundlage einer einschlägigen Ästhetik. Auf Hermeneutik und Semiotik kann diese Ästhetik, anders gesagt, nicht bauen.
Hier setzt eine lange Serie begrifflicher Substitutionen ein. An der Stelle des "Werks", postuliert Fischer-Lichte, soll in einer Ästhetik des Performativen das "Ereignis" stehen. Nicht als - bedeutungstragende - "Texte", wie es die neue Kulturwissenschaft fordert, soll man Ereignisse und Dinge erschließen, sondern als (in den meisten Fällen mit erheblichem Aufwand inszenierte) "Aufführungen". Nicht "Sinn" bringen Aufführungen hervor, sondern unmittelbar präsente "Materialität". Es gibt kein "Spiel" auf der Bühne, das so tut, als fände es in Abwesenheit eines Publikums statt, sondern eine produktive "Feedback-Schleife" zwischen der Performanz der Akteure und den unmittelbaren Reaktionen ihrer Zuschauer. Zeit fügt sich nicht zum Bogen einer "Erzählung", sondern stiftet Form durch "Rhythmus" und "Time Brackets".
Das Repertoire solcher Unterscheidungen ließe sich - aus der Perspektive eines wissenschaftlichen Lesers: unter wachsender Beistimmung oder wachsender Kritik - noch lange weiterführen. Aber selbst wer zustimmt, wird am Ende erkennen, daß dieses Buch etwas viel Außergewöhnlicheres zu bieten hat als nur die Architektur eines respektablen Theorie-Entwurfs. Bemerkenswert ist zunächst, wie es Erika Fischer-Lichte gelingt, in allen Verästelungen ihrer Unterscheidungskaskaden erstaunliche Transparenz zu wahren. Dabei hilft, daß sie, wo immer möglich, Wörtern der gehobenen Alltagssprache den Vorzug vor arkanen Termini der Wissenschaftssprache gibt und daß sie - was sich nahtlos mit ihrem induktiven Gestus verbindet - oft und mit Recht bei Phänomenbeschreibungen haltmacht, wo "strengere" Wissenschaftler eine ebenso kompakte wie unleserliche Definition nachgeschoben hätten. Vor allem aber akkumulieren sich diese Beschreibungen in Erika Fischer-Lichtes Buch zu einem Panorama jener Performanz-Kunst, deren Ästhetik sie schreiben will - innerhalb der besten Passagen sogar zu Parallelgeschichten des Theaters (im weitesten Sinn) und der Theaterwissenschaften. Zu erfahren, wie etwa die Inszenierungen Max Reinhardts im Berlin des frühen zwanzigsten Jahrhunderts die Entstehung der Theaterwissenschaft heraufbeschworen haben, erschließt ein ebenso unbekanntes wie bedeutendes Kapitel deutscher Kulturgeschichte.
Man kann sich also tatsächlich vorstellen, daß ein an der kulturellen Avantgarde unserer Zeit interessierter, aber keinesfalls wissenschaftlich motivierter Leser dieses Buch - trotz seines Titels - mit Gewinn und sogar mit Freude studiert. Aber sehen wir einmal von Erika Fischer-Lichtes potentiellen Lesern ab. Welche Antwort gibt sie auf die Frage, was der Gewinn oder - wenn man dieses Wort für zu praktisch hält - der spezifische Genuß sein soll, den die Performanz-Kunst ihren Anhängern bietet? Erstaunlicherweise vielleicht sieht sie von den heute oft sehr hoch gehandelten Lösungen oder philosophischen Vorschlägen ab, die in die Richtung von "Intensität" oder gar "Ekstase" verweisen. Das wäre nicht Erika Fischer-Lichtes intellektueller Stil. Ihre Antwort wird vorsichtiger über die Frage vorbereitet, wie man unterscheiden könne zwischen solchen Performanz-Ereignissen, die wir der ästhetischen Erfahrung zuschlagen, und solchen, bei denen uns dies - wie bei Parteitagen oder Warenmessen - nicht in den Sinn käme. Die Antwort heißt dann natürlich, das weiß man seit Andy Warhol (und in deutschen Wissenschaftskreisen spätestens seit Peter Bürger), daß die Zuschreibung ganz einfach dem institutionellen Rahmen folgt. Jene Performanz-Ereignisse, die in einem Museum stattfinden oder von einem Stadttheater organisiert sind (selbst wenn sie sich in einem stillgelegten Bahnhof ereignen), identifizieren wir mühelos als "Kunst". Da die Inhalte solcher Ereignisse aber häufig - oder vielleicht sogar in den meisten Fällen - nicht den überkommenen Begriffen von Kunst entsprechen, bringen sie unsere grundsätzlichen Rahmen-Voraussetzungen in Bewegung. Und in solchem Auslösen einer Oszillation und einer produktiven Unsicherheit soll sich die der Performanz-Kunst spezifische Variante ästhetischer Erfahrung erfüllen.
Man braucht dieser Antwort auf eine zentrale Frage der "Ästhetik des Performativen" nicht zu widersprechen, um sie - wenigstens für eine Theaterwissenschaftlerin - ziemlich undramatisch zu finden. Als wohltuend undramatisch, wenn man die Antwort mit den doch oft sehr schrillen existentiellen und politischen Versprechungen nicht weniger Performanz-Künstler vergleicht. Aber selbst unter philosophischer Perspektive neigt Erika Fischer-Lichte dazu, scharfe Kontraste herunterzuspielen - so klar und markant sie auch ihre begrifflichen Unterscheidungen ausgearbeitet hat. Das mag der Grund sein, warum sie sich dem - ursprünglich dekonstruktiven - Motiv der Auflösung scharf-binärer Gegensätze verschrieben hat: Verschiedene situationale Rahmen sollen sich wechselseitig relativieren. Repräsentation und Sinnproduktion sind in der Ästhetik des Performativen nicht gänzlich ausgeschlossen, sondern werden als Nebeneffekte der Konfrontation des Zuschauers mit "Materialität" beobachtet. Selbst die abschließende starke These von einer "Wiederverzauberung der Welt" in der Kultur der Gegenwart soll mit der Tradition der Aufklärung vereinbar sein - die wir doch sonst fast unwillkürlich gerade mit einer "Ent-Zauberung der Welt" assoziieren. Aber diese Tendenz zur Vermittlung ist wohl weniger eine Angelegenheit von "wahr" oder "falsch", sondern, wie schon angedeutet, die Gestik eines bestimmten intellektuellen Temperaments. Und keinem wissenschaftlich interessierten Leser ist es benommen, die von Erika Fischer-Lichte vorgeschlagenen Unterscheidungen mit entschiedenerer Trennschärfe zu verwenden, als sie es selbst tut.
Am Ende gerät auch die eine ernstliche Kritik, die man diesem Buch entgegenstellen möchte, zu einem Kompliment. Die Kritik heißt, daß die Ästhetik des Performativen für ein viel breiteres Spektrum von Phänomenen von Belang ist als allein für die Ereigniskunst nach der "performativen Wende". Nicht nur Autoren unserer Gegenwart haben Erfolg damit, ihre Texte zu rezitieren - zugleich entdecken wir den Klang von Petrarcas Sonetten wieder und die Aufführungssituationen der Troubadourlyrik. Während action painting längst zu einer kanonischen Kunstform der Gegenwart geworden ist, wollen wir auch in den Gemälden Leonardos oder Goyas die Gegenwarten und Prozesse ihrer Herstellung entdecken. Erika Fischer-Lichte hat also nicht allein nur eine Ästhetik der Performanz-Kunst geschrieben, sondern die Philosophie einer neuen ästhetischen Sensibilität unserer Zeit.
Erika Fischer-Lichte: "Ästhetik des Performativen". Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2004. 377 S., br., 14,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Rezensent Hans-Ulrich Gumbrecht ist ausgesprochen angetan von dieser Ästhetik der Performance-Kunst, die für ihr auch eine "Philosophie einer neuen ästhetischen Sensibilität" der Gegenwart geworden ist. Trotz seines etwas sperrigen Titels könne das Buch auch von ganz unwissenschaftlichen Lesern mit Freude studiert werden. Zu den Qualitäten der Publikation zählt er die atemberaubend detailintensiven Beschreibungen von Performances und Aufführungen ebenso, wie deren begriffliche Erschließung. Wo immer es möglich sei, gebe die Berliner Professorin der Theaterwissenschaft Wörtern aus der gehobenen Alltagssprache den Vorzug. Die Beschreibungen dieses Buches akkumulieren für den Rezensenten schließlich zu einem Panorama jener Performance-Kunst, deren Ästhetik Erika Fischer-Lichte schreiben wolle, innerhalb der besten Passagen sogar zur Parallelgeschichte des Theaters und der Theaterwissenschaft.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH