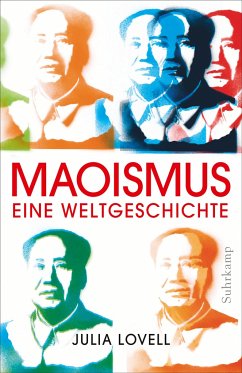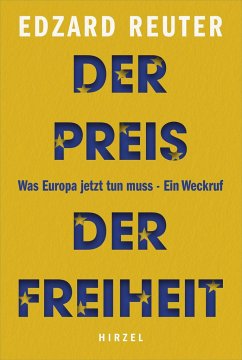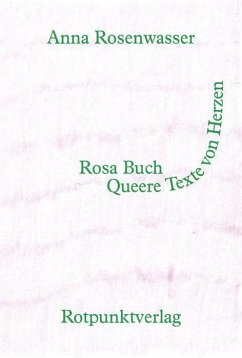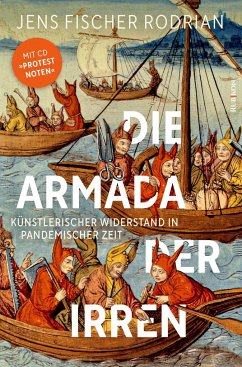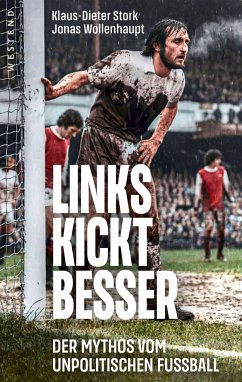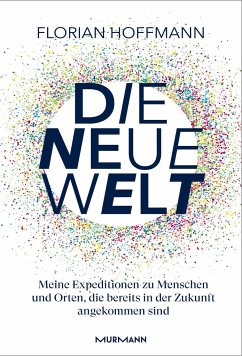Afrika ist kein Land
Das Manifest gegen Dummheit, Faulheit und Einfachheit im Umgang mit der Vielgestaltigkeit des afrikanischen Kontinents SPIEGEL Bestseller
Übersetzung: Agoku, Jessica

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Mehr als 1,4 Milliarden Menschen, 54 Länder, über 2.000 Sprachen, seit Jahrzehnten auf einfache Geschichten reduziert: Hunger, Safaris, vielleicht noch brutale Diktaturen. Ein ganzer Kontinent wird bis zur Horrorhaftigkeit simplifiziert, mit desaströsen Folgen ... Dipo Faloyin hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese Stereotype aus der Welt zu schaffen. Mit Biss, Tempo, unwiderstehlichem Charme zeichnet er ein zeitgemäßes Porträt Afrikas: urbanes Leben in Lagos, der erfolgreiche Kampf für Demokratisierung, die Kehrseite der Charity-Industrie, durchgeknallte kulinarische Rivalitäten, lebe...
Mehr als 1,4 Milliarden Menschen, 54 Länder, über 2.000 Sprachen, seit Jahrzehnten auf einfache Geschichten reduziert: Hunger, Safaris, vielleicht noch brutale Diktaturen. Ein ganzer Kontinent wird bis zur Horrorhaftigkeit simplifiziert, mit desaströsen Folgen ... Dipo Faloyin hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese Stereotype aus der Welt zu schaffen. Mit Biss, Tempo, unwiderstehlichem Charme zeichnet er ein zeitgemäßes Porträt Afrikas: urbanes Leben in Lagos, der erfolgreiche Kampf für Demokratisierung, die Kehrseite der Charity-Industrie, durchgeknallte kulinarische Rivalitäten, lebendige zivilgesellschaftliche Bewegungen, die einzigartige Rolle der Aunties im Großfamiliengefüge. Dipo Faloyin erzählt andere Geschichten, positiv, divers, kompliziert. Immer getrieben von Lebenslust und dem Glauben an eine großartige Zukunft trotz aller kolonialen Hindernisse.
Afrika ist kein Land korrigiert eine globale Wahrnehmungsverzerrung. Es ist das erzählerische Manifest gegen Dummheit, Faulheit und Einfachheit im Umgang mit der Vielgestaltigkeit des afrikanischen Kontinents. Und eine absolut hinreißende Intervention.
Afrika ist kein Land korrigiert eine globale Wahrnehmungsverzerrung. Es ist das erzählerische Manifest gegen Dummheit, Faulheit und Einfachheit im Umgang mit der Vielgestaltigkeit des afrikanischen Kontinents. Und eine absolut hinreißende Intervention.