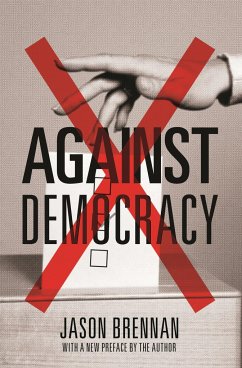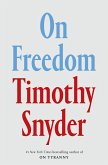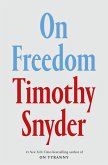Most people believe democracy is a uniquely just form of government. They believe people have the right to an equal share of political power. And they believe that political participation is good for us - it empowers us, helps us get what we want, and tends to make us smarter, more virtuous, and more caring for one another. These are some of our most cherished ideas about democracy. But Jason Brennan says they are all wrong. In this trenchant book, Brennan argues that democracy should be judged by its results - and the results are not good enough. Featuring a new preface that situates the book within the current political climate and discusses other alternatives beyond epistocracy, Against Democracy is a challenging critique of democracy and the first sustained defense of the rule of the knowledgeable.

Warum Mehrheiten nicht immer recht haben
Politische Ordnungen blieben selbst dann ein Thema der Ökonomie, als die Disziplin nach der Klassik nicht mehr als Politische Ökonomie verstanden wurde. Auch wer nur individuelle Entscheidungen erklären will, entdeckt - etwa dank der Frage, ob man von rationalen und informierten Akteuren ausgehen darf - sehr schnell die Parallelen zur Demokratietheorie. So stoßen wir von John Stuart Mill bis Hayek auf Vorschläge zur Demokratiereform, und Schumpeters Kritik an der klassischen Demokratietheorie hat zahlreiche ökonomische Interpretationen der Politik inspiriert.
Trotz des provozierenden Buchtitels und der Behauptung, Demokratie durch Expertokratie ersetzen zu wollen, gesellt Jason Brennan sich zu denen, die zwar eine aus allgemeinen Wahlen hervorgehende Legislative als unumgänglich akzeptieren, aber eine zweite Instanz hinzufügen, der sie kein Initiativ-, wohl aber ein Vetorecht geben wollen. Der Vorschlag ist weder originell noch erfolgversprechend. Dennoch empfiehlt sich das Buch in zweifacher Hinsicht. Zum einen trägt es zusammen, was empirische Studien über die Kompetenz der Wähler sagen. Zum anderen fragt es in ungewöhnlicher Klarheit nach der Rechtfertigung des Mehrheitsprinzips.
Niemand mehr würde Konsumenten oder Wählern systematische Rationalität oder allseitige Informiertheit unterstellen, und doch ist die massive Dokumentation des Gegenteils schockierend. Die Lust, die es ihm bereitet, aus der wissenschaftlichen Literatur Urteile über die Inkonsistenz und das Unwissen der allermeisten Wähler darzubieten, steigert Brennan noch durch den Hinweis, dass der Wissensstand gewöhnlich durch Multiple-Choice-Fragen ermittelt werde, so dass der ohnehin geringe Umfang vermeintlichen Wissens zum Teil auf Glückstreffern beruhe.
So stimmt er Philip Converse zu, der geschrieben hatte, die Verteilung politischer Informationen in modernen Wählerschaften zeige zwei Auffälligkeiten - niedrigen Durchschnitt bei hoher Unterschiedlichkeit. Dies böte die Gelegenheit, dem Unterschied zwischen repräsentativer Demokratie und anderen Formen nachzuspüren, da der "cognitive shortcut", den Brenner erwähnt, bedeuten kann, dass politische Parteien die Informationskosten des Einzelnen erheblich reduzieren - freilich nur soweit sie konkurrierende Programme anbieten.
Es geht aber nur um die Kritik am Mehrheitsprinzip, weshalb er nach der deprimierenden Schilderung der durchschnittlichen Inkompetenz auf sein sozialphilosophisches Argument zusteuert, das er durch die Unterscheidung zwischen Prozeduralisten und Instrumentalisten einführt. Dass er sich zu den Letzteren zählt, also demokratische Verfahren nicht als Selbstzweck versteht, macht er durch eine dicht argumentierte Kritik der Ersteren verständlich, denen jede Entscheidung schon dann gerechtfertigt erscheint, wenn sie nur demokratisch zustande gekommen ist, und die zudem von Mill bis zu den gegenwärtigen Diskurstheorien die Demokratie mit einem emanzipatorischen Bildungserlebnis verwechseln. Sie mache die Beteiligten gebildeter, klüger und edler. Politik sei aber kein Gedicht, wendet Brennan ein.
Hoffen die Prozeduralisten also, Beteiligung an der Politik erzeuge positive Nebenwirkungen, so betont Brennan ihre negativen: Während es mich nicht sonderlich betrifft, wenn andere von Bürgerrechten wie der Meinungs- oder Versammlungsfreiheit Gebrauch machen, gibt es keinen Schutz vor dem Schaden, den inkompetente Wähler anrichten. So wie nur derjenige ein Fahrzeug betreiben dürfe, der seine Fähigkeit dazu bewiesen habe, hätten wir einen Anspruch darauf, dass die Unwissenden von der Wahlurne ferngehalten oder wenigstens die Stimmen der Kundigen stärker gewichtet würden.
Gut gebrüllt. Wenn aber, abgesehen von naheliegenden Einwänden gegen eine Expertenherrschaft, solche Vorschläge illusorisch sind, sollte Brennans Kritik am Mehrheitsprinzip eher als Aufforderung verstanden werden, den Wettbewerbscharakter der repräsentativen Demokratie zu stärken, der Demokratisierungslyrik der Populisten wie der Diskurstheoretiker zu misstrauen und der Politisierung aller Lebensbereiche entgegenzutreten.
MICHAEL ZÖLLER
Jason Brennan: Against Democracy. Princeton University Press 2016, 304 Seiten, 29,95 Dollar
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
"Brennan has a bright, pugilistic style, and he takes a sportsman's pleasure in upsetting pieties and demolishing weak logic. Voting rights may happen to signify human dignity to us, he writes, but corpse-eating once signified respect for the dead among the Fore tribe of Papua New Guinea. To him, our faith in the ennobling power of political debate is no more well grounded than the supposition that college fraternities build character."--Caleb Crain,New Yorker
"A brash, well-argued diatribe against the democratic system. There is much to mull over in this brazen stab at the American electoral process. . . . [I]n the current toxic partisan climate, Brennan's polemic is as worth weighing as any other."