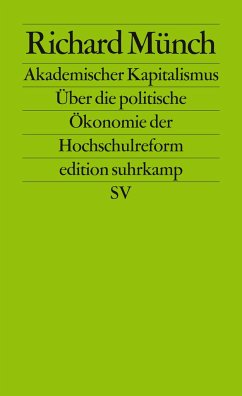Der Bildungsstreik und die Hörsaalbesetzungen im Jahr 2009 haben gezeigt, daß der Widerstand gegen Studiengebühren und die Bologna-Reform sich immer weiter aufheizt. Die Studierenden klagen über zunehmenden Streß, maßgebliche Ziele der Reform wurden verfehlt. Richard Münch, einer der renommiertesten Kritiker dieser Entwicklung, untersucht in seiner brisanten neuen Studie die Kräfte hinter dem neuen akademischen Kapitalismus. Er legt dar, wie sich die Hochschulen unter dem Einfluß von Beratungsfirmen in Unternehmen verwandeln und wie kurzfristige Nutzenerwartungen das Innovationspotential der Forschung untergraben.

Großer intellektueller Aufwand und geringe gedankliche Stringenz: Richard Münch beweint das akademische Jammertal und stärkt sein Profil als kritischer Wissenschaftler
Der italo-amerikanische Wissenschaftshistoriker Mario Biagioli sprach kürzlich über eine vertrackte Situation im amerikanischen Patentrecht: Was als Erfindung gelten dürfe, werde derzeit so neu ausgelegt, dass auch immaterielle Innovationen - etwa bestimmte Geschäftsmethoden - unter Patentschutz gestellt werden könnten. Biagioli sah darin weniger eine Anpassung an neue Technologien als eine kommerziell motivierte "Masche zur Produktion von mehr intellektuellem Eigentum". Zugleich stellte er aber fest, dass sich die Gegner dieser Entwicklung in Widersprüche manövrierten, sobald sie das zuvor Selbstverständliche zu begründen versuchten - dass nämlich Erfindungen etwas Materielles sein müssten. Daraus leitete er einen Schluss ab, den man nur auf Amerikanisch ziehen kann: "The good guys don't necessarily have the good arguments."
Sucht man in Deutschland nach einer Bestätigung für diesen Satz, wird man in der Klageliteratur über den Niedergang der Universität fündig. Deren Autoren sehen sich gerne auf Seiten der "good guys", und dies nicht ohne Grund. Im Überschwang der gerechten Empörung landen sie aber allzu oft im argumentativen Abseits. In dieser traurigen Gattung rangieren die Werke des Bamberger Soziologen und Suhrkamp-Autoren Richard Münch. In den letzten vier Jahren verfasste er nicht weniger als drei Bücher über den universitären Wissenschafts- und Lehrbetrieb, deren gemeinsames Kennzeichen großes intellektuelles Engagement und geringe gedankliche Stringenz ist. Auch Münchs vorläufig letzter Streich, eine Grundsatzkritik des "akademischen Kapitalismus", dürfte seine Bestimmung darin finden, einer exzellenzgeplagten akademischen Leserschaft als geistiges Ventil für angestaute Frustrationen zu dienen. Ein solches Ventil mag für viele vonnöten sein, nur bläst es hier einer Auseinandersetzung mit dem Thema die Luft aus.
Der Fluch der Quantifizierung wird von Münch mit einem Wust von Statistiken gebannt, die Einrichtung von Exzellenzwettbewerben auf die Herrschaft der Medien über die Politik zurückgeführt, und wo die Argumentation ins Stocken gerät, sprudelt die Sprache umso kräftiger weiter: "Im Zuge der zunehmenden Verflechtung der Innovationspolitik des neuen Wettbewerbsstaates und des Innovationswettbewerbs zwischen Unternehmen in der wissensbasierten Ökonomie mit der innovationsgeleiteten Forschung im Zuge der Konkurrenz zwischen unternehmerisch operierenden Universitäten entsteht eine neue Politische Ökonomie der Wissenschaft, in der die Wahrheitssuche ein enges Bündnis mit der wirtschaftlichen Profitmaximierung und der staatlichen Machtsicherung eingeht." Etwas schlanker formuliert: Durch die Verflechtung von Politik, Wirtschaft und Wissenschaft wird die Wissenschaft mit der Politik und Wirtschaft verflochten.
An guten Vorsätzen und interessanten Ansätzen mangelt es dem Buch nicht. Im Vorwort beteuert Münch, es gehe ihm nicht darum, den Realitäten der Gegenwart "ein normativ wünschenswertes" Modell entgegenzustellen und "in die allseits zu hörende Klage über den Untergang der Universität im Strudel des Neoliberalismus einzustimmen"; seine Absicht sei vielmehr, den Wandel der Universität "zu begreifen und zu verstehen". Das klingt vielversprechend, ebenso wie der Ansatz, die Umgestaltung der deutschen Universitätslandschaft in einen internationalen Kontext zu stellen. In diesem Bezugsrahmen wird zumindest ersichtlich, dass der neoliberale Umbau der Universität in Deutschland andere Folgen zeitigt als in den Vereinigten Staaten oder Großbritannien, weil hier die neuen Strukturen einer "Oligarchie der Lehrstühle" aufgepfropft werden, was neofeudale Schließungsmechanismen im akademischen Feld begünstigt.
Allein, den interessanten Ansätzen folgen kaum aufschlussreiche Analysen, und dies vorwiegend aus drei Gründen: Der erste ist, dass Münch seinen Vorsatz, verstehen und nicht klagen zu wollen, bald über den Haufen wirft. Seiner Einordnung der derzeitigen Universitätsreformen legt er die Vorstellung eines akademischen Normalzustands zugrunde, mit der er Robert Mertons "wissenschaftlichen Kommunismus" verkitscht: "Wissenschaftliche Praxis ist also ein Schenken aus Dankbarkeit, Verbundenheit und Verpflichtung, eine kollektive Erkenntnissuche und Produktion eines Kollektivgutes, ein produktiver Wettbewerb und Qualität und Priorität ohne Sieger und Besiegte. Sie wird aus reinem Interesse an desinteressierter Forschung betrieben. Akademische Lehre ist ein Geschenk von Lehrenden für Lernende, von Lernenden für Lehrende, von beiden für die akademische Gemeinschaft." Wer die universitäre Welt zum wissenskommunistischen Paradies verklärt, wird jede akademische Wirklichkeit als Jammertal empfinden.
Der zweite Grund für die analytische Schwäche besteht darin, dass es Münch eingangs unterlässt, den eigenen Ort im akademischen Kräftefeld abzustecken. Es hätte ihm dabei helfen können, aus der uninspirierenden Rolle des "good guy" auszubrechen, zumal er ja in einen Prozess interveniert, in den er bereits involviert ist. Als Professor an einer kleineren bayrischen Universität, die im Schatten der beiden Münchner "Exzellenz"-Türme steht, zieht Münch aus der Hochschulreform jenen Gewinn, den sie ihren "Opfern" gewährt: Er stärkt sein Profil als kritischer Wissenschaftler. So legitim das ist, problematisch wird es dadurch, dass er seine Interessenlage verschleiert. So kann er aus ihr kaum analytische Kraft, sondern bloß polemische Energie gewinnen. Sie sorgt etwa dafür, dass aus Pierre Bourdieus soziologischem Sezierbesteck eine stumpfe Waffe gegen die anonymen Truppen des "akademischen Kapitalismus" wird oder dass der Autor auf argumentative Nebengeleise gerät, wo er sich der Ungerechtigkeit der Exzellenzinitiative gegenüber exzellenten Forschen an nicht-"exzellenten" Universitäten widmet.
Der dritte Grund dürfte der gewichtigste sein: Münch befasst sich mit dem "akademischen Kapitalismus", ohne sich mit der Idee der unternehmerischen Universität, wie sie Wissenschaftssoziologien wie Burton Clark vertreten haben, gründlich auseinanderzusetzen. Lieber bindet er den akademischen Kapitalismus an Reizwörtern wie "Benchmarking", "Business Process Reengineering" und "Total Quality Management" fest, die ihm zufolge am MIT und in Harvard entwickelt und von McKinsey, Accenture und anderen Beraterfirmen zur globalen Gehirnwäsche eingesetzt worden seien. So erscheint die unternehmerische Universität letztlich als Ausgeburt einer neoliberalen Verschwörung und nicht, wie es einem analytischen Verständnis förderlicher wäre, als ernsthafter Antwortversuch auf reale strukturelle und kulturelle Probleme in westlichen Universitäten, dessen unbeabsichtigten Folgen noch größere Probleme geschaffen haben.
CASPAR HIRSCHI
Richard Münch: "Akademischer Kapitalismus". Über die politische Ökonomie der Hochschulreform.
Suhrkamp Verlag, Berlin 2011. 459 S., br., 18,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Es ist ja nicht so, dass Caspar Hirschi mit den jüngsten Reformen an deutschen Universitäten im Reinen wäre. So leicht wie der Bamberger Soziologe Richard Münch, meint er allerdings, dürfe man sich die Kritik auch wieder nicht machen. Spürbar sei im Buch die Wut des Verfassers, nur kommen, so Hirschi, die Argumente nicht wirklich verlässlich hinterher. So tauge zum Beispiel das Ideal eines Wissenschaftskommunismus, das Münch beschwört, als Gegenbild zur real existierenden Praxis eher nicht. Auch hält es der Rezensent für problematisch, dass der Autor seine eigene Lage - als Professor an einer bayerischen Nicht-Exzellenz-Universität - nicht mitreflektiert. Summa summarum also: Bedauern über die in mehr als einer Hinsicht zu kurz springende Analyse einer auch vom Rezensenten als hoch problematisch wahrgenommene Situation.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»[Richard Münch] ist akribisch und kritisch im Umgang mit den Gegebenheiten, konstruiert aber keine wissenschaftspolitischen Luftschlösser. Auch dieser Realismus ist eine Stärke seiner - Pardon! - exzellenten Arbeit, die mit messerscharfen, glasklaren Analysen aufwartet und in ihrer 'theoretischen' und dabei 'idealtypisch verfahrenden' Methodik die Folgeprobleme so zuspitzt, dass deutlich wird, welche Gefahren das 'Glaubenssystem Bologna' birgt.« Josef Bordat titel-magazin.de 20110923
»Indem Münch, mutig wie sonst kaum jemand seines Standes, radikal und statistisch gut gerüstet die Frage nach dem Sinn und Zweck der Universität stellt, will er deren Bestes retten, ihr kritisches und kreatives Potenzial.«