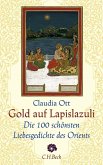Gedichte, die von allem handeln (von Aller Ding eben), außer von der Liebe, denn da planen wir einen anderen Band: Liebesgedichte.
"Aller Ding": ein Band mit neuen Gedichten des Bachmann-Preisträgers Michael Lentz. Ungewöhnlich ist allein schon das Spektrum des Bandes. Traditionelle Gebilde stehen neben "Liebesgedichten", sogenannten "erweiterten Fundstücken" und "Einworten". Kapitel wie "Gedichtete Gedichte" oder "Reim und Schlamm" versammeln Poeme, in denen Tradition und Experiment zu einer sprachlichen Einheit verschmelzen. "Aller Ding" erprobt unterschiedliche Haltungen und Tonfälle, lotet auch formale Grenzen aus und zeigt sich so ganz frei von sprachmodischen Zwängen. Zwischen "todernst" und "lebensheiter" liegt das Alphabet, unser aller Ding.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
"Aller Ding": ein Band mit neuen Gedichten des Bachmann-Preisträgers Michael Lentz. Ungewöhnlich ist allein schon das Spektrum des Bandes. Traditionelle Gebilde stehen neben "Liebesgedichten", sogenannten "erweiterten Fundstücken" und "Einworten". Kapitel wie "Gedichtete Gedichte" oder "Reim und Schlamm" versammeln Poeme, in denen Tradition und Experiment zu einer sprachlichen Einheit verschmelzen. "Aller Ding" erprobt unterschiedliche Haltungen und Tonfälle, lotet auch formale Grenzen aus und zeigt sich so ganz frei von sprachmodischen Zwängen. Zwischen "todernst" und "lebensheiter" liegt das Alphabet, unser aller Ding.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.

Ein Sprachkonzert, frei nach Heißenbüttel, Pastior und Jandl: In seinen Gedichten gräbt Michael Lentz eher flach als tief
Kein Zweifel: Der Bachmann-Preisträger Michael Lentz, der mit der rasanten Prosa von "Muttersterben" beeindruckte, ist ein shooting star unter den jungen Autoren. Ob sein Glanz am Literaturhimmel sich weiter entfalten wird, mag "Liebeserklärung" zeigen, sein für den Herbst angekündigtes Romandebüt. Bei der Lyrik von Lentz sind allemal Zweifel angebracht.
Sein Gedichtband "Aller Ding" kommt mit fast zweihundert Seiten üppig daher, ist aber ein mageres Buch - ein Fake der Fülle. Mager ist es, weil ein Drittel des Buches nur mit ein, zwei Zeilen bedruckt ist. Mager, weil der Autor die Spiele der konkreten Poesie noch einmal nachspielt. Mager, weil er den Leser daran hindern möchte, die Leere seiner Texte leer zu nennen. Der Autor zwinkert uns zu, möchte uns durch Ironie korrumpieren. Er selber gibt den Kaiser, der nackt ist. Und wer möchte schon als ironielos gelten, gar als humorlos?
Zum Glück sind die Fallen so aufgestellt, daß vermutlich kaum ein Leser hineintappt. Er liest auf Seite 144 ganze zwei Zeilen: "etwas / wenig". Das denkt er schon die ganze Zeit. Doch wenn er jetzt nickt, weiß er: Er hat etwas falsch gemacht. Die Frage auf Seite 163, "was soll ich daran sagen", bleibt ihm im Halse stecken - denn natürlich hat er sich verlesen: was soll ich dazu sagen? So akklamiert er womöglich übereilt der Einzelzeile auf der letzten Seite: "so! jetzt reicht es nicht."
Aber reicht es denn wirklich? Es sind ja geläufige Übungen der Einschüchterung, die der auch nur halb gewitzte Leser sofort pariert. Sie gehören zur bekannten Modernitätsfalle. Das Publikum, ohnehin gesättigt und oberflächenfixiert, ist bereit, jede kokette ästhetische Ambition unbeeindruckt zu konzedieren. Die Kritik übrigens nicht minder. Sie nimmt die Frechheit für Könnerschaft.
Aber zumindest Kennerschaft darf man Lentz zubilligen. Er kennt die Tradition der Experimentellen und Konkreten, er hat sie studiert. Vielleicht bis zum Überdruß. Er weiß, was sie gemacht haben. Und macht es noch mal, wenn es ihm paßt. Er ist dekorativ wie Gomringer, verbissen wie Heißenbüttel, anagrammatisch wie Pastior, verjuxt wie Jandl. Das heißt: Er ist alles und nichts. Er verläßt im nächsten Text, was der vorige noch demonstriert hat. Er ist so frei. Aber nicht mehr. Er nimmt sich Pounds Losung zum Motto: "Hier graben". Aber was er ausgräbt, sind alte Hüte. Die schwenkt er lustig in der Luft. Und fragt: Kennt ihr den?
Kennt ihr die Sache mit dem Sonett, das nur aus seinem Reimschema besteht - abba und so? Oder aus der Wiederholung des Wortes Sonett? Vierzehnmal "sonett" - kennen wir, sagen wir. Haben wir schon bei Jandl gesehen. - Aber ich habe das Wort "sonett" durchgestrichen! Also sonett. Und außerdem eine Anmerkung geschrieben: Siehe Jandl. Da staunt ihr, was?
Ja, da staunen wir. Aber wir staunen nicht so oft und so sehr, wie es für den Genuß der meisten Texte nötig wäre. In der ersten Abteilung "Reim und Schlamm" finden wir vom Versprochenen immerhin einiges, nämlich Reim und Schlamm in zuträglicher Mischung. Hier gibt Lentz sich als Bruder Lustig, der ein Lachprogramm aufstellt. Er macht sich 'ne Liste: "mit was einfällt und doch standhält / denn das biste". Und was ist Lentz, der Poet? "ein lachsack tränenreich / ein blech so butterweich / eine bunte lampe / und auch mal bitterpampe . . .". Man könnte es durchaus weiterzitieren - dieses heiter-witzige Selbstbild, das sich freilich in den meisten Stücken des Bandes nicht herstellt.
Was ihm sonst einfällt, ist ein Mix bekannter Zutaten, darin Mörikes "Tännlein" zu "zündholz und mayröcker" kommt: Dazwischen "klirrts" wie bei Hölderlin - aber nicht zu sehr, denn winterlich ist durchgestrichen. Einiges eignet sich fürs Kinderbuch: "ohne ,b' wird aus der beule / eine wunderschöne eule." Aber ohne ,t' wird aus Lentz kein Frühling. Wie auch immer. Hier gilt Brechts Ansicht, Lyriker sollten keine Ärmel tragen, damit sie keine Verse aus ihnen schütteln können.
Einmal zumindest hat Michael Lentz die Ärmel enorm aufgekrempelt. Nämlich in seinem über neun Seiten reichenden Anagrammgedicht auf Dieter Schnebel. Diesen Text hat keiner der bisherigen Rezensenten loben wollen. Ich tue es. Zwar heißt es dort: "Redest ein Blech, / bricht es Elende / beeilend rechts, / berieselnd echt, / reitendes Blech, / Blech redest nie." Doch hier ist die Selbstdenunziation mehr als ein ironischer Gag. Hier hat das Anagramm etwas von seiner ursprünglichen religiösen Potenz, die zu dem Werk des angesprochenen Komponisten paßt. Der Schluß wird zu einem furiosen Sprachkonzert, in dem das große Blech den Ton angibt. Ein Sprechstück, das man vom Sprechkünstler Lentz wohl gern hören würde.
Michael Lentz: "Aller Ding". Gedichte. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2003. 192 S., geb., 19,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Rezensent Harald Hartung verreißt das Buch des Bachmann-Preisträgers mit aller Entschiedenheit. Der zweihundert Seiten starke Band sei in Wahrheit ein mageres Buch, ein "Fake der Fülle", wo eine Seite oft nur mit ein, zwei Zeilen bedruckt sei und sein Autor die Spiele der konkreten Poesie nachspiele. Mager auch deshalb, weil es den Leser daran hindern wolle, die Leere seiner Texte leer zu nennen, und sie stattdessen durch Ironie zu korrumpieren versuche. Eine "Modernitätsfalle" habe Lentz aufgestellt, der darauf spekuliere, dass der Leser "Frechheit für Könnerschaft" nehme. Nur einmal hat der junge Dichter nach Ansicht des alten "die Ärmel enorm hochgekrempelt", und zwar in einem über neun Seiten reichenden Anagrammgedicht auf Dieter Schnebel.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH