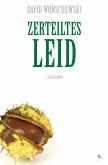Judith Hermann hat einen Roman geschrieben über die Zumutungen der Liebe und die Schutzlosigkeit im Leben.
Stella und Jason sind verheiratet, sie haben eine Tochter, Ava, sie leben in einem Haus am Rand der Stadt. Ein schönes, einfaches Haus, ein kleiner Garten, ein alltägliches ruhiges Leben, meist ohne Jason, der viel arbeitet.
Aber eines Tages steht ein Mann vor der Tür dieses Hauses, ein Fremder, jemand, den Stella nie zuvor gesehen hat. Er sagt, er wolle sich einfach einmal mit ihr unterhalten, mehr sagt er nicht. Stella lehnt das ab. Der Fremde geht und kommt am nächsten Tag wieder, er kommt auch am Tag darauf wieder, er wird sie nicht mehr in Ruhe lassen. Was hier beginnt, ist ein Albtraum, der langsam, aber unbeirrbar eskaliert.
In einer klaren, schonungslosen Sprache und irritierend schönen Bildern erzählt Judith Hermann vom Rätsel des Anfangs und Fortgangs der Liebe, vom Einsturz eines sicher geglaubten Lebens.
Stella und Jason sind verheiratet, sie haben eine Tochter, Ava, sie leben in einem Haus am Rand der Stadt. Ein schönes, einfaches Haus, ein kleiner Garten, ein alltägliches ruhiges Leben, meist ohne Jason, der viel arbeitet.
Aber eines Tages steht ein Mann vor der Tür dieses Hauses, ein Fremder, jemand, den Stella nie zuvor gesehen hat. Er sagt, er wolle sich einfach einmal mit ihr unterhalten, mehr sagt er nicht. Stella lehnt das ab. Der Fremde geht und kommt am nächsten Tag wieder, er kommt auch am Tag darauf wieder, er wird sie nicht mehr in Ruhe lassen. Was hier beginnt, ist ein Albtraum, der langsam, aber unbeirrbar eskaliert.
In einer klaren, schonungslosen Sprache und irritierend schönen Bildern erzählt Judith Hermann vom Rätsel des Anfangs und Fortgangs der Liebe, vom Einsturz eines sicher geglaubten Lebens.
Perlentaucher-Notiz zur TAZ-Rezension
Eines ist Rezensent Florian Kessler klar: Judith Hermanns erster Roman "Aller Liebe Anfang" wird ein Bestseller. Daran hat der Kritiker eigentlich erstmal nichts auszusetzen, denn "kunstvoll" findet er die Geschichte um eine mittels Stalker-Fantasie dem eigenen "saftlosen Sehnsuchtsleben" entfliehende arbeitende Mutter allemal. Angenehm überrascht stellt Kessler auch fest, es hier einmal nicht mit einem das eigene nichtige "Privatheitsporzellan" aufbauschenden Vertreter der "Bauchnabelgeneration" zu tun habe, sondern mit einer Sterbebegleiterin, die dann allerdings doch eher nymphenhaft-melancholisch daherkommt. Goutierend vermerkt der Kritiker auch, dass Hermann hier ein nachhallender, geradezu boshafter Psychothriller gelungen ist; mit der Egozentrik des Romans kann er hingegen nicht viel anfangen. Auch der Erzählperspektive hätte er mehr Stringenz gewünscht, und dass Sterbegleitung, Klimakatastrophen und Kriege zwar angesprochen, aber nicht reflektiert werden, stört den Rezensenten erst recht.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Judith Hermann bevorzugte bisher die kurze Distanz. Schon deshalb gilt ihr erster Roman als Ereignis. Ist das vielleicht sogar der einzige Grund?
Judith Hermann hat zwei Probleme: Sie kann nicht schreiben, und sie hat nichts zu sagen. Das sind denkbar ungünstige Voraussetzungen für eine Position, wie sie ihr immer noch, auch nach ihrem soeben erschienenen ersten Roman "Aller Liebe Anfang" zugestanden wird: die einer der "wichtigsten Stimmen" der jüngeren Literatur, einer "Meisterin" gar. Wenn man nicht schreiben kann, hält man sich am Stoff schadlos, der dann eben etwas außergewöhnlich ausfällt. Und wenn man nichts zu sagen hat, dann macht man das mit seinem Stil wett. So kann man auf die eine oder andere Weise Schriftsteller sein.
Es ist nun durchaus nicht so, dass Judith Hermanns Roman sonderlich gut weggekommen wäre; manche Besprechung ist so lau wie ihre Prosa - sollte das mit dem "Sog" gemeint sein, von dem viele offenbar immer noch glauben, Hermann übe ihn aus? Aber auch wenn es zu einem richtig dicken Lob, das damals für ihre Erzählungen "Sommerhaus, später" (1998) reichlich übertrieben ausfiel, diesmal nicht gereicht hat, so macht die Literaturkritik sich in diesem Fall schon durch bloße Nachsicht verdächtig. Die gelegentlich geäußerte Überlegung, was die Unbestimmtheit ihres Erzählens mit der Lage des Landes zu tun haben mag, kann man sich sparen. Es lohnt sich nicht, über so etwas nachzudenken.
Die in einem vielleicht deutschen, vielleicht auch amerikanischen Vorort angesiedelte Geschichte der siebenunddreißigjährigen, ambulant tätigen Krankenpflegerin Stella, ihres Mannes Jason und ihrer Tochter Ava (nicht "Ada", wie es in einer Besprechung hieß; da wollte wohl jemand Augenhöhe mit Nabokov insinuieren) entspricht von ihrem auf unterschwellige Bedrohung und finale Eskalation setzenden Ablauf her am ehesten noch einem amerikanischen Thriller nach Art von Stephen King. Tatsächlich aber bleibt das Stalking durch den Nachbarn Mister Pfister, dem Stella ausgesetzt ist, bis zum Schluss nicht annähernd so bedrohlich wie behauptet und ist dazu unmotiviert. Mister Pfister, heißt es, als würde das irgendetwas erklären, habe einfach die "Nerven" verloren.
Sollte es Judith Hermanns Absicht gewesen sein, mit ihrer Stalking-Geschichte zu zeigen, dass das Leben schnell aus den Fugen geraten, dass Nachstellen auch Liebe sein kann, wenn auch eher eine krankhafte, und dass die meisten Gefühle und Einstellungen oft zwiespältig sind - dann kann man nur sagen: Ja, davon hat man schon mal gehört. Hermann aber inszeniert ihre Grundidee, dass der Stalker ja nur ein "Spiegel" ist und Stella ihre eigene latente Unzufriedenheit oder Verzweiflung vorhält, dermaßen zäh, dass man sich am Ende sagt: Wenn's weiter nichts ist. Es mag sein, dass Stella immer wieder eine "wilde Sehnsucht" umtreibt, von der ihr Mann nichts wissen darf und die sie am Ende dazu treibt, den Verfolger doch zur Rede zu stellen. Aber diese "wilde Sehnsucht" bleibt Behauptung und war früher im Übrigen etwas für Kitschromane. Jason schlägt Mister Pfister schließlich krankenhausreif. Nach dieser schweren Körperverletzung, die folgenlos bleibt, zieht Stella mit Mann und Kind woandershin. Die Schlussszene kommt einem vor wie die "Du, John-Boy"-Gute-Nacht-Gespräche am Schluss der "Waltons": "Stella, sagt Jason, bist du wach? Sieh mal aus dem Fenster, wenn du kannst. Was würde ich sehen, wenn ich könnte, sagt Stella. Einen unfassbar riesigen orangegelben Halbmond eine Handbreit überm Horizont." Wieso sollte Stella plötzlich nicht mehr aus dem Fenster sehen können? Ist sie jetzt so bettlägerig wie ihre Pflegefälle?
Pflegebedürftig wäre vor Drucklegung auch die Sprache gewesen, und damit kommen wir zum eigentlichen Ärgernis dieses Buches. Judith Hermanns Stil gilt ja als "kunstvoll". Er ist es insofern, als es ihm gelingt, trotz starker, freundlich formuliert: Reduktion beachtliche Redundanz zu erzielen. Für eine Stilistin versteht es sich von selbst, Verben wegzulassen, so gut wie jede Aussage in wörtlicher Rede mindestens einmal zu wiederholen, auf die üblichen Satzzeichen, vor allem Fragezeichen, zu verzichten. Zeitenfolgen und erzählerische Perspektiven gehen zuweilen durcheinander. Ausflüge in die Hypotaxe gibt es nur, wenn es gar nicht anders geht.
Syntaktische Schlichtheit gilt als Judith Hermanns Markenzeichen. Was aber, wenn sich dahinter gedankliche Schlichtheit verbirgt? Oder einfach nur Unvermögen? Passen täte das zu den Allerweltsempfindungen der in ihrem psychologischen Profil absolut unscharf bleibenden Heldin. Sobald es interessant werden könnte, heißt es aber "vielleicht" - eigentlich eine Frechheit gegenüber dem Leser.
Nehmen wir zunächst die Realien: Kann die Polizei einem Stalker ohne richterlichen Beschluss jede Kontaktnahme zu seinem Opfer verbieten? Baut ein Maurer oder Handwerker, der Jason offenbar sein soll, wirklich ein ganzes Haus, oder ist das nicht eher Aufgabe eines Architekten? "Über den Winter", heißt es über eine Nebenfigur, "den der Fahrradmechaniker im Süden verbringt, weil er Frost nicht verträgt, er kommt erst zurück, wenn die Tage wieder länger werden." In der Regel werden sie es ja gerade dann, wenn der Frost am stärksten ist, nämlich vom 21. Dezember an. Dann heißt es, "seine Aura ist ausdruckslos" - gibt es das? "In Stellas Kopf taucht das Wort Drohung auf wie eine Warnung" - das tut es sonst auch. "Am Abend schließt sie die Haustür von innen ab" - das sollte jeder Verfolgte tun. "Der Alkohol ist süß und kräftig" - eine chemische Unmöglichkeit, gemeint ist Likör. Über weite Strecken wirkt die Aufzählung von Dingen und Verrichtungen unmotiviert, zum Verständnis von Handlung und Psychologie tragen sie so gut wie nichts bei. Dieses Erzählen, wird gern behauptet, verfahre "filmisch"; das mag sein. Aber wenn es darum geht, "Bilder" zu entwerfen, sollte man sich mehr Mühe geben.
Und jetzt ein schlimmer Verdacht: Man hat manchmal den Eindruck, Judith Hermann weiß gar nicht, was bestimmte Wörter bedeuten. Deswegen wirkt vieles entweder tautologisch oder schief: "Als sie aus dem Kino kommt, ist der Tag draußen immer noch hell" - das haben Tage so an sich, ein "es" hätte genügt. "Ich hab darüber gelesen, Reaktion bedeutet Kontakt" - wo das wohl steht? "Die Stille am Küchentisch, die Bedeutung von Avas Schlaf, die Beschränkung der Begegnungen auf Jason, Paloma, Dermot, Walter und Esther ist auffällig. Verdächtig, als sollte sie etwas bedeuten." Nur was?
Diese biographische Skizze verrät das Prinzip: Unbeholfenheit, die sich spreizt. "Stella hat eine jähe Ahnung vom Inneren seines Hauses" - hat der Stalker etwas zu verbergen wie Fritzl oder der Entführer von Natascha Kampusch? Kann Stella sich nicht einfach etwas vorstellen? "Staubmäuse" sind so groß wie "Kindsköpfe" - gemeint sind wohl "Kinderköpfe". "Stella sieht irgendwohin" - das tut jeder. So werden laufend Nichtigkeiten aufgebauscht, Triviales macht sich wichtig. Irgendwann kommt einer von den Stadtwerken und liest ab, "als sei es das Normalste der Welt" - ist es das nicht auch?
Aber nur so hat Judith Hermann ihr Buch vollgekriegt, für diese Null-acht-fünfzehn-Geschichte hätte eine Erzählung dicke gereicht. Sei's drum, es ist ja erst ihr erster Roman. Aller Anfang ist schwer.
EDO REENTS
Judith Hermann: "Aller Liebe Anfang". Roman.
Verlag S. Fischer, Frankfurt am Main 2014. 224 S., geb., 19,99 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Prosa, die sich so leise, leicht und klar und vorsichtig liest wie kaum eine andere deutsche Prosa unserer Zeit[...] Volker Weidermann Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung 20140824