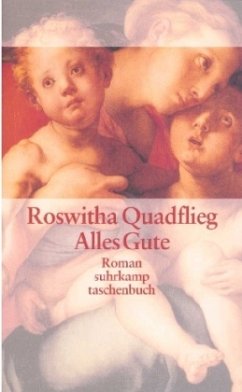Caecilie erfährt, dass ihr Kind bei der Geburt ausgetauscht worden ist. Sie hat auf einmal zwei erwachsene Söhne. Diese entscheiden sich, ihr bisheriges Leben fortzuführen. Dennoch hat sich für Caecilie alles verändert. Sie muss ihre familiären Beziehungen und Gefühle ganz neu definieren.

Lange Leitung: Roswitha Quadflieg erzählt dem Telefon das Leben
Vielleicht hängt es mit der Öffnung des Telefonmarktes zusammen: Manchmal wird mitten im Gespräch das Telefonat unterbrochen. Knackt es dabei nicht laut genug, redet der Teilnehmer und redet, zunehmend forscher, je dürftiger die Resonanz. Schließlich breitet sich peinliche Stille aus, wenn der Sprecher merkt, dass er allein ist. Verschämt drückt er die Wahlwiederholung. Roswitha Quadflieg macht es anders: Die Autorin erhebt die tote Leitung zum Erzählprinzip. Sie lässt die Protagonisten ihres jüngsten Romans von sich reden, obwohl der Ehemann, zu dem sie spricht, schon vor dreiundzwanzig Jahren aufgelegt hat. Er hat sie sitzen lassen, um nach Kalifornien zu gehen. Das hindert sie nicht, ihr Leben vor ihm auszubreiten: "Ja, Ray, so hat sich das damals im Flugzeug abgespielt." - "Du lachst. Ich weiß: ich mit meinen Geschichten." Caecilie erzählt, Ray ist weg, die Leitung tot. Roswitha Quadflieg macht daraus keinen inneren Monolog der Isolation, sondern eine Marotte.
Was zwingt Caecilie zum Reden? Die gescheiterte Ehe muss aufgearbeitet werden, ebenso die Hochzeit des Sohnes, denn "Hochzeiten sind Lebenskrisen". Vor allem aber ist da die Begegnung mit einem jungen Geiger im Flugzeug. Dem hübschen Jungen kleben die regennassen Haare im Gesicht wie einst ihrem Mann im Badezimmer: "Wie oft habe ich dich so gesehen, Ray! Hundertmal. Du kommst aus der Dusche, frottierst dir den Kopf." Die Ähnlichkeit der Ungeföhnten ist so augenscheinlich, dass sie für einen Ehebruch vor achtundzwanzig Jahren spricht. Dieser Verdacht macht Caecilie schwer zu schaffen. Die Fragen an die Vergangenheit - war es Silke, war es Karola, war es Gerlinde? - lassen sie nicht los. Ein "Mühlrad im Kopf" sorgt dafür, dass vergangene Szenen sich mit Gegenwart und Vorausdeutungen verbinden, Vor- und Rückblenden zum ebenso konsequenten Stilprinzip werden wie die monologische Sprechhaltung. Dabei gelten das Mühlrad und die Wiederholungen der Erzählerin als Beleg einer bedenklichen Manie - "ich weiß, Ray, du hältst mich für unnormal oder sonst was" -, der Leser aber kann sich auf ihre gesunde Skepsis gegenüber dem Alkohol - "ich hab's versucht, Ray, aber Alkohol ist kein Mittel gegen Mühlräder im Kopf" - verlassen. An ihr zeigt sich die denkbar unmanische Solidität der Protagonistin.
Durch ebendiese Solidität hat es Caecilie zur erfolgreichen Inhaberin eines Sportartikelladens gebracht, die allein stehend ihren Sohn großzieht und skeptisch auf ihre Achtundsechzigervergangenheit blickt. Sie schüttelt über die Unsitte der sexuellen Befreiung den Kopf, überführt ihre alten Freunde des Antiamerikanismus und beweist an deren Biografien, wie leicht man erst im Terrorismus und dann in der Esoterik landet.
Dort, wo es interessant werden könnte, versagt freilich ihr kritischer Geist. Von einer Terroristin, die Gott Bescheid sagen wollte, dass sie gegen Ausbeutung und Ungerechtigkeit ist, wird erzählt, ohne dass über die religiösen Anteile des Protests weiter nachgedacht würde. Auch dort also, wo sich eine noch nicht zum Klischee geronnene Perspektive andeutet, lässt die Rückkehr zur naiven Selbstkritik nicht lange auf sich warten: "Das musst du dir mal vorstellen - eine Ultralinke fühlt sich verantwortlich vor einem lieben Gott. Ich weiß, ich habe auch keinen Finger gerührt für eine bessere Welt, meine ich jedenfalls. Ich habe an mich, an George und an den Laden gedacht. Das war's? War's das? Machen Sportpaläste wirklich Sinn?"
Da scheint selbst die Frage nach der Herkunft des erfolgreichen Jungmusikers mit dem Gesicht des Gatten interessanter. Wenngleich auch hier nicht besser formuliert wird. Nein, Sportpaläste machen keinen Sinn, Anglizismen keinen Stil. Rays Vergangenheit und die Genealogie bleiben dunkel, Caecilies Nachforschungen ohne Ergebnis, bis sie sich an eine alte Hebamme wendet, die nun ihrerseits zu monologisieren beginnt. Die Leitung ist in diesem Falle nicht gar so tot, denn der Leser darf sich Caecilie als Zuhörerin der Dame im Altersheim vorstellen. Die Hebamme erzählt ein ausführliches Kriegsgenerationenleben, bevor sie zur Auflösung der unerhörten Begebenheit beiträgt: Endlich ist klar, wer wessen Sohn ist und dass es im Leben manchmal recht unverhofft zugeht. Erstens kommt es anders, möchte man sagen, zweitens sieht man zwischen den Zeilen den warnenden Zeigefinger von Max Frisch, sich von Menschen und Umständen nicht zu schnell ein Bild zu machen. Wer, wie Caecilie, sich und andere festzulegen versucht, macht sich am Ende auch beim jungen Geiger unbeliebt. Ja, das sagt er ganz deutlich in seinem Monolog, der nicht nur das noch ausstehende Lebensgefühl der dritten Generation beisteuert, sondern auch die Formel des Romans: Jedes Leben braucht seine eigenen Maßstäbe. Caecilie hat es geahnt: "Vielleicht ist am Ende wirklich nur das wahr, was man für wahr hält." Falls Roswitha Quadflieg vorhatte, mit solchen Sprüchen und ihren erzähltechnischen Bemühungen die Individualisierung und den Perspektivismus der Moderne abzubilden, ist ihr das missglückt.
SANDRA KERSCHBAUMER
Roswitha Quadflieg: "Alles Gute". Roman. Insel Verlag, Frankfurt am Main 1999. 156 S., geb., 34,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main