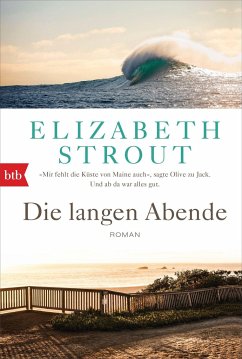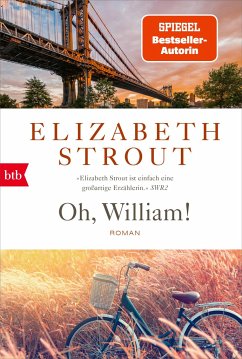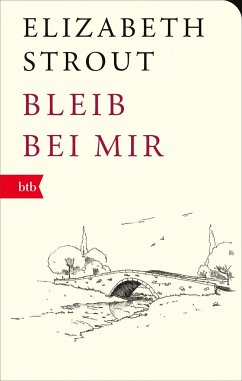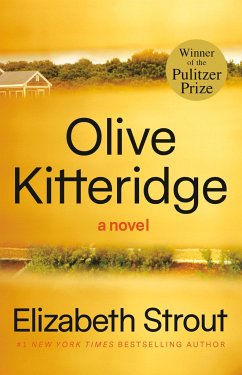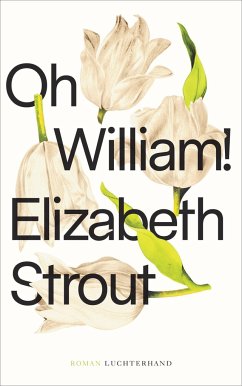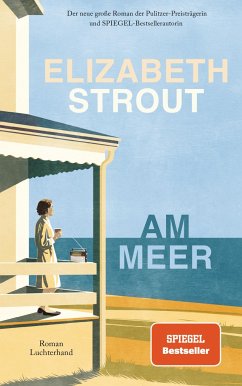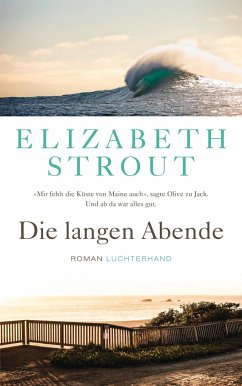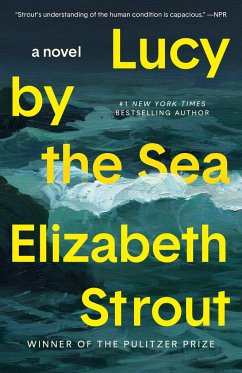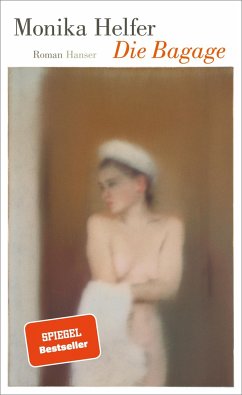Alles ist möglich
Roman
Übersetzung: Roth, Sabine

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Elizabeth Strout erzählt in ihrem international gefeierten Roman unvergessliche Geschichten über die Menschen einer Kleinstadt, die sich nach Liebe und Glück sehnen, aber oft Kummer und Schmerz erleben. Geschichten über die Natur des Menschen in all seiner Verletzlichkeit und Stärke, über die unendliche Vielfältigkeit des Lebens. Da ist der Hausmeister, der einem Außenseiter helfen will und dabei in eine tiefe Glaubenskrise stürzt. Eine erwachsene Frau sehnt sich immer noch wie ein Kind nach der Liebe ihrer Mutter. Und eine erfolgreiche Schriftstellerin kehrt nach siebzehn Jahren zum ...
Elizabeth Strout erzählt in ihrem international gefeierten Roman unvergessliche Geschichten über die Menschen einer Kleinstadt, die sich nach Liebe und Glück sehnen, aber oft Kummer und Schmerz erleben. Geschichten über die Natur des Menschen in all seiner Verletzlichkeit und Stärke, über die unendliche Vielfältigkeit des Lebens. Da ist der Hausmeister, der einem Außenseiter helfen will und dabei in eine tiefe Glaubenskrise stürzt. Eine erwachsene Frau sehnt sich immer noch wie ein Kind nach der Liebe ihrer Mutter. Und eine erfolgreiche Schriftstellerin kehrt nach siebzehn Jahren zum ersten Mal in ihre Heimat zurück, um ihre Geschwister zu besuchen ...