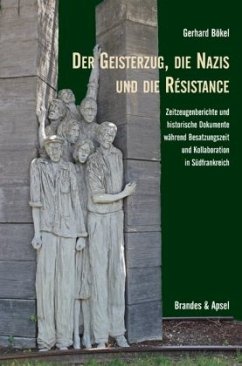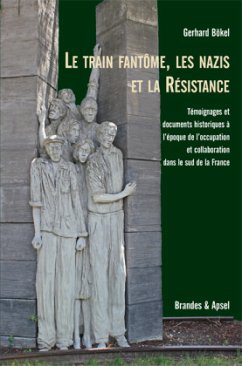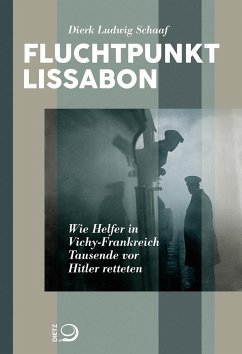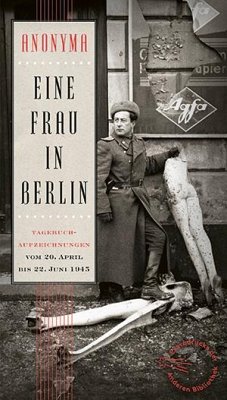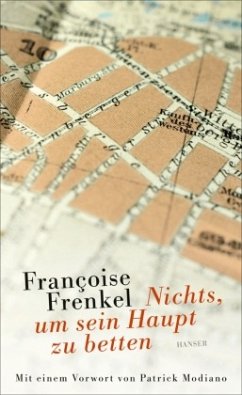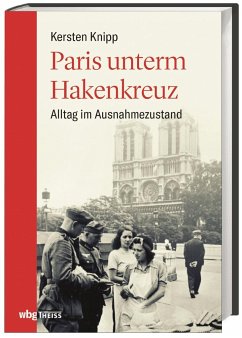Nicht lieferbar
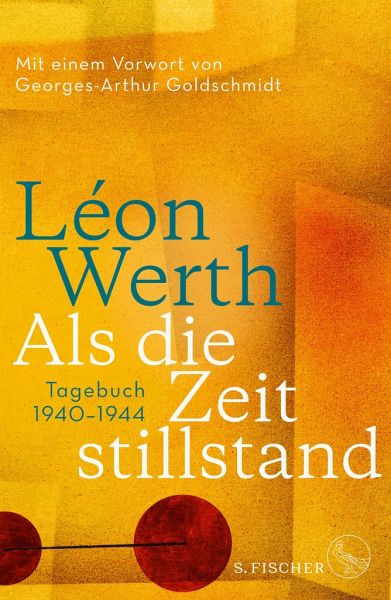
Als die Zeit stillstand
Tagebuch 1940-1944
Übersetzung: Heber-Schärer, Barbara; Scheffel, Tobias
Versandkostenfrei!
Nicht lieferbar
Ein vergessenes Meisterwerk, das es zu entdecken gilt, ein einmaliges Zeitzeugnis: »Als die Zeit stillstand«, das bewegende Tagebuch des großen Schriftstellers und Journalisten Léon Werth aus dem besetzten Frankreich zur Zeit des Vichy-Regimes der Jahre 1940 bis 1944. Im Sommer 1940 besetzen die Deutschen Paris. Der französische Publizist und Kritiker Léon Werth, jüdischer Herkunft, Pazifist und Antikolonialist, flieht und versteckt sich in einem Dorf im Jura. Flüchtlinge und Dorfbewohner leben hier zusammen, begierig auf Nachrichten, abgekapselt und doch ganz nah am Geschehen.Frankrei...
Ein vergessenes Meisterwerk, das es zu entdecken gilt, ein einmaliges Zeitzeugnis: »Als die Zeit stillstand«, das bewegende Tagebuch des großen Schriftstellers und Journalisten Léon Werth aus dem besetzten Frankreich zur Zeit des Vichy-Regimes der Jahre 1940 bis 1944.
Im Sommer 1940 besetzen die Deutschen Paris. Der französische Publizist und Kritiker Léon Werth, jüdischer Herkunft, Pazifist und Antikolonialist, flieht und versteckt sich in einem Dorf im Jura. Flüchtlinge und Dorfbewohner leben hier zusammen, begierig auf Nachrichten, abgekapselt und doch ganz nah am Geschehen.
Frankreich ist im Innersten gespalten, Republik und Demokratie sind bedroht, Nationalisten begrüßen den deutschen Sieg. Léon Werth schildert diesen Kosmos in seinem einzigartigen Tagebuch. Eine Welt zwischen Angst und Hoffnung, in der die Menschen ihren Weg suchen, sich aufgeben, kollaborieren oder an einer Zivilisation festhalten, die zutiefst bedroht ist.
Werths zeitlose Einsichten in menschliches Denken und Handeln in einer verstörenden Zeit sind ein Meisterwerk der Literatur und ein visionäres Vermächtnis.
Mit einem Vorwort von Georges-Arthur Goldschmidt, der herausstreicht, wie aktuell Léon Werths Gedanken immer noch sind: Denn wie damals stellt sich auch heute wieder die Frage, wie man sich als Mensch in einem Land verhalten kann, in dem Freiheit und Demokratie gefährdet sind.
»Ein bewundernswertes historisches Dokument. Ich kenne keines, das wertvoller wäre.«
Lucien Febvre
Im Sommer 1940 besetzen die Deutschen Paris. Der französische Publizist und Kritiker Léon Werth, jüdischer Herkunft, Pazifist und Antikolonialist, flieht und versteckt sich in einem Dorf im Jura. Flüchtlinge und Dorfbewohner leben hier zusammen, begierig auf Nachrichten, abgekapselt und doch ganz nah am Geschehen.
Frankreich ist im Innersten gespalten, Republik und Demokratie sind bedroht, Nationalisten begrüßen den deutschen Sieg. Léon Werth schildert diesen Kosmos in seinem einzigartigen Tagebuch. Eine Welt zwischen Angst und Hoffnung, in der die Menschen ihren Weg suchen, sich aufgeben, kollaborieren oder an einer Zivilisation festhalten, die zutiefst bedroht ist.
Werths zeitlose Einsichten in menschliches Denken und Handeln in einer verstörenden Zeit sind ein Meisterwerk der Literatur und ein visionäres Vermächtnis.
Mit einem Vorwort von Georges-Arthur Goldschmidt, der herausstreicht, wie aktuell Léon Werths Gedanken immer noch sind: Denn wie damals stellt sich auch heute wieder die Frage, wie man sich als Mensch in einem Land verhalten kann, in dem Freiheit und Demokratie gefährdet sind.
»Ein bewundernswertes historisches Dokument. Ich kenne keines, das wertvoller wäre.«
Lucien Febvre