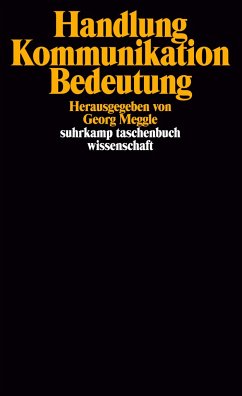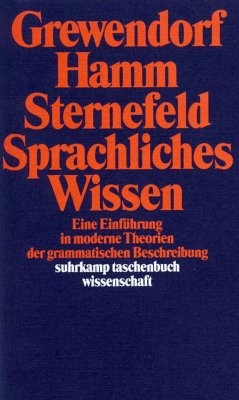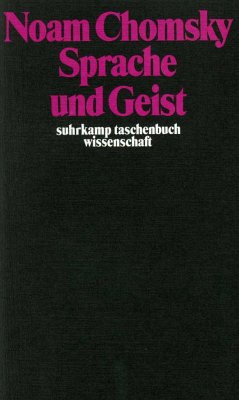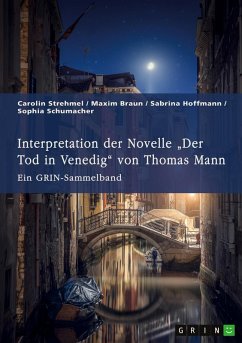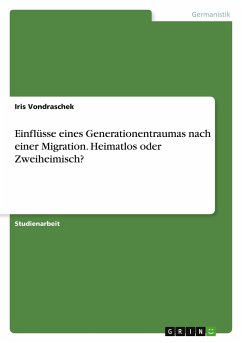Als Freud das Meer sah
Freud und die deutsche Sprache
Übersetzer: Große, Brigitte

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!
Ein wunderbares Buch über die Sprache, die wie der Blutkreislauf unsere Existenz durchzieht. Goldschmidt, der gebildetste und feurigste Vermittler zwischen Frankreich und Deutschland, schreibt auf erstaunliche Weise über das Leben in zwei Sprachen und das Übersetzen. Leidenschaftlich und spannend öffnet er die Bedeutungsräume zwischen den beiden Sprachen, in dem Wissen, dass sich hinter dem Gesagten ungeahnte Kostbarkeiten verbergen.»Ein verblüffendes Buch über die Sprache« Peter von Matt