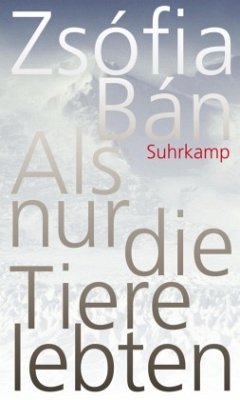Am Strand von Rio de Janeiro wird die kleine Anna im Getümmel von ihrer Mutter getrennt. Als das Mädchen sie nach kurzem albtraumhaften Verlorensein erleichtert am Wasser stehen sieht und sich ihr von hinten nähert, hört sie, wie die Mutter ein verzweifeltes »Sogar hier ... sogar hier!« vor sich hinmurmelt. Was diese Worte bedeuten, vor allem aber wer ihre Mutter war, die sieben Sprachen sprach, aber mit ihrem Kind in keiner einzigen reden konnte, das begreift die Fotografin Anna erst Jahrzehnte später - als sie in einer Versuchsstation in der Antarktis das Naturphänomen des »White-out« aufnimmt, das alles verschluckende Weiß. Und Zsófia Bán ist eine so raffinierte Autorin, dass ihr Text in seinem Verlauf die traumatische Wahrheit eines Lebens allererst zu Tage zu fördert, die Erinnerung sich gleichsam im Augenblick des Erzählens ereignet. Emigration, Entwurzelung, der brutale Riss, der ein Leben in ein Davor und Danach teilt - diese Erfahrungen bilden das Gravitationszentrum derfünfzehn Geschichten des Bandes.
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Es sind vor allem Bilder, die zwischen den einzelnen Erzählungen und Erzählebenen in Zsófia Báns "Als nur die Tiere lebten" einen Zusammenhang herstellen, berichtet Jörg Plath, der sich hier überwiegend an symbolischen Einzelheiten entlang hangelt. Da ist zum Beispiel die Erzählung einer Frau, die im Flugzeug von einem Mann bedrängt wird. Unvermittelt wird die Geschichte eines achtjährigen Jungen eingeflochten, der sich an einem Mädchen vergehen will, aber von seinem Vater erwischt und zur Strafe mit einem Gürtel geprügelt wird - der ihm eine Wunde an ebenjener Stelle zufügt, an der der Mann im Flugzeug eine Narbe hat, so der Rezensent. Ähnliche, weniger offene Verbindungen durchziehen das ganze Buch, verrät Plath, der vermutet, dass eine gewisse Kenntnis poststrukturalistischer Theorien das Aufdecken der doppelten und dreifachen Böden erleichtert, unbedingt notwendig sind sie aber nicht, beruhigt der Rezensent.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH

Bilder, so einschneidend wie Messerklingen: Zsófia Báns "Als nur die Tiere lebten"
Zsófia Bán hat ein Buch über die entscheidenden Augenblicke des Lebens geschrieben, in fünfzehn Erzählungen. "Als nur die Tiere lebten" handelt vom Geborenwerden und vom Sterben, vom Auswandern und vom Heimkehren. Die Geschichten spielen in Ungarn und Südamerika, größtenteils im zwanzigsten Jahrhundert, soweit man das an Ereignissen am Rande, wie etwa dem Zusammenbruch des Ostblocks, festmachen kann. Sie erzählen von Zerrissenheit, ständig ist jemand unterwegs, ständig ist jemand verloren oder gar traumatisiert.
"Glaube immer dem ersten Eindruck", schreibt Bán in einer der Geschichten, "der Rest ist Schmetterlingsfett." Der erste Eindruck von ihrem Buch ist, dass es sich um eine Sammlung sonderbarer Kurzgeschichten handelt, in langen Sätzen verfasst, reich an Details (ein Beispiel: In Brasilien muss man an einer durch den ganzen Bus gespannten Plastikschnur ziehen, wenn man aussteigen will) und unverbrauchten Vergleichen ("als würde man die Toilette spülen"). Die meisten Geschichten sind durch das Bewusstsein einer Figur gefiltert, so dass der Leser sich alle zehn bis zwanzig Seiten in eine neue Perspektive einfinden muss. Irgendwann geht einem davon ein wenig die Luft aus, dann wird es schwer, die dichte Sprache entlang der feinen Linie zwischen Prosa und Poesie in ihrer ganzen Fülle aufzunehmen.
Vielleicht ist es besser, immer nur eine Geschichte zu lesen, am besten laut, und es zu genießen, wenn sich die schwarzen Buchstaben von den weißen Seiten heben und Bilder in die Luft malen. Darum geht es ja vor allem: um Bilder.
Das Buch eröffnet mit der wohl seltsamsten und erotischsten Geschichte, die jemals über die Entdeckung des Röntgenbildes geschrieben wurde. Es schließt mit einer um ihre Mutter trauernden Fotografin, die in der Antarktis ein "White-out" aufnimmt. Dazwischen erzählt Bán Momentaufnahmen der großen und kleinen Augenblicke des Lebens und jener, die zunächst klein erscheinen und erst retrospektiv an Bedeutung gewinnen. "Ein Bild ist", schreibt die Autorin in "Kurze Geschichte der Fotografie", "dass Patty Hearst mit einer Maschinenpistole in einer Hand in der Bank steht, und man sieht ihr an, dass sie auf einmal ganz verlassen ist, ... denn ein Bild ist so, dass es dich verrät. Er ersticht dich mit dem Küchenmesser, während du die Hand nach der Zwiebel ausstreckst." Auch das ist ein Bild.
Eigentlich könnte das ganze Buch "Kurze Geschichte der Fotografie" heißen oder besser noch: "Kurze Geschichte der Fotografie und des Wassers". Wasser nämlich, das "unsicherste Element", wie Zsófia Bán es nennt, rinnt durch alle Geschichten, selbst dann, wenn es um etwas ganz anderes geht, etwa um die Einreise nach Brasilien zur Zeit der Diktatur: "Bem vinda no Brasil, sagte er mit einer von ungezählt vielen Zigarren rauhen Stimme und nickte dazu militärisch mit dem Kopf, auf seinem glänzend brillantinierten Haar hätte man surfen können." Es ist das Wasser, das die disparaten Bilder verbindet.
Zum Ende hin gewinnt man den Eindruck, dass die Geschichten doch alle zusammenhängen, an seidenen, fast unsichtbaren Fäden. Terike, Margó, Marcsi - man hat das Gefühl, diese Namen schon einmal gelesen zu haben. Zsófia Bán weiß auch damit umzugehen. "Wo ist der Zusammenhang?", lässt sie eine der Figuren fragen, gerade als der Leser die fast unsichtbaren Fäden dann doch erkannt hat. "Welcher Zusammenhang, du Bekloppte?", antwortet eine andere. "So eine ungeduldige Bande! Soll ich euch die Brücke machen, damit es sofort einen Zusammenhang gibt?!" Auf die große Brücke, die sofort Verbindungen herstellt, verzichtet Bán, erst beim zweiten Hinschauen, beim genaueren Lesen bemerkt man, dass es sich bei ihren Erzählungen nicht nur um zufällige Schnappschüsse handelt, sondern um das Fotoalbum einer Familie im zwanzigsten Jahrhundert. Vielleicht ist das Schmetterlingsfett, aber es gibt dem Werk noch einmal eine neue Dimension.
"Als nur die Tiere lebten" ist ein Buch voll Leidenschaft und voll Tragik. Es ist ein Buch über das menschliche Fleisch - "am längsten erinnert sich das Fleisch", heißt es in einer Geschichte -, aber mindestens genauso sehr über die menschliche Seele, ihre Abgründe und ihre Fähigkeit, trotz der Zerrissenheit irgendwie klarzukommen mit diesem Leben.
MARIA-XENIA HARDT
Zsófia Bán: "Als nur die
Tiere lebten". Roman.
Aus dem Ungarischen von
Terézia Mora. Suhrkamp
Verlag, Berlin 2014. 205 S., geb., 22,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
»Es ist dieses unablässige Ringen zwischen starker Empathie und kühnem Konstruktionswillen, das Zsófia Báns Erzählen strukturiert und auf äußerst reizvolle und sehr spannende Weise Sinn schafft, in dem, staunenswert genug, auch Katastrophen Platz finden.« Jörg Plath Neue Zürcher Zeitung 20140626