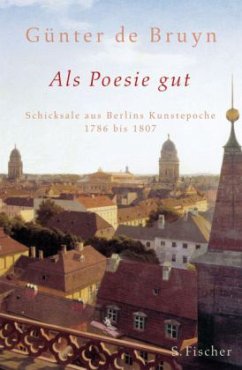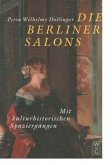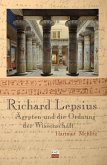Berlin in den Jahren um 1800. Zwischen Schloß und Charité, Münzstraße und Köllnischem Fischmarkt erlebt der Leser die Schicksale der Schadow und Schinkel, der Tieck, Clausewitz, Kleist und Zelter. Er blickt in die Salons der Henriette Herz und der Rahel Levin und wird mit den Liebes- und Kriegsabenteuern des Prinzen Louis Ferdinand vertraut.

Aus Preußens Kunstepoche: Günter de Bruyns Lebensprojekt
Seit im Jahr 1979 Günter de Bruyns Roman "Märkische Forschungen" erschien, kann sich derjenige, der sich mit der Erforschung mittlerer und kleinerer Literaten vergangener Zeiten beschäftigt, auf zwei Modelle berufen: "Pötsch" und "Menzel", zwei Figuren, die sich bei de Bruyn hingebungsvoll einem jener unzähligen vergessenen Autoren widmen, die um das Jahr 1800 in Deutschland publizierten. Menzel ist der arrivierte Akademiker, der für das gebildete Publikum der DDR einen neuen "deutschen Jakobiner" entdeckt und der an dem ominösen Dichter Max von Schwedenow einzig jene Züge hervorhebt, die diese Zuschreibung rechtfertigen.
"Von dieser Systematik, dieser Konsequenz, von diesem Blick aufs Allgemeine auch, mit dem man große Aufgaben sieht, um sie in seinem Einzelgebiet zu erfüllen, war bei Ernst Pötsch die Rede nicht. Denn Pötsch liebte, was ihm nah war, und nahm es dadurch in Besitz, daß er es so genau wie möglich kennenlernte. Stand Menzel gleichsam auf einem Aussichtsturm und schaute durch ein Fernglas in die Weite, so Pötsch mit Lupe auf platter Erde, wo jede Hecke ihm den Blick verstellte. Sein Wissen war begrenzt, doch innerhalb der Grenzen universal." Wie und aus welchen Motiven einer eine versunkene Zeit und deren Akteure studiert, ist das Thema des Romans, und natürlich kannte de Bruyn, der Jean-Paul-Biograph und Mitherausgeber der Reihe "Märkischer Dichtergarten", eine Fülle solcher Motive. Die Sympathie des Autors gehört eindeutig dem redlichen Pötsch, und trotzdem wird man in Günter de Bruyns Arbeiten zur Literatur keineswegs eine lokalgeschichtlich motivierte Froschperspektive finden.
Nun ist, pünktlich zum heutigen achtzigsten Geburtstag des Autors, ein Buch erschienen, das wie eine späte Antwort auf die Grundfrage der "Märkischen Forschungen" erscheint, auch wenn es dabei um sehr viel mehr geht. Es trägt den Titel "Als Poesie gut" (nach einem mißglückten Bonmot von Friedrich Wilhelm III.) und den bescheidenen Untertitel "Schicksale aus Berlins Kunstepoche 1786 bis 1807", einer Zeit also, die durch den Tod Friedrichs des Großen und den Beginn der preußischen Reformen begrenzt wird. Was Macht und Einfluß, was militärische Erfolge angeht, ist das eine vom Niedergang gezeichnete Periode in der preußischen Geschichte, während Frankreichs Gewicht in Europa unaufhörlich wächst. Gleichzeitig ist es die hohe Zeit der literarischen Romantik, der Schadow, Tieck, Varnhagen und Schlegel, und weil sich de Bruyn fast ein ganzes Schriftstellerleben lang immer wieder mit ihnen beschäftigt hat, kommt dieses Buch, was seinen Inhalt angeht, nicht unerwartet: Natürlich finden wir die Königin Luise dargestellt; die Straße Unter den Linden mit ihren Gebäuden und Kreuzungen bildet einen gewichtigen Schauplatz; und der reizende Sandpoet Schmidt von Werneuchen darf ebensowenig fehlen wie Jean Paul oder Fouqué.
Die These dieses Werks muß man nicht teilen, aber de Bruyn führt gute Argumente an: Berlin habe sich in jenen Jahren "zu einem geistigen Zentrum" entwickelt, "das dem in Weimar gleichwertig und ihm vielfach verbunden war". Überraschend aber ist die Form des Buches. Es versammelt 49 Kapitel, die jeweils für sich allein stehen könnten, Miniaturen, die ein Schlaglicht auf ein Leben oder auch nur einen Moment darin werfen, die Freundschaften und Grabenkämpfe am Beispiel einiger weniger Figuren anschaulich machen und dabei die größeren Zusammenhänge nicht vergessen. Manches davon ist durchaus bekannt, zumal dem Leser de Bruyns, aber alles wirkt frisch, immer wieder frappieren Verbindungen und feine Bezüge, die man nun wirklich nicht erwartet hätte. Bekanntere Gestalten wie Nicolai, Moritz oder Henriette Herz stehen neben anderen wie dem vergessenen Verleger Johann Daniel Sander, den August Lafontaines Romane reich machten und der Salon seiner Frau unglücklich. Die liebevoll ausgemalten Kleinbiographien wird man um so interessanter finden, je offenkundiger sie von de Bruyn in einen jeweils anders begründeten Zusammenhang gebracht werden.
Vollends zum literarischen Ereignis wird der Band durch de Bruyns Prosa, einen Duktus, der weder neu noch vertraut, weder verplaudert noch verkopft wirkt und Seriosität mit Leichtigkeit verbindet. Jeder Kapitelanfang birgt in sich schon den Keim, der sich auf den nächsten Seiten entfalten soll, es sind geschliffene Sätze, die viel versprechen und noch mehr einlösen: "Als am 28. Oktober 1806 die Reste der vom Fürsten Hohenlohe-Ingelfingen kommandierten Armee vor einem weitaus schwächeren Gegner in der Gegend um Prenzlau kapitulierten, endete für den Obristen von Massenbach die militärische Karriere, und es begann seine schriftstellerische, die, weil sie in erster Linie der Rechtfertigung seiner militärischen Entscheidungen diente, mit der ersten eng verbunden war." Der Bogen dieses ersten Satzes, die Verknüpfung von Versagen (der anderen) und Rechtfertigung (der eigenen Person) durch die Erwähnung des "weitaus schwächeren Gegners", das Beispiel schließlich, das Massenbachs Schicksal für andere schreibende Militärs abgibt, all dies führt wie selbstverständlich ins Kapitel, und im derzeit so beliebten literarischen Genre des erzählten Sachbuchs ist dieses stilbewußte Werk damit tatsächlich beinahe ein Solitär.
Und wie steht es mit der Entscheidung für Pötsch oder Menzel, Frosch oder Adler? De Bruyn entzieht sich ihr elegant, indem er beide Perspektiven miteinander versöhnt. Er malt die Details und verknüpft sie, er gruppiert seine Miniaturen zu einem Bild, dem so weder die großen Züge fehlen noch die Tiefenschärfe. Es ist so gleichermaßen gefeit vor Menzels Parteinahme wie vor der Kurzsichtigkeit eines Pötsch.
TILMAN SPRECKELSEN
Günter de Bruyn: "Als Poesie gut". Schicksale aus Berlins Kunstepoche 1786 bis 1807. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2006. 523 S., geb., 24,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Zum 80. Geburtstag Günter de Bruyns erscheint dieses Buch über das literarische Berlin zwischen 1786 und 1807, das in seinem Interessensschwerpunkt nicht überraschend, dessen Grundthese zumindest angreifbar und das in seiner Form ungewöhnlich ist, meint ein sehr wohlwollender Tilman Spreckelsen. Bruyn, der sich schon immer intensiv mit der Romantik beschäftigt hat, macht sich dafür stark, dass Berlin im untersuchten Zeitraum ein dem berühmteren Weimar ebenbürtiges Kunstzentrum darstellte, erklärt der Rezensent, der offen lässt, ob er diese Einschätzung teilt. Er hebt die ungewöhnliche Form des Buches hervor, das in 49 Kapiteln, die problemlos für sich stehen könnten, Kurzbiografien und Einzelereignisse bietet und dabei dennoch den übergeordneten Zusammenhang nicht vergisst. Spreckelsen preist nicht nur die immer wieder überraschenden Verbindungen, die sich aus den Miniaturen ergeben, sondern ist auch von der stilistischen Form des Bandes vollkommen hingerissen.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH