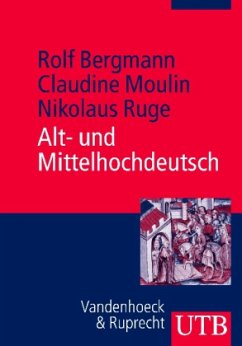Rolf Bergmann, Claudine Moulin, Nikolaus Ruge
Alt- und Mittelhochdeutsch
Arbeitsbuch zur Grammatik der älteren deutschen Sprachstufen und zur deutschen Sprachgeschichte. Inkl. Download
Rolf Bergmann, Claudine Moulin, Nikolaus Ruge
Alt- und Mittelhochdeutsch
Arbeitsbuch zur Grammatik der älteren deutschen Sprachstufen und zur deutschen Sprachgeschichte. Inkl. Download
- Broschiertes Buch
- Merkliste
- Auf die Merkliste
- Bewerten Bewerten
- Teilen
- Produkt teilen
- Produkterinnerung
- Produkterinnerung
Ein Klassiker des Germanistik-Studiums liegt jetzt völlig neu überarbeitet und für das Bachelor-Studium optimiert vor. Anhand ausgewählter historischer Texte erklärt das Buch die grammatischen Besonderheiten des Alt- und Mittelhochdeutschen sowohl diachron als auch an synchronen Schnitten. Es ist modular und dynamisch aufgebaut und setzt kaum Vorkenntnisse voraus.
Ein E-Learning-Tool mit Übungsaufgaben ist als Smartphone-App für 4,49 EUR oder als Download für 9,99 EUR erhältlich und stellt die Beschäftigung mit den älteren Sprachstufen des Deutschen auch im Selbststudium auf eine neue Basis.…mehr
Ein Klassiker des Germanistik-Studiums liegt jetzt völlig neu überarbeitet und für das Bachelor-Studium optimiert vor. Anhand ausgewählter historischer Texte erklärt das Buch die grammatischen Besonderheiten des Alt- und Mittelhochdeutschen sowohl diachron als auch an synchronen Schnitten. Es ist modular und dynamisch aufgebaut und setzt kaum Vorkenntnisse voraus.
Ein E-Learning-Tool mit Übungsaufgaben ist als Smartphone-App für 4,49 EUR oder als Download für 9,99 EUR erhältlich und stellt die Beschäftigung mit den älteren Sprachstufen des Deutschen auch im Selbststudium auf eine neue Basis.
Ein E-Learning-Tool mit Übungsaufgaben ist als Smartphone-App für 4,49 EUR oder als Download für 9,99 EUR erhältlich und stellt die Beschäftigung mit den älteren Sprachstufen des Deutschen auch im Selbststudium auf eine neue Basis.
Produktdetails
- Produktdetails
- UTB Uni-Taschenbücher Bd.3534
- Verlag: UTB / Vandenhoeck & Ruprecht
- 8., neu bearb. Aufl.
- Seitenzahl: 249
- Erscheinungstermin: 10. Oktober 2011
- Deutsch
- Abmessung: 215mm
- Gewicht: 382g
- ISBN-13: 9783825235345
- ISBN-10: 3825235343
- Artikelnr.: 33412327
- Herstellerkennzeichnung Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.
- UTB Uni-Taschenbücher Bd.3534
- Verlag: UTB / Vandenhoeck & Ruprecht
- 8., neu bearb. Aufl.
- Seitenzahl: 249
- Erscheinungstermin: 10. Oktober 2011
- Deutsch
- Abmessung: 215mm
- Gewicht: 382g
- ISBN-13: 9783825235345
- ISBN-10: 3825235343
- Artikelnr.: 33412327
- Herstellerkennzeichnung Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.
Prof. Dr. Rolf Bergmann lehrte bis zu seiner Emeritierung 2005 Linguistik des Deutschen in Bamberg.
Abkürzungen 8
Siglen 9
Einleitung 11
1. Sprachgeschichtliche Grundlagen 19
1.1 Deutsch - Germanisch - Indogermanisch 19
1.1.1 Die Sprachstufen des Deutschen 19
1.1.2 Germanisch 20
1.1.3 Die altgermanischen Dialekte 21
1.1.4 Gemeingermanisch - Urgermanisch 23
1.1.5 Indogermanische Sprachverwandtschaft 23
1.1.6 Die indogermanischen Sprachen im Überblick 25
1.1.7 Die Sprachen Europas im Überblick 26
1.2 Erbwort - Lehnwort 27
1.2.1 Etymologie eines Erbwortes 27
1.2.2 Lehnwort und Fremdwort 28
1.2.3 Etymologie eines Lehnwortes 29
1.2.4 Historische Lehnwortschichten 29
1.2.5 Die Wochentagsnamen im Deutschen: Etymologie und Sprachgeographie 30
1.3 Vielfalt des Althochdeutschen 34
1.3.1 Grenzen und Gliederung des Althochdeutschen 34
1.3.2 Ostfränkisch im 2. Viertel des 9. Jahrhunderts 35
1.3.3 Rheinfränkisch am Ende des 9. Jahrhunderts 35
1.3.4 Bairisches Spätalthochdeutsch 36
1.3.5 Schriftlichkeit im frühen Mittelalter 37
1.3.6 Althochdeutsche Schriftlichkeit. Überlieferungsformen und Überlieferungsinhalte 39
1.4 Varianz des Mittelhochdeutschen 43
1.4.1 Das Normalmittelhochdeutsche der Textausgaben 43
1.4.2 Mittelhochdeutsche Klassik und zeitliche Vielfalt des Mittelhochdeutschen 47
1.4.3 Die 'mittelhochdeutsche Dichtersprache' 48
1.4.4 Textsorten des Mittelhochdeutschen 48
2. Einführung in die historische Phonologie 51
2.1 Konsonantismus 51
2.1.1 Die 1. Lautverschiebung und der grammatische Wechsel 52
2.1.2 Germanische Entwicklungen 59
2.1.3 Die 2. Lautverschiebung 63
2.1.4 Vom Althochdeutschen zum Mittelhochdeutschen 68
2.2 Vokalismus 70
2.2.1 Vom Indogermanischen zum Germanischen 70
2.2.2 Vom Germanischen zum Althochdeutschen 72
2.2.3 Vom Althochdeutschen zum Mittelhochdeutschen 74
2.2.4 Die Struktur der Ablautreihen 77
2.2.5 Vom Mittelhochdeutschen zum Frühneuhochdeutschen 80
3. Einführung in die althochdeutsche Flexionsmorphologie 85
3.1 Das Verb 85
3.1.1 Starke Verben 85
3.1.2 Schwache Verben 94
3.1.3 Präterito-Präsentien 99
3.1.4 Besondere Verben 104
3.2 Die Nomina 105
3.2.1 Substantive 105
3.2.2 Pronomen 114
3.2.3 Adjektive 116
4. Einführung in die mittelhochdeutsche Flexionsmorphologie 122
4.1 Das Verb 122
4.1.1 Starke Verben 122
4.1.2 Schwache Verben 134
4.1.3 Präterito-Präsentien 139
4.1.4 Besondere Verben 144
4.2 Die Nomina 145
4.2.1 Substantive 145
4.2.2 Pronomen 151
4.2.3 Adjektive 154
5. Einführung in die Syntax des Mittelhochdeutschen 159
5.1 Methodische Vorbemerkung 159
5.2 Die Entwicklung der deutschen Klammersyntax 160
5.3 Die Satznegation 165
6. Einführung in die Textphilologie 170
6.1 Schreibung und Aussprache 170
6.1.1 Althochdeutsch 170
6.1.2 Mittelhochdeutsch 173
6.2 Texterschließung mit Wörterbuch und Grammatik 174
6.2.1 Althochdeutsch 174
6.2.2 Mittelhochdeutsch 177
6.3 Digitale Angebote zum Alt- und Mittelhochdeutschen 180
6.3.1 Grundsätzliches 180
6.3.2 Zentrale Portale 181
6.3.3 Fachspezifische Angebote (exemplarisch) 182
7. Textauswahl 189
7.1 Althochdeutsche Texte 189
7.1.1 Tatian 34,6 189
7.1.2 Tatian 87,1-5 189
7.1.3 Otfrid von Weißenburg, Evangelienbuch, IV, 32,1-33,16 191
7.1.4 Ludwigslied 192
7.1.5 Psalm 138 194
7.2 Mittelhochdeutsche Texte 195
7.2.1 Nibelungenlied, 975-992 195
7.2.2 Nibelungenlied, 2037-2042 197
7.2.3 Berthold von Regensburg, I. Daz etelîche jehent: tuo daz guote und lâ daz übele 198
7.2.4 Berthold von Regensburg, XV. Von den fremeden sünden 199
Tabellen und Übersichten 201
Glossar 229
Literatur 240
Register 244
Siglen 9
Einleitung 11
1. Sprachgeschichtliche Grundlagen 19
1.1 Deutsch - Germanisch - Indogermanisch 19
1.1.1 Die Sprachstufen des Deutschen 19
1.1.2 Germanisch 20
1.1.3 Die altgermanischen Dialekte 21
1.1.4 Gemeingermanisch - Urgermanisch 23
1.1.5 Indogermanische Sprachverwandtschaft 23
1.1.6 Die indogermanischen Sprachen im Überblick 25
1.1.7 Die Sprachen Europas im Überblick 26
1.2 Erbwort - Lehnwort 27
1.2.1 Etymologie eines Erbwortes 27
1.2.2 Lehnwort und Fremdwort 28
1.2.3 Etymologie eines Lehnwortes 29
1.2.4 Historische Lehnwortschichten 29
1.2.5 Die Wochentagsnamen im Deutschen: Etymologie und Sprachgeographie 30
1.3 Vielfalt des Althochdeutschen 34
1.3.1 Grenzen und Gliederung des Althochdeutschen 34
1.3.2 Ostfränkisch im 2. Viertel des 9. Jahrhunderts 35
1.3.3 Rheinfränkisch am Ende des 9. Jahrhunderts 35
1.3.4 Bairisches Spätalthochdeutsch 36
1.3.5 Schriftlichkeit im frühen Mittelalter 37
1.3.6 Althochdeutsche Schriftlichkeit. Überlieferungsformen und Überlieferungsinhalte 39
1.4 Varianz des Mittelhochdeutschen 43
1.4.1 Das Normalmittelhochdeutsche der Textausgaben 43
1.4.2 Mittelhochdeutsche Klassik und zeitliche Vielfalt des Mittelhochdeutschen 47
1.4.3 Die 'mittelhochdeutsche Dichtersprache' 48
1.4.4 Textsorten des Mittelhochdeutschen 48
2. Einführung in die historische Phonologie 51
2.1 Konsonantismus 51
2.1.1 Die 1. Lautverschiebung und der grammatische Wechsel 52
2.1.2 Germanische Entwicklungen 59
2.1.3 Die 2. Lautverschiebung 63
2.1.4 Vom Althochdeutschen zum Mittelhochdeutschen 68
2.2 Vokalismus 70
2.2.1 Vom Indogermanischen zum Germanischen 70
2.2.2 Vom Germanischen zum Althochdeutschen 72
2.2.3 Vom Althochdeutschen zum Mittelhochdeutschen 74
2.2.4 Die Struktur der Ablautreihen 77
2.2.5 Vom Mittelhochdeutschen zum Frühneuhochdeutschen 80
3. Einführung in die althochdeutsche Flexionsmorphologie 85
3.1 Das Verb 85
3.1.1 Starke Verben 85
3.1.2 Schwache Verben 94
3.1.3 Präterito-Präsentien 99
3.1.4 Besondere Verben 104
3.2 Die Nomina 105
3.2.1 Substantive 105
3.2.2 Pronomen 114
3.2.3 Adjektive 116
4. Einführung in die mittelhochdeutsche Flexionsmorphologie 122
4.1 Das Verb 122
4.1.1 Starke Verben 122
4.1.2 Schwache Verben 134
4.1.3 Präterito-Präsentien 139
4.1.4 Besondere Verben 144
4.2 Die Nomina 145
4.2.1 Substantive 145
4.2.2 Pronomen 151
4.2.3 Adjektive 154
5. Einführung in die Syntax des Mittelhochdeutschen 159
5.1 Methodische Vorbemerkung 159
5.2 Die Entwicklung der deutschen Klammersyntax 160
5.3 Die Satznegation 165
6. Einführung in die Textphilologie 170
6.1 Schreibung und Aussprache 170
6.1.1 Althochdeutsch 170
6.1.2 Mittelhochdeutsch 173
6.2 Texterschließung mit Wörterbuch und Grammatik 174
6.2.1 Althochdeutsch 174
6.2.2 Mittelhochdeutsch 177
6.3 Digitale Angebote zum Alt- und Mittelhochdeutschen 180
6.3.1 Grundsätzliches 180
6.3.2 Zentrale Portale 181
6.3.3 Fachspezifische Angebote (exemplarisch) 182
7. Textauswahl 189
7.1 Althochdeutsche Texte 189
7.1.1 Tatian 34,6 189
7.1.2 Tatian 87,1-5 189
7.1.3 Otfrid von Weißenburg, Evangelienbuch, IV, 32,1-33,16 191
7.1.4 Ludwigslied 192
7.1.5 Psalm 138 194
7.2 Mittelhochdeutsche Texte 195
7.2.1 Nibelungenlied, 975-992 195
7.2.2 Nibelungenlied, 2037-2042 197
7.2.3 Berthold von Regensburg, I. Daz etelîche jehent: tuo daz guote und lâ daz übele 198
7.2.4 Berthold von Regensburg, XV. Von den fremeden sünden 199
Tabellen und Übersichten 201
Glossar 229
Literatur 240
Register 244
Abkürzungen8Siglen9Einleitung111. Sprachgeschichtliche Grundlagen191.1 Deutsch - Germanisch - Indogermanisch191.1.1 Die Sprachstufen des Deutschen191.1.2 Germanisch201.1.3 Die altgermanischen Dialekte211.1.4 Gemeingermanisch - Urgermanisch231.1.5 Indogermanische Sprachverwandtschaft231.1.6 Die indogermanischen Sprachen im Überblick251.1.7 Die Sprachen Europas im Überblick261.2 Erbwort - Lehnwort271.2.1 Etymologie eines Erbwortes271.2.2 Lehnwort und Fremdwort281.2.3 Etymologie eines Lehnwortes291.2.4 Historische Lehnwortschichten291.2.5 Die Wochentagsnamen im Deutschen: Etymologie und Sprachgeographie301.3 Vielfalt des Althochdeutschen341.3.1 Grenzen und Gliederung des Althochdeutschen341.3.2 Ostfränkisch im 2. Viertel des 9.Jahrhunderts351.3.3 Rheinfränkisch am Ende des 9.Jahrhunderts351.3.4 Bairisches Spätalthochdeutsch361.3.5 Schriftlichkeit im frühen Mittelalter371.3.6 Althochdeutsche Schriftlichkeit. Überlieferungsformen und Überlieferungsinhalte391.4 Varianz des Mittelhochdeutschen431.4.1 Das Normalmittelhochdeutsche der Textausgaben431.4.2 Mittelhochdeutsche Klassik und zeitliche Vielfalt des Mittelhochdeutschen471.4.3 Die 'mittelhochdeutsche Dichtersprache'481.4.4 Textsorten des Mittelhochdeutschen482. Einführung in die historische Phonologie512.1 Konsonantismus512.1.1 Die 1. Lautverschiebung und der grammatische Wechsel522.1.2 Germanische Entwicklungen582.1.3 Die 2. Lautverschiebung622.1.4 Vom Althochdeutschen zum Mittelhochdeutschen682.2 Vokalismus692.2.1 Vom Indogermanischen zum Germanischen692.2.2 Vom Germanischen zum Althochdeutschen712.2.3 Vom Althochdeutschen zum Mittelhochdeutschen732.2.4 Die Struktur der Ablautreihen752.2.5 Vom Mittelhochdeutschen zum Frühneuhochdeutschen783. Einführung in die althochdeutsche Flexionsmorphologie843.1 Das Verb843.1.1 Starke Verben843.1.2 Schwache Verben933.1.3 Präterito-Präsentien983.1.4 Besondere Verben1023.2 Die Nomina1043.2.1 Substantive1043.2.2 Pronomen1133.2.3 Adjektive1154. Einführung in die mittelhochdeutsche Flexionsmorphologie1204.1 Das Verb1204.1.1 Starke Verben1204.1.2 Schwache Verben1324.1.3 Präterito-Präsentien1374.1.4 Besondere Verben1424.2 Die Nomina1424.2.1 Substantive1424.2.2 Pronomen1484.2.3 Adjektive1515. Einführung in die Syntax des Mittelhochdeutschen1565.1 Methodische Vorbemerkung1565.2 Die Entwicklung der deutschen Klammersyntax1575.3 Die Satznegation1626. Einführung in die Textphilologie1676.1 Schreibung und Aussprache1676.1.1 Althochdeutsch1676.1.2 Mittelhochdeutsch1706.2 Texterschließung mit Wörterbuch und Grammatik1716.2.1 Althochdeutsch1716.2.2 Mittelhochdeutsch1746.3 Digitales Arbeiten im sprachhistorischen Kontext1776.3.1 Arbeiten im Netz - Arbeiten mit dem Netz1776.3.2 Bibliotheken und übergreifende Portale (eine Auswahl)1786.3.3 Sprachhistorische und mediävistische Angebote (eine Auswahl)1807. Textauswahl1867.1 Althochdeutsche Texte1867.1.1 Tatian 34,61867.1.2 Tatian 87,1-51867.1.3 Otfrid von Weißenburg, Evangelienbuch, IV, 32,1-33,161887.1.4 Ludwigslied1897.1.5 Psalm 1381917.2 Mittelhochdeutsche Texte1927.2.1 Nibelungenlied, 975-9921927.2.2 Nibelungenlied, 2037-20421947.2.3 Berthold von Regensburg, I. Daz etelîche jehent: tuo daz guote und lâ daz übele1957.2.4 Berthold von Regensburg, XV. Von den fremeden sünden196Tabellen und Übersichten198Glossar226Literatur237Register241
Abkürzungen 8
Siglen 9
Einleitung 11
1. Sprachgeschichtliche Grundlagen 19
1.1 Deutsch - Germanisch - Indogermanisch 19
1.1.1 Die Sprachstufen des Deutschen 19
1.1.2 Germanisch 20
1.1.3 Die altgermanischen Dialekte 21
1.1.4 Gemeingermanisch - Urgermanisch 23
1.1.5 Indogermanische Sprachverwandtschaft 23
1.1.6 Die indogermanischen Sprachen im Überblick 25
1.1.7 Die Sprachen Europas im Überblick 26
1.2 Erbwort - Lehnwort 27
1.2.1 Etymologie eines Erbwortes 27
1.2.2 Lehnwort und Fremdwort 28
1.2.3 Etymologie eines Lehnwortes 29
1.2.4 Historische Lehnwortschichten 29
1.2.5 Die Wochentagsnamen im Deutschen: Etymologie und Sprachgeographie 30
1.3 Vielfalt des Althochdeutschen 34
1.3.1 Grenzen und Gliederung des Althochdeutschen 34
1.3.2 Ostfränkisch im 2. Viertel des 9. Jahrhunderts 35
1.3.3 Rheinfränkisch am Ende des 9. Jahrhunderts 35
1.3.4 Bairisches Spätalthochdeutsch 36
1.3.5 Schriftlichkeit im frühen Mittelalter 37
1.3.6 Althochdeutsche Schriftlichkeit. Überlieferungsformen und Überlieferungsinhalte 39
1.4 Varianz des Mittelhochdeutschen 43
1.4.1 Das Normalmittelhochdeutsche der Textausgaben 43
1.4.2 Mittelhochdeutsche Klassik und zeitliche Vielfalt des Mittelhochdeutschen 47
1.4.3 Die 'mittelhochdeutsche Dichtersprache' 48
1.4.4 Textsorten des Mittelhochdeutschen 48
2. Einführung in die historische Phonologie 51
2.1 Konsonantismus 51
2.1.1 Die 1. Lautverschiebung und der grammatische Wechsel 52
2.1.2 Germanische Entwicklungen 59
2.1.3 Die 2. Lautverschiebung 63
2.1.4 Vom Althochdeutschen zum Mittelhochdeutschen 68
2.2 Vokalismus 70
2.2.1 Vom Indogermanischen zum Germanischen 70
2.2.2 Vom Germanischen zum Althochdeutschen 72
2.2.3 Vom Althochdeutschen zum Mittelhochdeutschen 74
2.2.4 Die Struktur der Ablautreihen 77
2.2.5 Vom Mittelhochdeutschen zum Frühneuhochdeutschen 80
3. Einführung in die althochdeutsche Flexionsmorphologie 85
3.1 Das Verb 85
3.1.1 Starke Verben 85
3.1.2 Schwache Verben 94
3.1.3 Präterito-Präsentien 99
3.1.4 Besondere Verben 104
3.2 Die Nomina 105
3.2.1 Substantive 105
3.2.2 Pronomen 114
3.2.3 Adjektive 116
4. Einführung in die mittelhochdeutsche Flexionsmorphologie 122
4.1 Das Verb 122
4.1.1 Starke Verben 122
4.1.2 Schwache Verben 134
4.1.3 Präterito-Präsentien 139
4.1.4 Besondere Verben 144
4.2 Die Nomina 145
4.2.1 Substantive 145
4.2.2 Pronomen 151
4.2.3 Adjektive 154
5. Einführung in die Syntax des Mittelhochdeutschen 159
5.1 Methodische Vorbemerkung 159
5.2 Die Entwicklung der deutschen Klammersyntax 160
5.3 Die Satznegation 165
6. Einführung in die Textphilologie 170
6.1 Schreibung und Aussprache 170
6.1.1 Althochdeutsch 170
6.1.2 Mittelhochdeutsch 173
6.2 Texterschließung mit Wörterbuch und Grammatik 174
6.2.1 Althochdeutsch 174
6.2.2 Mittelhochdeutsch 177
6.3 Digitale Angebote zum Alt- und Mittelhochdeutschen 180
6.3.1 Grundsätzliches 180
6.3.2 Zentrale Portale 181
6.3.3 Fachspezifische Angebote (exemplarisch) 182
7. Textauswahl 189
7.1 Althochdeutsche Texte 189
7.1.1 Tatian 34,6 189
7.1.2 Tatian 87,1-5 189
7.1.3 Otfrid von Weißenburg, Evangelienbuch, IV, 32,1-33,16 191
7.1.4 Ludwigslied 192
7.1.5 Psalm 138 194
7.2 Mittelhochdeutsche Texte 195
7.2.1 Nibelungenlied, 975-992 195
7.2.2 Nibelungenlied, 2037-2042 197
7.2.3 Berthold von Regensburg, I. Daz etelîche jehent: tuo daz guote und lâ daz übele 198
7.2.4 Berthold von Regensburg, XV. Von den fremeden sünden 199
Tabellen und Übersichten 201
Glossar 229
Literatur 240
Register 244
Siglen 9
Einleitung 11
1. Sprachgeschichtliche Grundlagen 19
1.1 Deutsch - Germanisch - Indogermanisch 19
1.1.1 Die Sprachstufen des Deutschen 19
1.1.2 Germanisch 20
1.1.3 Die altgermanischen Dialekte 21
1.1.4 Gemeingermanisch - Urgermanisch 23
1.1.5 Indogermanische Sprachverwandtschaft 23
1.1.6 Die indogermanischen Sprachen im Überblick 25
1.1.7 Die Sprachen Europas im Überblick 26
1.2 Erbwort - Lehnwort 27
1.2.1 Etymologie eines Erbwortes 27
1.2.2 Lehnwort und Fremdwort 28
1.2.3 Etymologie eines Lehnwortes 29
1.2.4 Historische Lehnwortschichten 29
1.2.5 Die Wochentagsnamen im Deutschen: Etymologie und Sprachgeographie 30
1.3 Vielfalt des Althochdeutschen 34
1.3.1 Grenzen und Gliederung des Althochdeutschen 34
1.3.2 Ostfränkisch im 2. Viertel des 9. Jahrhunderts 35
1.3.3 Rheinfränkisch am Ende des 9. Jahrhunderts 35
1.3.4 Bairisches Spätalthochdeutsch 36
1.3.5 Schriftlichkeit im frühen Mittelalter 37
1.3.6 Althochdeutsche Schriftlichkeit. Überlieferungsformen und Überlieferungsinhalte 39
1.4 Varianz des Mittelhochdeutschen 43
1.4.1 Das Normalmittelhochdeutsche der Textausgaben 43
1.4.2 Mittelhochdeutsche Klassik und zeitliche Vielfalt des Mittelhochdeutschen 47
1.4.3 Die 'mittelhochdeutsche Dichtersprache' 48
1.4.4 Textsorten des Mittelhochdeutschen 48
2. Einführung in die historische Phonologie 51
2.1 Konsonantismus 51
2.1.1 Die 1. Lautverschiebung und der grammatische Wechsel 52
2.1.2 Germanische Entwicklungen 59
2.1.3 Die 2. Lautverschiebung 63
2.1.4 Vom Althochdeutschen zum Mittelhochdeutschen 68
2.2 Vokalismus 70
2.2.1 Vom Indogermanischen zum Germanischen 70
2.2.2 Vom Germanischen zum Althochdeutschen 72
2.2.3 Vom Althochdeutschen zum Mittelhochdeutschen 74
2.2.4 Die Struktur der Ablautreihen 77
2.2.5 Vom Mittelhochdeutschen zum Frühneuhochdeutschen 80
3. Einführung in die althochdeutsche Flexionsmorphologie 85
3.1 Das Verb 85
3.1.1 Starke Verben 85
3.1.2 Schwache Verben 94
3.1.3 Präterito-Präsentien 99
3.1.4 Besondere Verben 104
3.2 Die Nomina 105
3.2.1 Substantive 105
3.2.2 Pronomen 114
3.2.3 Adjektive 116
4. Einführung in die mittelhochdeutsche Flexionsmorphologie 122
4.1 Das Verb 122
4.1.1 Starke Verben 122
4.1.2 Schwache Verben 134
4.1.3 Präterito-Präsentien 139
4.1.4 Besondere Verben 144
4.2 Die Nomina 145
4.2.1 Substantive 145
4.2.2 Pronomen 151
4.2.3 Adjektive 154
5. Einführung in die Syntax des Mittelhochdeutschen 159
5.1 Methodische Vorbemerkung 159
5.2 Die Entwicklung der deutschen Klammersyntax 160
5.3 Die Satznegation 165
6. Einführung in die Textphilologie 170
6.1 Schreibung und Aussprache 170
6.1.1 Althochdeutsch 170
6.1.2 Mittelhochdeutsch 173
6.2 Texterschließung mit Wörterbuch und Grammatik 174
6.2.1 Althochdeutsch 174
6.2.2 Mittelhochdeutsch 177
6.3 Digitale Angebote zum Alt- und Mittelhochdeutschen 180
6.3.1 Grundsätzliches 180
6.3.2 Zentrale Portale 181
6.3.3 Fachspezifische Angebote (exemplarisch) 182
7. Textauswahl 189
7.1 Althochdeutsche Texte 189
7.1.1 Tatian 34,6 189
7.1.2 Tatian 87,1-5 189
7.1.3 Otfrid von Weißenburg, Evangelienbuch, IV, 32,1-33,16 191
7.1.4 Ludwigslied 192
7.1.5 Psalm 138 194
7.2 Mittelhochdeutsche Texte 195
7.2.1 Nibelungenlied, 975-992 195
7.2.2 Nibelungenlied, 2037-2042 197
7.2.3 Berthold von Regensburg, I. Daz etelîche jehent: tuo daz guote und lâ daz übele 198
7.2.4 Berthold von Regensburg, XV. Von den fremeden sünden 199
Tabellen und Übersichten 201
Glossar 229
Literatur 240
Register 244
Abkürzungen8Siglen9Einleitung111. Sprachgeschichtliche Grundlagen191.1 Deutsch - Germanisch - Indogermanisch191.1.1 Die Sprachstufen des Deutschen191.1.2 Germanisch201.1.3 Die altgermanischen Dialekte211.1.4 Gemeingermanisch - Urgermanisch231.1.5 Indogermanische Sprachverwandtschaft231.1.6 Die indogermanischen Sprachen im Überblick251.1.7 Die Sprachen Europas im Überblick261.2 Erbwort - Lehnwort271.2.1 Etymologie eines Erbwortes271.2.2 Lehnwort und Fremdwort281.2.3 Etymologie eines Lehnwortes291.2.4 Historische Lehnwortschichten291.2.5 Die Wochentagsnamen im Deutschen: Etymologie und Sprachgeographie301.3 Vielfalt des Althochdeutschen341.3.1 Grenzen und Gliederung des Althochdeutschen341.3.2 Ostfränkisch im 2. Viertel des 9.Jahrhunderts351.3.3 Rheinfränkisch am Ende des 9.Jahrhunderts351.3.4 Bairisches Spätalthochdeutsch361.3.5 Schriftlichkeit im frühen Mittelalter371.3.6 Althochdeutsche Schriftlichkeit. Überlieferungsformen und Überlieferungsinhalte391.4 Varianz des Mittelhochdeutschen431.4.1 Das Normalmittelhochdeutsche der Textausgaben431.4.2 Mittelhochdeutsche Klassik und zeitliche Vielfalt des Mittelhochdeutschen471.4.3 Die 'mittelhochdeutsche Dichtersprache'481.4.4 Textsorten des Mittelhochdeutschen482. Einführung in die historische Phonologie512.1 Konsonantismus512.1.1 Die 1. Lautverschiebung und der grammatische Wechsel522.1.2 Germanische Entwicklungen582.1.3 Die 2. Lautverschiebung622.1.4 Vom Althochdeutschen zum Mittelhochdeutschen682.2 Vokalismus692.2.1 Vom Indogermanischen zum Germanischen692.2.2 Vom Germanischen zum Althochdeutschen712.2.3 Vom Althochdeutschen zum Mittelhochdeutschen732.2.4 Die Struktur der Ablautreihen752.2.5 Vom Mittelhochdeutschen zum Frühneuhochdeutschen783. Einführung in die althochdeutsche Flexionsmorphologie843.1 Das Verb843.1.1 Starke Verben843.1.2 Schwache Verben933.1.3 Präterito-Präsentien983.1.4 Besondere Verben1023.2 Die Nomina1043.2.1 Substantive1043.2.2 Pronomen1133.2.3 Adjektive1154. Einführung in die mittelhochdeutsche Flexionsmorphologie1204.1 Das Verb1204.1.1 Starke Verben1204.1.2 Schwache Verben1324.1.3 Präterito-Präsentien1374.1.4 Besondere Verben1424.2 Die Nomina1424.2.1 Substantive1424.2.2 Pronomen1484.2.3 Adjektive1515. Einführung in die Syntax des Mittelhochdeutschen1565.1 Methodische Vorbemerkung1565.2 Die Entwicklung der deutschen Klammersyntax1575.3 Die Satznegation1626. Einführung in die Textphilologie1676.1 Schreibung und Aussprache1676.1.1 Althochdeutsch1676.1.2 Mittelhochdeutsch1706.2 Texterschließung mit Wörterbuch und Grammatik1716.2.1 Althochdeutsch1716.2.2 Mittelhochdeutsch1746.3 Digitales Arbeiten im sprachhistorischen Kontext1776.3.1 Arbeiten im Netz - Arbeiten mit dem Netz1776.3.2 Bibliotheken und übergreifende Portale (eine Auswahl)1786.3.3 Sprachhistorische und mediävistische Angebote (eine Auswahl)1807. Textauswahl1867.1 Althochdeutsche Texte1867.1.1 Tatian 34,61867.1.2 Tatian 87,1-51867.1.3 Otfrid von Weißenburg, Evangelienbuch, IV, 32,1-33,161887.1.4 Ludwigslied1897.1.5 Psalm 1381917.2 Mittelhochdeutsche Texte1927.2.1 Nibelungenlied, 975-9921927.2.2 Nibelungenlied, 2037-20421947.2.3 Berthold von Regensburg, I. Daz etelîche jehent: tuo daz guote und lâ daz übele1957.2.4 Berthold von Regensburg, XV. Von den fremeden sünden196Tabellen und Übersichten198Glossar226Literatur237Register241
Aus: mediennerd - Daniel Pietrzik - 05.05.2019
Ein Klassiker des Germanistik-Studiums liegt jetzt völlig neu überarbeitet und für das Bachelor-Studium optimiert vor. Anhand ausgewählter historischer Texte erklärt das Buch die grammatischen Besonderheiten des Alt- und Mittelhochdeutschen sowohl diachron als auch an synchronen Schnitten. Es ist modular und dynamisch aufgebaut und setzt kaum Vorkenntnisse voraus.
Aus: ekz-Informationsdienst, Barbara Kette, 2011/50
[...] Eine Auswahl althochdeutscher und mittelhochdeutscher Texte sowie ein Anhang mit Tabellen und Übersichten unterstreichen den praktischen Nutzen [...]
Ein Klassiker des Germanistik-Studiums liegt jetzt völlig neu überarbeitet und für das Bachelor-Studium optimiert vor. Anhand ausgewählter historischer Texte erklärt das Buch die grammatischen Besonderheiten des Alt- und Mittelhochdeutschen sowohl diachron als auch an synchronen Schnitten. Es ist modular und dynamisch aufgebaut und setzt kaum Vorkenntnisse voraus.
Aus: ekz-Informationsdienst, Barbara Kette, 2011/50
[...] Eine Auswahl althochdeutscher und mittelhochdeutscher Texte sowie ein Anhang mit Tabellen und Übersichten unterstreichen den praktischen Nutzen [...]