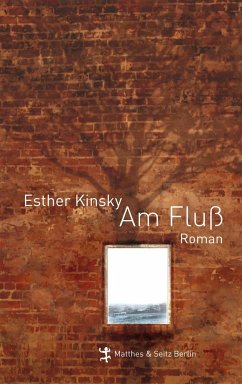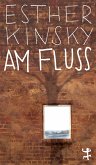Alte Fabriken, ärmliche Häuser, aber auch unverhoffte Streifen von Wildnis: eine Landschaft an der Grenze zwischen Stadt und Land, bevölkert von aus ihren Ordnungen gefallenen Menschen, wie sie das wahre Leben am Rande jeder Metropole prägen. In neun Etappen eines Spaziergangs in der Gegend um den River Lea vor London verfolgt Esther Kinsky die sich überlagernden Spuren persönlicher Geschichte und urbaner Historie dieser Flusslandschaft und nutzt die Wildnis des Marschlands als Freiraum für Erinnerung und Reflexion. Der River Lea wird zur Grenzmarkierung und zugleich zu einem Wegweiser: Erfahrung und Wahrnehmung finden an ihm eine Schranke und ein Ziel. »Am Fluss« ist ein Buch über das Sehen, über Erkenntnis durch Betrachtung. Im Zusammenklang mit ihren Fotografien stellt Esther Kinsky die Frage nach den Möglichkeiten und Grenzen der Sichtbarmachung von Welt neu.

Mit diesem Buch steht sie auf der Longlist des Deutschen Buchpreises: Esther Kinskys Roman "Am Fluß" etabliert mit einem Schlag nicht nur eine neue Sprache, sondern auch ein altes Genre wieder.
Dort, hinter dem Fluss, lag ein Erlenhain, ein halbwilder Ort, "wo sich an kalten Tagen der Nebel ballte, der ganze Hain wollte Anwärter auf Erlkönigtum und Verwunschenheit sein, doch in Wildnis geschulte Parkarbeiter hatten hier Abholzübungen durchgeführt". Ein Picknickplatz wurde begonnen, dann aufgegeben, Schwäne glitten durchs Dämmerlicht am nordöstlichsten Zipfel Londons, dort, wo fromme Juden ihre Siedlungen behaupteten und halbverwildertes Marschland entlang des River Lea, der einige Kilometer weiter in die Themse mündet, zu langen Spaziergängen einlud, ohne Ziel oder Bestimmung, wie es schien. "Ich hörte die Brachvögel, Drommeln und Kiebitze, Schwermutslaute aus untraurigen Kehlen, ich sah meine Großmutter wieder am Fenster stehen und diese Vogelrufe ausstoßen, sich einbildend, die Vögel wären zu täuschen, sie könnte es mittels ihrer Herzenstraurigkeit den Lauten aus den an sich ganz gleichmütigen Vogelkehlen gleichtun, die doch vom Herzzerreißenden ihres Klanges nicht das Geringste wussten. So geht jedem die Natur ans Leben - mit ihrem ungerührten Herzschlag, der an die herzbemannte Unruh aller Trauer rührt."
Herzbemannte Unruh überkommt einen bei der Lektüre dieser präzisen Mensch-Natur-Etüden. Esther Kinskys Roman stellt mit geduldiger Ausdauer alles in den Schatten, was zuletzt in deutscher Sprache erschienen ist. Es ist voller Bildung, ohne gebildet sein zu wollen, voller Wissen, ohne etwas besser zu wissen. "Am Fluß" ist ein demokratisches Buch, klug und weise und rührend schön, wie das Bild einer rätselhaften Landschaft, die sich ihrem Betrachter erst ganz stofflich als Textur, später dann als Text, noch später und nur für den, der weitergehen möchte, als Text über Texte verschlüsselt. Im günstigsten Fall über all die Lebensformen und natürlichen Prozesse, die sich an und auf der geschilderten Natur vollziehen. Im nicht minder beglückenden Fall als neuerliches Rätsel.
Man könnte sagen, dass Kinsky die Sedimente menschlichen Lebens begutachtet, denn an den Ufern ihrer Flüsse wird angeschwemmt, was von Menschen gemacht wurde, es wird überschwemmt, was zum Bleiben gedacht war, es wird begradigt, verschmutzt oder der Verwilderung anheimgegeben. Und so urwüchsig die Natur ist, die Kinsky durchmisst, so sind auch die Menschen, von denen sie mit diskretem Interesse erzählt, überzeitliche Mythenträger. Sie scheinen im verborgenen Auftrag zu handeln: Könige, fromme Juden, Goldsucher, Kunstreiter, Gaukler - Suchende, Glaubende, Träumende, auch Findende.
Es ist unglaublich, dass dieses Buch zu großen Teilen in London spielt, der Stadt, in der Kinsky es immerhin mehr als zehn Jahre lang ausgehalten hat, bevor sie wieder ihre Koffer packte und zu neuen Heimaten in Osteuropa, schließlich in Berlin aufgebrochen ist. Die City scheint endlos entfernt zu sein von den Marshlands im Osten Londons - so weit vielleicht, wie nur die Zivilisation sich ihren natürlichen Ursprüngen entwinden kann. Kinsky, die bislang zwei Romane, mehrere Gedichtbände, Kinderbücher und einen Essay übers Übersetzen veröffentlicht hat, etabliert mit diesem Buch ein Sujet in der Gegenwartsliteratur, das in der angloamerikanischen Welt seit bald zweihundert Jahren unter dem Gattungsbegriff "Nature Writing" bekannt ist. In Deutschland ist es bis auf wenige Ausnahmen vernachlässigt geblieben. In einer Kosmos-Vorlesung von 1827 attestiert Alexander von Humboldt dem "hohen Meister" Goethe noch ein "tiefes Gefühl" für die Natur. Aber niemand reiche in "Wahrheit und Anmut" an den Weltumsegler Georg Forster heran: "Er entwirft ein sehr geschmackvolles Naturbild, in dieser Art das Erste, u. schildert nicht nur lebhaft den Anblick der Tropenwelt, sondern berücksichtigt auch die verschiedenen Sitten u. Racen der Völker."
Kinsky ist eine Wahrnehmungsverwandte solcher Forschungsreisenden. Insbesondere dem amerikanischen Waldhüttenbewohner Henry David Thoreau scheint sie verbunden, dessen "Lob der Wildnis" sie erst kürzlich ins Deutsche übersetzt hat. Dass ihr Verlag gerade John Muirs Naturbeschreibungsklassiker "Die Berge Kaliforniens" veröffentlicht hat, passt ins ästhetische Ahnenprofil der Autorin: Ihr Literaturverständnis ist geologisch. Schicht um Schicht wird die Landschaft durchpflügt, ihre menschlichen Hinterlassenschaften werden abgestaubt und entziffert.
Sie habe irgendwann begonnen, auf ihren Spaziergängen Fotos mit einer Sofortbildkamera zu schießen. Einige davon sind im Roman abgebildet. Darauf ist meist nicht mehr zu sehen als Gestrüpp, kahl im Winter, verwildert im Sommer. Das Wesentliche: Es handelt sich um Bilder von etwas, "das hinter den Dingen lag". Was sind das für Dinge? Naturerscheinungen, aber auch beseelte Gebrauchsgegenstände: "Manchmal standen sogar kleine Möbelstücke am Straßenrand, ich hätte sie gut gebrauchen können, aber ich fürchtete mich davor, mit ihnen ein Schicksal bei mir eintreten zu lassen, das sich breitmachen würde. Es würde in einer Ecke sitzen, erst leise, dann immer selbstbewusster, mit den Füßen wippen und am Ende gar rauchen und plaudern wollen." Auch Worte können Gestalt annehmen. Drei Greisinnen in Springfield Park unterhalten sich in einer fremden Sprache, da löst sich ein Wort aus ihren "Räbinnenschnäbeln" und ergibt das Lautbild "Mississauga", was die Erzählerin nach Kanada versetzt, wohin sie vor langer Zeit mit ihrem Säugling ausgewandert war.
Der stark autobiographische Charakter des Buchs folgt keinem Selbstzweck. Er erlaubt es vielmehr, über die Funktion von Geschichtsschreibung nachzudenken. Vollkommen frei von philosemitischen Klischees lässt Kinsky das vom Zeitlauf scheinbar unberührte orthodoxe jüdische Leben Londons aufscheinen. Sie führt ihre Leser in koschere Supermärkte und an blasshäutigen Chassidenjungen vorbei, die hinter schützenden Büschen an einer Zigarette ziehen. Beim kroatischen Trödler taucht unvermittelt eine Dose auf, gefüllt mit Goldzähnen unbekannter Provenienz. Nebenan lässt Greengrocer Katz in Vorbereitung auf den Schabbat den Eisenladen seines Geschäfts herunter. Die Reibung dieser an sich unverbundenen Bilder erzeugt einen Schauer der Irritation - nicht mehr, nicht weniger, aber es ist genug.
"Am Fluß" besticht durch die genaue, nie entblößende Wahrnehmung fremder Schicksalsverläufe, die wiederum den Flussläufen in Mostar, Kalkutta oder Tel Aviv ähneln, von denen Kinskys Buch vordergründig handelt. Die Menschen, denen sie auf ihren Reisen begegnet, haben allegorischen Charakter. Dass ein Mann mit erhabenem Gang, buntem Kopfputz und zahllosen Raben auf den ausgebreiteten Armen ein Bettler ist, mag stimmen. Seinem selbstbehaupteten Königtum tut das keinen Abbruch. Sein Auftritt auf den letzten Seiten des Romans an den Ufern nicht etwa des griechischen Vergessensflusses Lethe, sondern am englischen Erinnerungsfluss Lea ist eine Apotheose des tiefen Sehens: "Der König bewegte sich im Kreis, während rot und orange die Sonne über dem Marschland erschien, er streckte und dehnte Oberkörper und Arme, die Vögel umschwärmten ihn, ein Goldfaden im schütteren Rest seines federgemusterten Festkleids schimmerte schwach. Der König hielt inne, setzte an zu einem Sprung, in dem sich alle seine Kräfte sammelten, hob in die kreisenden Vögel hinein mit rudernden Armen vom Rasen ab, schwebte dicht über dem Boden in der Luft, Sonnenlicht strömte in den Zwischenraum zwischen dem schwebenden Fuß und dem fahlen Gras, er war ein Vogelkönig unter seinen Untertanen, der König flog! Dann stürzte er der Länge nach auf den Boden. Sonnenstrahlen breiteten sich über ihn, im Glanz der Sonne erbebten Goldflecken auf seinem Rock."
KATHARINA TEUTSCH
Esther Kinsky: "Am Fluß". Roman.
Matthes & Seitz Verlag, Berlin 2014. 387 S., geb., 22,99 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur TAZ-Rezension
Esther Kinskys Leben und Werk ist eng verwoben mit der Erfahrung, an Flüssen zu leben, erklärt Rezensent Uwe Rada: So arbeite die Autorin in ihren Romanen sehr verlässlich an einer "Poetologie des Flusses". Auch dieses Buch, das sich an die Fersen einer Frau heftet, die am Industriefluss River Lea entlang quer durch den Osten Londons streunt und dabei in Erinnerugen schwelgt, ist deshalb wieder ein echter Flussroman geworden. Dialoge und Metaphern gibt es zwar keine, dafür lernt man mit der Erzählerin das Sehen neu, berichtet der Rezensent, der sich ganz offensichtlich mit einigem literarischem Genuss dieser Wanderschaft angeschlossen hat. Zwar muss man damit umgehen können, dass der Roman gemächlich plätschert, erklärt der Kritiker mit großer Freude an naheliegenden Allegorien. Dennoch ist er am Ende ganz fasziniert von der Beschreibungslust, mit der sich Kinsky hier als "Archäologin der scheinbaren Unbedeutendheiten" betätigt.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»Wer die Bücher von Esther Kinsky liest, erfährt von dem Glück, sich ins Unsichere zu begeben und sich von ihrer Sprache, in einem leichten Wogen, halten zu lassen.« - Wiebke Poromkba, Chamisso Magazin, März 2016 Wiebke Poromkba Chamisso Magazin 20160301