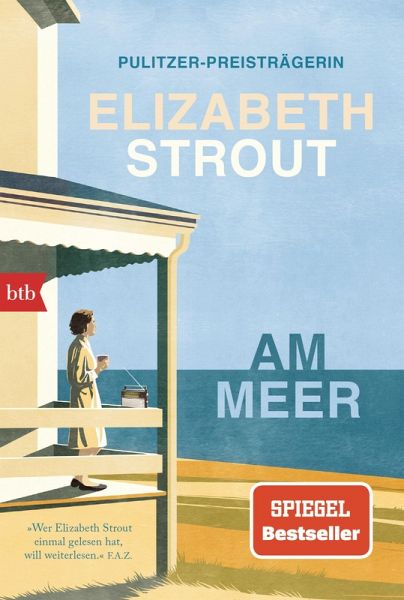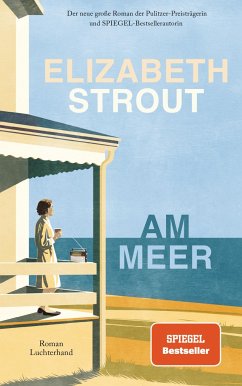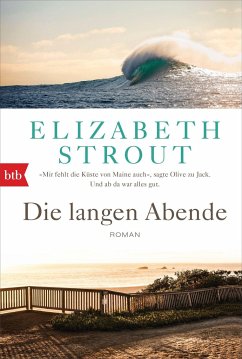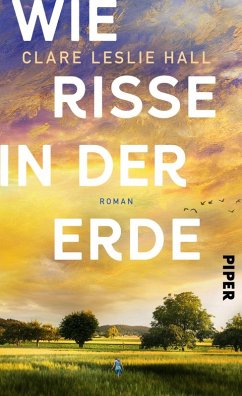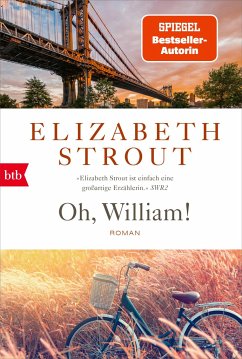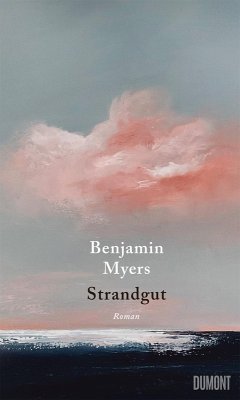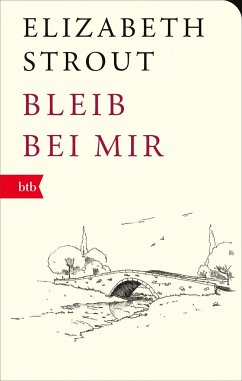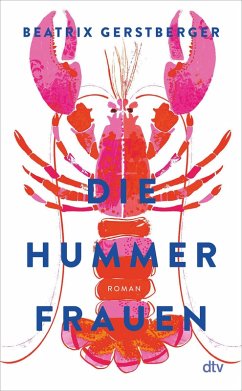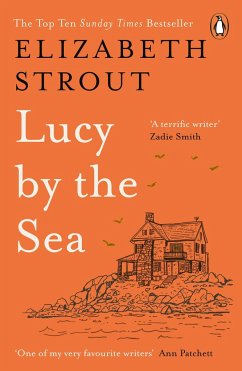Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
0 °P sammeln!





»Wer Elizabeth Strout einmal gelesen hat, will weiterlesen.« FAZ Der SPIEGEL-Bestseller der Pulitzer-Preisträgerin - erstmals im Taschenbuch.»Welch eine Gnade, dass wir nicht wissen, was uns im Leben erwartet.« Elizabeth Strout schreibt die Geschichte von Lucy Barton weiter, ihrer feinsinnigen, von den Härten des Lebens nicht immer verschonten Heldin. Mit ihrem Ex-Mann William sucht sie während des Lockdowns Zuflucht in Maine, in einem alten Haus am Meer. Eine unvergessliche Geschichte über Familie und Freundschaft, die Zerbrechlichkeit unserer Existenz und die Hoffnung, die uns am Leb...
»Wer Elizabeth Strout einmal gelesen hat, will weiterlesen.« FAZ Der SPIEGEL-Bestseller der Pulitzer-Preisträgerin - erstmals im Taschenbuch.
»Welch eine Gnade, dass wir nicht wissen, was uns im Leben erwartet.« Elizabeth Strout schreibt die Geschichte von Lucy Barton weiter, ihrer feinsinnigen, von den Härten des Lebens nicht immer verschonten Heldin. Mit ihrem Ex-Mann William sucht sie während des Lockdowns Zuflucht in Maine, in einem alten Haus am Meer. Eine unvergessliche Geschichte über Familie und Freundschaft, die Zerbrechlichkeit unserer Existenz und die Hoffnung, die uns am Leben erhält, selbst wenn die Welt aus den Fugen gerät.
Sie hatte es so wenig kommen sehen wie die meisten. Lucy Barton, erfolgreiche Schriftstellerin und Mutter zweier erwachsener Töchter, erhält im März 2020 einen Anruf von ihrem Ex-Mann - und immer noch besten Freund - William. Er bittet sie, ihren Koffer zu packen und mit ihm New York zu verlassen. In Maine hat er für sie beide ein Küstenhaus gemietet, auf einer abgelegenen Landzunge, weit weg von allem. Nur für ein paar Wochen wollen sie anfangs dort sein. Doch aus Wochen werden Monate, in denen Lucy und William und ihre komplizierte Vergangenheit zusammen sind in dem einsamen Haus am Meer.
»Welch eine Gnade, dass wir nicht wissen, was uns im Leben erwartet.« Elizabeth Strout schreibt die Geschichte von Lucy Barton weiter, ihrer feinsinnigen, von den Härten des Lebens nicht immer verschonten Heldin. Mit ihrem Ex-Mann William sucht sie während des Lockdowns Zuflucht in Maine, in einem alten Haus am Meer. Eine unvergessliche Geschichte über Familie und Freundschaft, die Zerbrechlichkeit unserer Existenz und die Hoffnung, die uns am Leben erhält, selbst wenn die Welt aus den Fugen gerät.
Sie hatte es so wenig kommen sehen wie die meisten. Lucy Barton, erfolgreiche Schriftstellerin und Mutter zweier erwachsener Töchter, erhält im März 2020 einen Anruf von ihrem Ex-Mann - und immer noch besten Freund - William. Er bittet sie, ihren Koffer zu packen und mit ihm New York zu verlassen. In Maine hat er für sie beide ein Küstenhaus gemietet, auf einer abgelegenen Landzunge, weit weg von allem. Nur für ein paar Wochen wollen sie anfangs dort sein. Doch aus Wochen werden Monate, in denen Lucy und William und ihre komplizierte Vergangenheit zusammen sind in dem einsamen Haus am Meer.
Elizabeth Strout wurde 1956 in Portland, Maine, geboren. Sie zählt zu den großen amerikanischen Erzählstimmen der Gegenwart. Ihre Bücher sind internationale Bestseller und preisgekrönt. Für ihren Roman 'Mit Blick aufs Meer' erhielt sie den Pulitzerpreis. 'Oh, William!' und 'Die Unvollkommenheit der Liebe' waren für den Man Booker Prize nominiert. Mit 'Erzähl mir alles' stand sie 2025 auf der Shortlist des Women's Prize for Fiction. Für ihr Gesamtwerk wurde sie mit dem Siegfried Lenz Preis ausgezeichnet. Elizabeth Strout lebt in Maine und in New York City.
Produktdetails
- Die Lucy-Barton-Romane / Lucy Barton 4
- Verlag: btb
- Originaltitel: Lucy by the Sea
- Seitenzahl: 284
- Erscheinungstermin: 16. April 2025
- Deutsch
- Abmessung: 187mm x 126mm x 26mm
- Gewicht: 256g
- ISBN-13: 9783442775422
- ISBN-10: 3442775426
- Artikelnr.: 72053660
Herstellerkennzeichnung
btb Taschenbuch
Neumarkter Straße 28
81673 München
produktsicherheit@penguinrandomhouse.de
»Elizabeth Strout hat mit 'Am Meer' den zartesten Lockdown-Roman geschrieben, den man sich vorstellen kann.« Bettina Steiner / Die Presse
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Man darf sich nicht vom Plauderton der Ich-Erzählerin Lucy Barton, die man schon aus früheren Büchern kennt, täuschen lassen, warnt Rezensent Christoph Schröder: Unter dem so Dahingesagten lauern "Tod, Krankheit, Verlust und stilles Leid", versichert er. Sie und ihr Ex-Mann sind fast siebzig, als die Corona-Pandemie ausbricht und sie gemeinsam aus New York in ein Haus am Meer ziehen. Ein Corona-Roman ist es trotzdem nicht geworden, meint Schröder. Es geht um allgemeinere Themen - das Alter, den Tod, die Kinder, das von Meinungskämpfen zerrissene Land, in dem sie leben. Was vom Tage übrig blieb, gewissermaßen. Schröder scheint das gern gelesen zu haben.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
Gebundenes Buch
Es menschelt zu Pandemiezeiten
Wer schon Romane von Elizabeth Strout gelesen hat, weiß worauf sich einzulassen ist, wenn Lucy Barton wieder auftaucht und das im Kontext der Coronapandemie. Zunächst war ich wenig begeistert, dass mir dieses unliebsame Thema wieder begegnete, aber …
Mehr
Es menschelt zu Pandemiezeiten
Wer schon Romane von Elizabeth Strout gelesen hat, weiß worauf sich einzulassen ist, wenn Lucy Barton wieder auftaucht und das im Kontext der Coronapandemie. Zunächst war ich wenig begeistert, dass mir dieses unliebsame Thema wieder begegnete, aber Elizabeth Strout hat wie eh und je mit ihren bekannten Figuren ein gesellschaftliches Panorama einer abgeschlossenen Periode geschrieben. Fast aufarbeitend. Zu Recht lesenswert, zeigt sie uns doch wie die Pandemie Menschen zugleich zueinander und auseinander getrieben hat.
Es beginnt mit dem Auftakt der Pandemie, die Schriftstellerin Lucy Barton wird von ihrem Ex-Mann William angerufen, mit dem sie zwei bereits erwachsene Töchter haben. Er als Naturwissenschaftler ahnt was alle auf die globale Menschheit zukommt und er bittet Lucy mit ihm nach Maine zu fahren und dort in ein Haus an der Küste zu flüchten. Der Lockdown hat alles verändert, nicht Tage, nicht Wochen sind sie dort im Haus, sondern Monate. Nicht sonderlich gemocht von den lokalen Menschen, ein Mikrokosmos wird hier beleuchtet.
Der Roman wird aus Lucys Perspektive erzählt. Alles wird durchlebt, ihre Panikattacken, ihre Liebe zu ihren Töchter, die Sorge um das Leben im kleinen und im Großen. Spannend ist der Bogen des Mikrokosmos des eigenen Lebens im Lockdown der gut kombiniert ist mit den politischen Geschehnissen in dem Trump Aufwind bekam. Durch alltägliche Begegnungen und Beobachtungen versucht Elizabeth Strout Erklärungen zu finden für gesellschaftliche Strukturen und hinterfragt gekonnt im Roman.
Im Original in den USA bereits 2022 erschienen und nun von Sabine Roth für uns in Deutsche übersetzt.
Fazit: Auch hier wieder bringt Elizabeth Strout ein breites Spektrum zu Papier.
Weniger
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 1 von 1 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Ein Roman der leisen Töne
Elizabeth Strout ist eine brillante Erzählerin, was sie auch wieder in ihrem Roman 'Am Meer', dem vierten Teil der Lucy Barton Reihe unter Beweis stellt. Sie packt das Thema Corona-Pandemie, welches uns alle auf eine unendliche Geduldsprobe gestellt hat, in …
Mehr
Ein Roman der leisen Töne
Elizabeth Strout ist eine brillante Erzählerin, was sie auch wieder in ihrem Roman 'Am Meer', dem vierten Teil der Lucy Barton Reihe unter Beweis stellt. Sie packt das Thema Corona-Pandemie, welches uns alle auf eine unendliche Geduldsprobe gestellt hat, in eine Geschichte mit empathischen Protagonisten und pittoresken Landschaften. Doch auch kritische Töne wie das Dulden von Fremden in der heimatlichen Umgebung schlägt sie an und zeigt damit Grenzen der Toleranz auf. Ihre scharfe Beobachtungsgabe und ihr feines Gespür für die Handlungen der Menschen verleihen dem Buch eine ganz besondere Note, die den Lesegenuss zum Erblühen bringen.
Lucy ist Schriftstellerin, lebt in New York allein in ihrer Wohnung, nachdem sie von ihrem ersten Ehemann William geschieden wurde und ihr zweiter Ehemann verstorben ist. Zu William pflegt sie ein freundschaftliches, zu ihren beiden Töchtern ein entspannt mütterliches Verhältnis. Als die stark infektiöse Bedrohung des Corana-Virus auch die Millionenstadt New York droht in die Knie zu zwingen, packt William Lucy kurzerhand in sein Auto und bringt beide aus der unmittelbaren Gefahrenzone. Sie richten sich ein in einem leerstehenden wunderschönen Haus am Meer, im malerischen Crosby (Maine). Welche Wandlungen sie in der Abgeschiedenheit durchleben, wie sich ihre Gedankenwelt verändert, aber auch wie Sorge und Ängste sie plagen, erzählt dieses bezaubernde Buch in leisen Tönen.
Es braucht keine Vorerfahrung vorangegangener Romanteile, um in die Geschichte eintauchen zu können. Ich gebe sehr gern meine Leseempfehlung.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Lucy Barton ist Elizabeth Strouts alter ego und man ertappt sich immer wieder, die Ich-Erzählerin mit der Autorin gleichzusetzen, weil beide erfolgreiche Schriftstellerinnen sind und aus Maine stammen. Wie Tagebuchaufzeichnungen aus der dunklen Corona-Zeit, in einer scheinbar einfachen Sprache …
Mehr
Lucy Barton ist Elizabeth Strouts alter ego und man ertappt sich immer wieder, die Ich-Erzählerin mit der Autorin gleichzusetzen, weil beide erfolgreiche Schriftstellerinnen sind und aus Maine stammen. Wie Tagebuchaufzeichnungen aus der dunklen Corona-Zeit, in einer scheinbar einfachen Sprache gehalten, kommen dem Leser die kurzen Kapitel aus Strouts Roman vor und zuerst denkt man, dass " Am Meer" nicht an die wunderbaren Olive Kitteridge- Romane heranreicht. Aber Lucys Ratlosigkeit und Verzweiflung eröffnen einen empathischen Blick auf die gespaltene amerikanische Gesellschaft, jenseits des üblichen Schwarz- Weiß-Denkens. Nur warum der Verlag glaubte , das Cover mit dem Bild einer heilen Urlaubsidylle gestalten zu müssen, erschließt sich nicht.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Gebundenes Buch
Die innige und zugleich schwierige Beziehung zwischen den Protagonisten Lucy und William ist mir seit dem Vorgängerroman „Oh William“ vertraut. Diesmal wird ihr Verhältnis erneut auf die Probe gestellt. Das Coronavirus breitet sich in New York aus, und William bringt seine …
Mehr
Die innige und zugleich schwierige Beziehung zwischen den Protagonisten Lucy und William ist mir seit dem Vorgängerroman „Oh William“ vertraut. Diesmal wird ihr Verhältnis erneut auf die Probe gestellt. Das Coronavirus breitet sich in New York aus, und William bringt seine Ex-Frau in ein Haus in Maine, um sie zu schützen.
Auch für Leser, die das Paar noch nicht kennen, wird der Unterschied zwischen den Charakteren sofort sichtbar: Lucy fühlt sich überrumpelt und unterschätzt die Gefahr, während William vernunftgesteuert und tatkräftig alles Nötige in die Wege leitet. Ich konnte mich gut in Lucy hineinfühlen und erinnerte mich daran, dass auch mir der Lockdown damals so surreal vorkam. Ich war gespannt, ob die Ausnahmesituation die Verhaltensmuster, die sich nach 20 Jahren Ehe und 20 Jahre Trennung bei ihnen eingespielt haben, durchbrechen wird.
Das Talent der Autorin, subtil und mit wenigen Worten intensive Emotionen und eine existenzielle Erfahrungstiefe zum Ausdruck zu bringen, habe ich schon immer geschätzt, doch in diesem Roman erreicht dies noch eine höhere Stufe. Wie kein anderer schafft sie es, ihre aufmerksamen Beobachtungen, klugen Gedanken über zwischenmenschliche Beziehungen, Ängste und Erinnerungen an traumatische Erlebnisse in eine wunderbare Sprache zu packen. Wie die Pandemie nicht nur das Leben von Lucy, William und ihren Kindern, sondern auch New York verändert hat, ist absolut lesenswert.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
MP3-CD
Mein Hör-Eindruck:
Lucy Barton, eine erfolgreiche Schriftstellerin, und ihr Ex-Mann William fliehen vor der Corona-Pandemie aufs Land, nach Maine, ans Meer. Dort sind sie zwar in Sicherheit, aber die Auswirkungen der Pandemie erreichen sie über das Leben ihrer beiden Töchter …
Mehr
Mein Hör-Eindruck:
Lucy Barton, eine erfolgreiche Schriftstellerin, und ihr Ex-Mann William fliehen vor der Corona-Pandemie aufs Land, nach Maine, ans Meer. Dort sind sie zwar in Sicherheit, aber die Auswirkungen der Pandemie erreichen sie über das Leben ihrer beiden Töchter dennoch. Elizabeth Strout erzählt jedoch keinen Roman über Corona. Streng genommen hat ihr Roman keinen Plot. Die Ich-Erzählerin Lucy erzählt über das tägliche Leben in ihrem gemieteten Haus am Meer. Trotzdem ist der Roman keine Sekunde langweilig.
Lucy wirkt in ihrer negativen Haltung nicht unbedingt sympathisch. Das Meer ist zu grau, die Algen zu glitschig, der Strand zu eintönig, das Leben in Maine zu provinziell und so fort – Lucy findet an allem etwas auszusetzen. Aber das zurückgezogene Leben setzt in ihr andere Fähigkeiten frei. Sie entdeckt das Kleine und Unspektakuläre für sich, aber sie verliert nicht den Blick aufs Große, ganz im Gegenteil: aus der Distanz erkennt sie sehr genau die Spaltung der US-amerikanischen Gesellschaft, die sich auch in ihrer eigenen Familie spiegelt. Der Rückzug in die Stille am Meer lässt Kindheitserinnerungen in ihr hochkommen, ungute Erinnerungen an ihre Mutter und an die Armut ihrer Familie, die sie und ihre Geschwister von Geburt an auf die Verliererseite der Gesellschaft gestellt hätten.
Auch wenn sich Lucys Erzählungen dem Alltag widmen, ist er Roman alles andere als banal. Es geht um die allgemeinen Themen, denen sich ältere Menschen stellen müssen: z. B. um lebensbedrohliche Erkrankungen, die Einschränkungen des Alters, um Tod, um Verzicht und Verlassenheit und immer wieder um Verluste. Lucy entdeckt aber auch das Glück des Augenblicks durch Beobachtungen der Natur oder das Glück von freundschaftlichen Begegnungen. Lucy erzählt von familiären Krisen und Unglücksfällen und vor allem von ihrer langsam wachsenden Erkenntnis, welchen Wert das Vertraute in ihrem Leben hat.
Der Roman ist ein einziger großer Monolog, der im Plauderton vorgetragen wird, hier perfekt umgesetzt von Barbara Stoll. Immer wieder aber merkt man die menschenfreundliche und lebenskluge Haltung der Autorin, die durch den Monolog ihrer Protagonistin durchleuchtet. Was den Roman zu einem ganz besonderen Hör-Erlebnis macht. Ich freue mich auf den nächsten Roman von Elizabeth Strout.
Weniger
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Antworten 0 von 0 finden diese Rezension hilfreich
Andere Kunden interessierten sich für