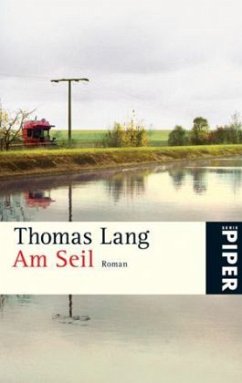Über zehn Jahre hat der fünfundvierzigjährige Gert seinen Vater nicht mehr gesehen. Zeitlebens hat er sich am starken Vater erfolglos abgearbeitet nun macht er sich auf, den inzwischen hinfälligen alten Mann ein letztes Mal im Heim zu besuchen Thomas Lang erzählt aus wechselnder Perspektive, präzise und packend, von einem geradezu archaischen Vater-Sohn-Konflikt, der eine überraschende Lösung erfährt. Dabei gelingen ihm bewegende und nicht selten von absurder Komik aufgeladene Bilder, die einen tief berühren und lange nachwirken.

Warum einfach, wenn's auch kompliziert geht: Thomas Langs Vater-Sohn-Roman / Von Tilmann Lahme
Felix hieß er früher. Eine bittere Ironie in der Namensgebung des Autors Thomas Lang, denn sein "Glücklicher" ist ein Gescheiterter, der mit seinem Vater, einem schwerkranken alten Mann, die Tenne in der Scheune des einsamen Bauernhofes, auf dem beide aufwuchsen, besteigt, um dort auf ein dramatisches Finale zuzusteuern. Mit seiner achtzehn Seiten umfassende Kurzgeschichte "Am Seil" gewann Lang im vergangenen Jahr mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis. Nun hat er den Roman gleichen Titels vorgelegt, in dem der prämierte Text das Schlußkapitel bildet.
Jetzt heißt der Sohn also nicht mehr, wie zu Klagenfurter Zeiten, Felix, sondern Gert, und man erfährt in fünf Kapiteln, die dem showdown vorangestellt sind, die Vorgeschichte der beiden, vor allem den zwischen ihnen schwelenden Konflikt. Der Vater leidet am körperlichen Verfall und wünscht sich statt eines Dahinsiechens im Heim ein selbstbestimmtes Ende, zu dem ihm sein Sohn verhelfen soll. Dieser war ein erfolgreicher Fernsehmoderator. Mit dem Begrabschen einer Assistentin begann sein Niedergang; ein Autounfall, bei dem seine minderjährige Geliebte starb - sie hat nun die Namensironie geerbt und heißt Felicitas -, sowie das anschließende Getöse in der Boulevardpresse haben ihm den Rest gegeben. Als Wrack, psychisch und finanziell, steht er nun vor seinem Vater, den er seit zehn Jahren nicht mehr gesehen hat.
Gert und Bert haben sich wenig zu sagen, sie vereint eine herzliche Abneigung, aber eben auch, wie der Namensklang andeutet, viel Gemeinsames. Vom Leben zermürbt sind sie beide, der eine nach einem kurzen und intensiven Leben, der andere nach einem langen, ereignislosen. Der Vater ist schwer von Parkinson gezeichnet, und auch der Junge hat schon ein "Zucken in den Gliedern" nervösen Ursprungs. Beide führen Pillendosen mit sich, beide tragen die gleiche Kleidung vom Unterschichtenausstatter C&A - Symptom des Abstiegs -, beide erhoffen sich vom Leben nichts mehr. "Wir wissen einfach nicht genug Bescheid, um unser Leben hinzukriegen", stöhnt Gert einmal.
Es gehört zu den entschiedenen Stärken der Erzählung von Thomas Lang, daß er nicht Partei ergreift, daß er sich aber ebensowenig um eine ausgewogene, verständnisvolle Haltung schert. Wir erfahren die Vater-Sohn-Geschichte aus der Perspektive der Protagonisten, die sich gegenseitig mit Schärfe und wenig Zuneigung betrachten. Vor allem der Vater dokumentiert seine Enttäuschung über die verfehlten Hoffnungen, die er in seinen Sohn steckte: Zu träge, unsportlich, haltungs- und antriebslos erschien er ihm stets. Zornesausbrüche ("eine dämliche Fresse") werden in Gedanken formuliert, Demotivierendes wird auch ausgesprochen: "Du müßtest vielleicht versuchen, etwas ... aufgeweckter dreinzuschauen." Ebendiesen "Besserwisser-Oberlehrer-Ton" empfindet der Sohn als existentielle Hypothek. Sein ganzes Leben habe er ihm mit solchen Bemerkungen "versaut", schreit er später. Und recht scheinen ja beide zu haben: Den Schnürsenkel des Vaters hat der Sohn beim Zubinden abgerissen, die Freundin in den Tod gefahren. Ein echter Versager, in allen Lebenslagen. Und der Vater stützt den Sohn, frei nach Trotzki, wie der Strick den Gehenkten. Schließlich stehen Vater und Sohn, mit einem Seil nun auch äußerlich verbunden, auf der Tenne, bereit zum Sprung in den Tod, wie es scheint.
Man versteht gut, was die Bachmann-Jury bewog, Thomas Langs furioses Schlußkapitel auszuzeichnen: erstickte Gefühle, Vorwürfe, Lebensschlußstrich, alles nur in Andeutung und mit knappen, aber präzisen erzählerischen Mitteln dargeboten, dazu Genauigkeit der äußeren Abläufe und der Szenerie. Nur: Reichte das nicht? Darin kam schon alles vor, der Konflikt, die Vorgeschichte, der beidseitige Todeswunsch - wofür also noch die vorhergehenden 143 Seiten? Die, wie man hört, Lang erst nachträglich schrieb, um aus seiner Geschichte ein Buch zu machen. So funktioniert das nicht. Dem Schlußkapitel fünf weitere voranzustellen, um das ganze dann "Roman" nennen zu können, ist vom Marketing her verständlich, aber erzählerisch und kompositorisch kaum gelungen.
Zehn Jahre haben sich Vater und Sohn nicht gesehen, aber exakt an dem Tag, an dem Gert (auf einem geklauten Motorrad) zu Besuch kommt, erfährt die vom Vater geliebte Pflegerin Bubi, daß sie entlassen wird. Weitere Nahrung für den Todeswunsch Berts, aber trotz der intensiven Beziehung zu Bubi verschwindet sie fortan fast vollständig aus seinem Sinn. Und Gert? Hätte nicht der Tod der minderjährigen Geliebten oder die Grabscherei genügt, um seinen tiefen Fall zu motivieren?
Einzelne Beobachtungen überzeugen, etwa die Ausgrenzung der Pflegefälle unter den Heimbewohnern, weil man mit dem drohenden Schicksal nicht konfrontiert werden will; schön auch die Relativierung der Alterserotik: "Junge Mädchen wirken nur in der Vorstellung anziehend. In der Wirklichkeit sind sie psychische und soziale Ich-AGs"; oder, in Langs Art des Wie-nebenher-Formulierens, ein Hinweis zum Thema Abtreibung: "Unheimliche Macht der Frauen über Leben und Tod".
Doch solch leuchtende Stellen können nicht darüber hinwegtäuschen, daß die zusätzliche Motivierung dem Schluß eine Kolorierung verpaßt, die das Offene und Doppelbödige tilgt. Handelt es sich wirklich um einen Doppelselbstmord? Die dichte Todessymbolik legt dies nahe - mehrfach betont ja auch der Sohn, er sei am Ende. Und doch hat der Vater in Todesangst eine Art Vision, wie Gert seine Geliebte absichtlich totfährt, erscheint der Sohn, der tapsige, schließlich stark, geschickt und unergründlich. "Die Trotteligkeit ist seine Maske." Der Beginn von Nick Caves "Let Love in" steht als Motto der Erzählung voran: Von Verzweiflung und Täuschung, den "häßlichen Schwestern der Liebe" ist da die Rede. Nach 170 Seiten hat der Leser nur noch die Verzweiflung im Blick.
Thomas Lang: "Am Seil". Roman. Verlag C.H. Beck, München 2006. 174 S., geb., 16,90 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Rezensent Tilmann Lahme unterschreibt voll und ganz das Urteil der Klagenfurter Jury, die Thomas Lang für das letzte Kapitel seines Vater-Sohn-Romans den Ingeborg-Bachmann-Preis zuerkannte: "erstickte Gefühle, Vorwürfe, Lebensschlusstrich" - und das knapp, aber präzise beschrieben. Das Buch selbst allerdings erntet herbe Kritik des Rezensenten. Es ist erst nachträglich geschrieben worden, um aus der preisgekrönten Geschichte einen Roman zu machen, meint Lahme. Aber "so funktioniert das nicht!" echauffiert sich der Rezensent, der das Unternehmen nur "vom Marketing her" verständlich findet. Erzählerisch kann er ihm nichts abgewinnen. Lang schildere die komplizierten Beziehung zwischen einem Mann, der im Alter dem köperlichen Verfall anheimgegeben ist, und seinem Sohn, dessen vielversprechende Karriere als Moderator abbricht, als er eine Assistentin begrabscht. Das Drama endet im Doppelselbstmord, jedenfalls legt die Symbolik diesen Schluss für den Rezensenten nahe. Sicher ist er nicht. Besonders übel nimmt Lahme, dass die nachträglich geschriebenen Kapitel dem in Klagenfurt ausgezeichneten Text das "Offene und Doppelbödige" austrieben.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH