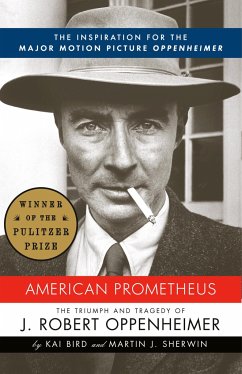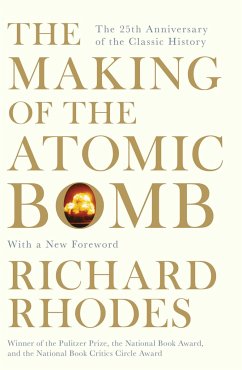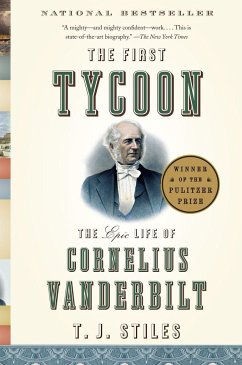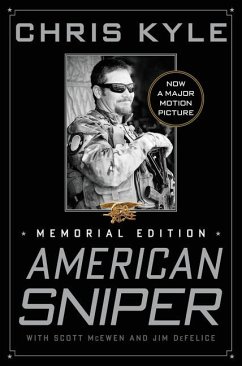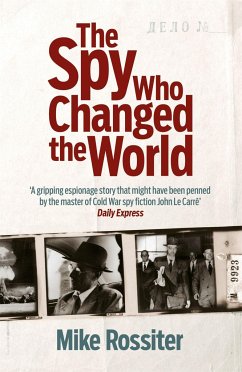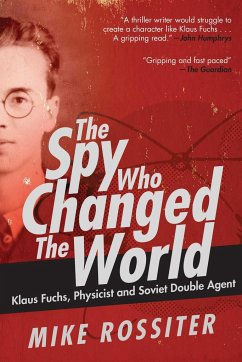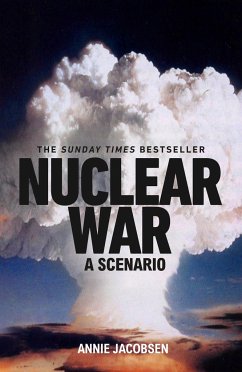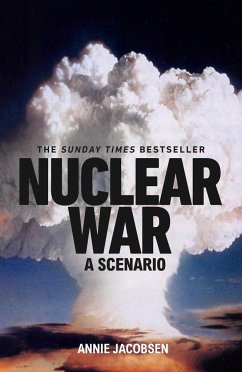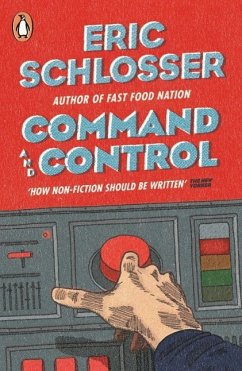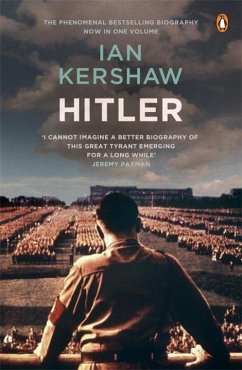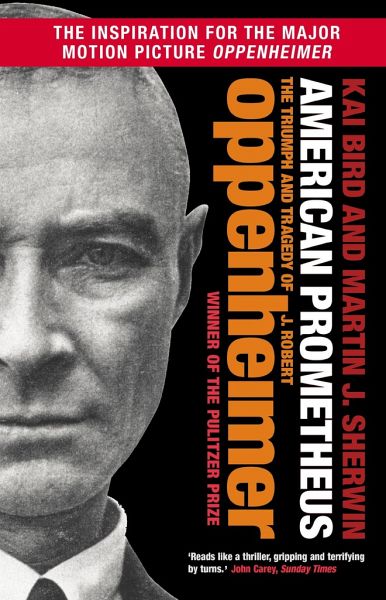
American Prometheus
The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer
Versandkostenfrei!
Sofort lieferbar
11,99 €
inkl. MwSt.
Weitere Ausgaben:

PAYBACK Punkte
6 °P sammeln!
Winner of the Pulitzer Prize, published to exceptional reviews in both the US and the UK, American Prometheus is as compelling a work of biography as it is a significant work of history.